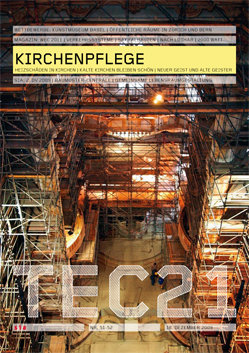Editorial
Die über 5000 Kirchen in der Schweiz dienen nicht nur dem Gottesdienst, sondern erfüllen weitere wichtige Funktionen: Sie transportieren Identität, indem sie die Dorfmitte oder das Quartierzentrum markieren und als soziale Orte funktionieren. In Kirchen versammelt man sich zu wichtigen Momenten im Leben von der Taufe bis zur Abdankung und trifft dabei bekannte und fremde Menschen aus allen Generationen, denen man sonst selten begegnet. Kirchen dienen für Kulturveranstaltungen und sind Museen der Glaubens-, Kunst-, Geistes- und Sozialgeschichte.
Die Vielfalt der Nutzungen und des Bestandes macht das Erneuern von Kirchen (oft auch von einfachen Kapellen) zu einer technisch anspruchsvollen Bauaufgabe. Häufig geht es darum, mit baulichen Eingriffen und geeigneter Haustechnik den Betrieb als multifunktionales öffentliches Gebäude mit klimatischen Anforderungen unter einen Hut zu bringen, einem Museum entsprechend. Denn Interieurs, Fresken, Ölbilder, Textilien, Bücher und der übrige Kirchenschatz sind oft wertvoll und von historischer Bedeutung und deshalb auf ein konservierendes Raumklima angewiesen.
Die Artikel «Heizschäden in Kirchen» und «Kalte Kirchen bleiben schön» zeigen, dass Bauherrschaften und Ausführende leider nicht immer auf der Höhe dieser Aufgabe sind: Häufig sind nämlich Folgeschäden von vorangehenden Eingriffen der Auslöser für eine erneute Sanierung. Und oft hängen die Schäden mit dem Heizen und nachträglichen Isolieren zusammen. Der Bauphysiker Emil Giezendanner zog eigentlich aus, um den Energieverbrauch von übertrieben geheizten Kirchen zu messen und zu senken – und fand Schäden an der Substanz und an Kulturgütern, die durch falsches Heizen verursacht werden und noch um ein Vielfaches teurer sind als der unnötige Energieverschleiss. Er und der Kirchenrestaurator Ivano Rampa plädieren in ihren Artikeln für weniger, vor allem aber sachgerechteres Heizen in Kirchen.
Einen Fall von funktioneller Überfrachtung beschreibt der Artikel «Neuer Geist und alte Geister»: Das neue Paulinum in Leipzig soll Uni-Aula, Kirche und Museum sein und auch noch die Sehnsucht der Leipziger Bevölkerung nach einer ungebrochenen Geschichte stillen – zu viel für einen Neubau, findet Katinka Corts.
Das Schweizer Stimmvolk hat am 29. November den Bau von Minaretten verboten. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander, und doch lässt sich aus diesem Verdikt etwas ableiten, das Befürworter wie Gegner unterschreiben werden: Die Themen Immigration, Integration, Religiosität, kulturelle Differenz bzw. wie eine demokratische Kultur damit umgehen soll müssen nun intensiv und breit diskutiert werden. Einige Grundlagen dazu liefern die auf Seite 17 vorgestellten Bücher über Moscheen in Europa als soziale Orte und als Bauaufgabe sowie über jüdische und christliche Sakral-bauten.
Ruedi Weidmann, weidmann@tec21.ch
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Quo vadis Kunstmuseum Basel? | Max-Frisch-Platz, Zürich Oerlikon | Öffentliche Räume WankdorfCity, Bern
16 MAGAZIN
Treffpunkt der Ingenieure 2011: Genf | Sakralbauten | Sicheres Verkehrssystem Strasse | Der Wald zehn Jahre nach Lothar | 2000 Watt und viele Fragen
24 HEIZSCHÄDEN IN KIRCHEN
Emil Giezendanner
Viele Kirchen werden, obwohl nur punktuell genutzt, dauernd geheizt. So geht Energie verloren. Viel teurer sind aber die Schäden an der Bausubstanz.
28 KALTE KIRCHEN BLEIBEN SCHÖN
Ivano Rampa
Wenn Kirchen, die als kalte Räume gebaut wurden, heute geheizt und isoliert werden, leiden Fresken, Bilder und Mobiliar. Aus dem Alltag eines Restaurators.
32 NEUER GEIST UND ALTE GEISTER
Katinka Corts
Ein Streit bewegt Leipzig: Soll die neue Uni-Aula auch Kirche sein? Es geht nicht um Wissenschaft und Religion, sondern um Geschichte und Identität.
36 SIA
2. Delegiertenversammlung 2009 | Freunde der Baumuster-Centrale | Gemeinsame Lebensraumgestaltung | 42. ZNO-Sitzung | Der weibliche Blick auf die Zukunft | «Dietro c’è un ingegnere civile»
43 FIRMEN
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Heizschäden in Kirchen
Viele Kirchen werden durchgängig geheizt, obwohl sie nur einige Stunden in der Woche gebraucht werden. Dadurch geht viel Energie verloren. Viel stärker ins Gewicht fällt jedoch – finanziell wie kulturell – der Schaden, den unsachgemässes Heizen in Kirchen an Bausubstanz und Einrichtung verursacht. Erstmals liegen dazu Schätzungen und Erfahrungsberichte vor.
Für alle Kategorien von beheizten Gebäuden ist in der Schweiz der Energiebedarf bekannt – ausser für die über 5000 Kirchen. Eine erstmalige Erhebung, basierend auf gesicherten Daten von über 250 Kirchen und Hochrechnungen, zeigt: Beim Energieverbrauch der Kirchen gibt es ein Sparpotenzial von mindestens 100 Mio. kWh oder 15 Mio. Franken pro Jahr. Doch mit unsachgemässem und übertriebenem Heizen wird nicht nur Energie vergeudet. In vielen Kirchen entsteht dadurch auch ein Innenklima, das die wertvolle Bausubstanz schädigt.
Heizen ist nicht nur heimelig
Rund 80 % der Kirchen in der Schweiz wurden vor 1850 erbaut, das bedeutet als Gebäude ohne Heizung. Später kamen während des Gottesdienstes einfache Kohleöfen zum Einsatz. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man im grossen Stil, die Kirchen mit elektrischen Heizungen auszurüsten. Das war bequem: Lediglich mit einer Schalterdrehung war es nun möglich, die gewünschte behagliche Innentemperatur einzustellen, und das auch ausserhalb der Nutzungszeiten. Rasch verbreitete sich die Vorstellung, in einer Kirche müsse ständig und unabhängig von der Nutzungshäufigkeit eine Temperatur von 12 bis 16 °C herrschen. So wurden die Kirchen von nicht oder nur temporär beheizten zu ständig beheizten (aber nicht isolierten) Gebäuden. Was für die Kirchgänger an einem oder zwei Anlässen pro Woche angenehm war, schadete nun der Bausubstanz und der Inneneinrichtung rund um die Uhr. Die konstant hohe Beheizung führt in Gebäuden, die nicht dafür gebaut sind, in der Regel zu einem Raumklima, das zu Schäden führen kann: Mauerwerk und Wandbilder leiden unter Versalzungen, die Oberflächen unter rascher Verschwärzung, und an Altären, Chorgestühl, Bildern und Orgeln schwindet, springt und verformt sich das Holz durch die Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit.
Der Energieverbrauch der Schweizer Kirchen
Vor rund zwanzig Jahren wurden im Auftrag der evangelischen Landeskirche des Kantons St. Gallen erstmals in der Schweiz Kirchen systematisch auf ihren Energieverbrauch untersucht. Evangelische Landeskirchen aus anderen Kantonen und später auch katholische Landeskirchen haben sich angeschlossen. Die mittlerweile vorliegenden detaillierten Angaben über das Innenraumklima und den Energieverbrauch von über 250 Kirchen lassen sich erstmals auf die ganze Schweiz hochrechnen.
Die Ergebnisse lassen aufhorchen. Aufgrund der Erhebungen kann die durchschnittliche Kirche wie folgt definiert werden: Sie wurde vor rund 150 Jahren erbaut, verfügt über 330 Sitzplätze, hat eine Energiebezugsfläche EBF von 390 m² und wird mit einer über 25-jährigen Bankheizung elektrisch beheizt. Der Energieverbrauch beträgt 140 kWh/m2 (elektrisch) beziehungsweise 170 kWh/m2 (Öl/Gas) pro Jahr. Er ist jedoch in der Praxis sehr unterschiedlich. Laut der Hochrechnung beträgt der Gesamtenergiebedarf der rund 5000 Kirchen in der Schweiz mehr als 350 000 MWh pro Jahr; das entspricht 50 Mio. Franken.sparpotenzial durch temporäres aufheizen Betrachtet man den Energieverbrauch ausserhalb der Belegungszeiten als Sparpotenzial, kann nur schon durch gezielteres Beheizen mindestens ein Drittel des heutigen Energieverbrauches eingespart werden: Würde ausserhalb der Nutzungszeiten etwa erst geheizt, wenn die Innentemperatur unter 8–10 °C fällt, betrüge die Energieeinsparung im Vergleich zu einem Heizbetrieb mit etwa 12 °C mehr als die Hälfte. Wird die Temperatur für die Nutzung kurzzeitig und in der richtigen Aufheizgeschwindigkeit erhöht, führt dies zu einer Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit. Dieses vorübergehend veränderte Klima der Kirche ist jedoch bedeutend weniger schädlich als ständiges Durchheizen auf einem viel zu hohen Temperaturniveau. Tiefere Temperaturen schonen die Substanz, vermindern das Auftreten von Verschwärzungen und verlängern durch das günstigere Klima die Lebensdauer von Bemalung, Orgel und übriger Einrichtung.
Energieverbrauch und Renovationskosten
Eine Kirchenrenovation erfolgt im Durchschnitt alle zwanzig bis vierzig Jahre. Das bedeutet, dass gesamtschweizerisch jährlich 200 Kirchen renoviert werden, mit Gesamtkosten von 100 – 500 Mio. Franken. Die Renovationszyklen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Auftreten von Schäden – und diese wiederum mit dem Heizen. In den Untersuchungen korrellieren hoher Energieverbrauch und hohes Schadenrisiko. Vereinfacht ausgedrückt: Je wärmer die Kirchen, desto häufiger müssen sie renoviert werden.
Fallbeispiel 1: Verschmutzung durch Zugluft und Kerzen Bereits fünf Jahre nach der letzten Innenreinigung weist die Kapelle Ried in Lachen SZ aussergewöhnlich starke Verschmutzungen auf (Abb.1). Die Untersuchungen und Messungen zeigen konstant ungünstige Luftumwälzungen wegen der ungleichen Verteilung der Heizleistung in Chor und Schiff. Das führt zu unangenehmer Zugluft für die Kirchgängerinnen und Kirchgänger und zu ungünstigen Abbrandverhältnissen für die Votivkerzen im Opferstand mit entsprechend starker Bildung von Russ, der sich an der Decke absetzt.
Fallbeispiel 2: Schäden an historischer Substanz durch Fensterbankheizung In der evangelischen Kirche Bergün GR stellte der Restaurator eine Zunahme der Schadstellen an der gefassten, historisch wertvollen Holzdecke aus dem 16. Jahrhundert fest (vgl. Seite 29 und Abb. 2–3). Die Ursache war der unbeabsichtigt falsche Betrieb der Fensterbankheizung. Die zu warme trockene Luft trocknete die Bretter der Holzdecke aus, was zu Schwinden des Holzes und Abplatzungen der Farbe führte.
Fallbeispiel 3: Richtig Heizen statt Befeuchten Messungen in der Deutschen Kirche Murten zeigten, dass allein mit einer Optimierung des Heiz- und Lüftungsbetriebs das Innenklima derart positiv beeinflusst werden konnte, dass auf den Befeuchter in der Orgel, der das Orgelholz vor dem Austrocknen schützt, verzichtet oder dessen risikovoller Betrieb zumindest stark reduziert werden kann (Abb. 6–7).
Kirchen richtig heizen – ein Vorschlag
Über das «richtige Heizen» einer Kirche gibt es eine Vielfalt von Meinungen. Der meist von Vorgängern überlieferte Heizbetrieb mit Handschaltung nach Gefühl ist nach wie vor die gängige Praxis, er ist jedoch nicht mehr zeitgemäss. Selten wird auf diese Weise komfortabel, energiesparend und substanzverträglich geheizt. Erst nach einer seriösen Grundlagenuntersuchung durch Spezialisten wird es möglich, eine Heizungsregulierung so einzustellen, dass sowohl der erwünschte Komfort bei Belegung als auch eine möglichst hohe Verträglichkeit für Bausubstanz und Einrichtung erreicht werden.
Oft können die installierten Heizsysteme beibehalten werden, ihre Leistung ist meist überdimensioniert. Hingegen lassen veraltete oder defekte Regelmöglichkeiten einen optimieren Heizbetrieb oft nicht oder nur mit grossem zeitlichem Aufwand zu. Nicht selten kann aufgrund der Messergebnisse die vorhandene Steuerung reaktiviert, ergänzt oder einfach repariert werden. In anderen Fällen ist sie zu erneuern. Heutiger Stand der Technik sind automatische, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS-Steuerungen). Sie haben ein einfach zu bedienendes Touchpanel (Abb. 4) und bieten die Möglichkeit, die Raumluftfeuchtigkeit zu überwachen und bei Bedarf automatisch zu beeinflussen.Einige wichtige Grundsätze für das Beheizen von Kirchen:
– Während Anlässen ist eine Komforttemperatur von 16–18 °C und ein Klima ohne Zugluft zu gewährleisten; hier ist Energiesparen fehl am Platz.
– Ausserhalb der Anlässe, also während rund 95 % der Zeit, ist eine möglichst tiefe Grundtemperatur (8–10 °C) anzustreben – so kann am wirkungsvollsten Energie gespart und gleichzeitig die Bausubstanz geschont werden.
– Der Temperaturanstieg auf einen Anlass hin sollte mit der richtigen (vom Restaurator empfohlenen) Aufheizgeschwindigkeit erfolgen.
Die Optimierung des Heizbetriebs ebenso wie flankierende bauliche Massnahmen wie etwa Isolationen sollten von Fachpersonen begleitet und kontrolliert werden, damit nötigenfalls Korrekturen vorgenommen werden können. Es gilt dabei eine Vielzahl von Faktoren zu beachten: Heizleistung und Verteilung, Aufheizgeschwindigkeit, Deckendämmung, Fensterkondensat, Zuglufterscheinungen, Schutzverglasungen, Bodenhohlräume unter Bänken, Lüftungsöffnungen in Fenstern, aufsteigende Wandfeuchte, Veränderung des Orgelklimas usw. Nur mit regelmässigen Kontrollen kann gesichert werden, dass der neue Heizbetrieb tatsächlich über Jahrzehnte energiesparend und substanzschonend ist.TEC21, Fr., 2009.12.18
18. Dezember 2009 Emil Giezendanner