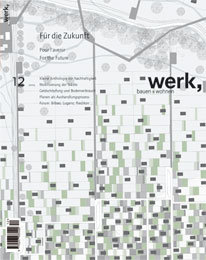Editorial
Dieses Heft erscheint, während in Kopenhagen die UNO-Weltklimakonferenz stattfindet – seit Berlin 1995 ist es die fünfzehnte. Diese jährlichen Treffen sind im Grunde Nachfolgekonferenzen zum Rio-Umweltgipfel von 1992. Damals hielt zum ersten Mal ein internationaler Vertrag fest, dass die Staatengemeinschaft im Zusammenhang mit dem ernsthaften Problem des Klimawandels zum Handeln verpflichtet sei. Rechtlich verbindliche Emissionshöchstmengen für die schädlichen Treibhausgase wurden 1997 im Kyoto-Protokoll beschlossen. Dieses läuft 2012 aus. Die Verhandlungen in Kopenhagen sollen vor allem das Klimaregime für die Zeit danach regeln. Denn die Erwärmung der erdnahen Atmosphäre und der Meere bringt eine Vielzahl globaler, regionaler und lokaler Folgen mit sich, die uns heute mehr denn je zu nachhaltigem Handeln drängen.
Der Brundtlandbericht von 1987 unterschied die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, 2002 ergänzt durch die kulturelle Nachhaltigkeit, welche für die Gesellschaft von übergreifender Bedeutung ist. Im heute gebräuchlichen Sinn taucht der Begriff "sustainable" erstmals 1972 im Bericht "Die Grenzen des Wachstums" an den Club of Rome auf. In jenen Jahren setzt denn auch die kleine Anthologie mit Texten zur Nachhaltigkeit ein, die Dominique Gauzin-Müller für unser Heft zusammengestellt und kommentiert hat. Der sorgsame Umgang mit den Ressourcen unserer Erde war schon lange vor der ersten Ölkrise ein Thema. Zwölf Texte aus den letzten vierzig Jahren führen in thematischer Folge durch die vier Aspekte der Nachhaltigkeit. Es gilt, Kultur- und Landschaftsräume zu erhalten, soziale und kulturelle Ressourcen zu pflegen, ohne die es keine tragfähige Grundlage für eine lebenswerte Gesellschaft und keine gerechtere Wirtschaft ohne Ausbeutung geben kann.
Ein exklusiv für unsere Zeitschrift verfasster Aufsatz der amerikanischen Soziologin Saskia Sassen und ein Gespräch mit dem schweizerischen Ökonomen Hans Christoph Binswanger bieten aufschlussreiche Einblicke in die komplexe gegenseitige Durchdringung sozialer Bedingungen, wirtschaftlicher Mechanismen und ethischer wie ökologischer Gebote. Um der Nachhaltigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, ist Forschung notwendig – auch in der Architektur. Einem auf den ersten Blick wenig nachhaltigen Thema widmet sich ein unter der Leitung des Architekten Max Bosshard an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur durchgeführtes Forschungsprojekt, das wir ergänzend zu den anderen Beiträgen diesem eigentlichen Leseheft einfügen. Schliesslich folgen wir einer Bildspur mit Fotografien von Yves André: Sie zeigt Ansichten aus der Schweiz, Bilder mit Bauten und Infrastrukturen, Bilder, die aus der Vogelperspektive vom Verbrauch des Bodens erzählen und auf ihre Weise entlarvend und schonungslos die Frage der Nachhaltigkeit aufwerfen – auch als Herausforderung an die Planer, Architekten und Ingenieure.
Die Redaktion