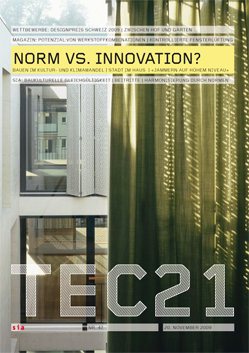Editorial
Minergie ist weltweit einer der erfolgreichsten Baustandards für energieeffiziente Gebäude.[1] Diesen Erfolg verdankt das Label zum einen seinen klar umrissenen und relativ einfach umsetzbaren Anforderungen. Zum anderen konnte es die Banken überzeugen, von denen heute viele vergünstigte Hypotheken für Minergie-Bauten anbieten.
Und nicht zuletzt setzte Minergie von Anfang an auf professionelles Marketing. Der Erfolg zeigt sich nicht nur in der Zahl zertifizierter Gebäude – aktuell mehr als 14 500 –, sondern auch im grossen Bekanntheitsgrad, den das Label in breiten Bevölkerungskreisen erlangt hat. Auch die private Bauherrschaft macht sich heute Gedanken über energieeffizientes Bauen. Dem Minergie-Label als Vorreiter ist es auch zu verdanken, dass nun die kantonalen Mustervorschriften verschärft worden sind.
So positiv dieser Erfolg ist, so sehr werden durch die allseitige Förderung des Standards Minergie alternative und innovativere Möglichkeiten energieeffizienten Bauens an den Rand gedrängt. Wir haben daher mit diesem Heft einen Blick zur Seite und nach vorn geworfen. Drei Fachleute, die in diesem Heft als kritische Stimmen zu Wort kommen, plädieren dafür, differenzierte Herangehensweisen zuzulassen, und geben zu bedenken, dass jede Norm dem wissenschaftlich-technischen Entwicklungsstand um Jahrzehnte hinterherhinkt. Werner Waldhauser und Kurt Hildebrand erkennen im Interview mit TEC21 (vgl. S. 50) die Bedeutung des Minergie-Labels für die breite Masse der Gebäude durchaus an, stellen aber klar, dass nicht a priori das Label, sondern ein nachhaltiges Gebäude das Ziel sein sollte. Ein Beispiel für dieses Denken ist der neue Wohnungsbau auf dem Merker-Areal in Baden (vgl. S. 42), der zwar in puncto Energieverbrauch die Anforderungen des Labels Minergie-P erfüllt, bei der Gebäudehülle aber zugunsten der architektonischen Qualität darauf verzichtete. Ebenso erhielt der sanierte Altbau auf dem gleichen Gelände kein Label, weil er auf natürliche statt kontrollierte Lüftung setzte. Ulrich Pfammatter plädiert zudem dafür, den Blick zur Seite auch auf andere Kulturregionen auszudehnen, die nachhaltiges Bauen teilweise ganz anders definieren (vgl. S. 38). Dies zeigt sich auch in anderen nationalen Labels , von denen einige ein viel breiteres Spektrum an Kriterien berücksichtigen als das Minergie-Label, beispielsweise den Landverbrauch oder den Anteil erneuerbarer Energiequellen. Eines davon, das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, soll nun auch in der Schweiz etabliert werden, wie Anfang November bekannt wurde(vgl. S. 26) – vielleicht ist das ein Impuls, der breitere Kreise zum Hinterfragen des lieb und bequem gewordenen Weges motiviert.
Claudia Carle
Anmerkung:
[01] Ernst & Young Real Estate: Green Building – Ist Zertifzierung für Sie ein Thema?, 2008
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Designpreis Schweiz 2009 | Zwischen Hof und Garten
18 MAGAZIN
Potenzial von Werkstoffkombinationen | Holzcontainer als mobile Minihäuser | Publikationen | Neue Holzhäuser energetisch top | Kontrollierte Fensterlüftung im Test
30 PERSÖNLICH
Dolf Schnebli, 1928–2009
38 BAUEN IM KULTUR- UND KLIMAWANDEL
Ulrich Pfammatter
Nachhaltiges Verhalten kann nicht die Verfestigung des Gewohnten und Genormten bedeuten, sondern erfordert transkulturelles Lernen und die Entwicklung mutiger Visionen.
42 VOM HAUS IM HAUS ZUR STADT IM HAUS
Rahel Hartmann Schweizer
Der Merker-Park in Baden von Zulauf & Schmidlin Architekten ist verwinkelt wie eine mittelalterliche Stadt und doch systematisiert. Das Energiekonzept berücksichtigt den Minergie-P-Standard beim Verbrauch, nicht aber bei der Hülle.
50 «JAMMERN AUF HOHEM NIVEAU»
Rahel Hartmann Schweizer, Judit Solt, Claudia Carle
Die Gebäudetechnik-Experten Werner Waldhauser und Kurt Hildebrand diskutieren über Vor- und Nachteile von Labels, alter-native Lösungsansätze und die Aufgabe von Fachpersonen dabei.
57 SIA
Baukulturelle Gleichgültigkeit | Beitritte zum SIA | Harmonisierung durch Baunormen | Vernehmlassung und Besichtigung
62 MESSE
An der diesjährigen «Hausbau- und Energiemesse» stellen gegen 400 Firmen aus.
66 PRODUKTE
Neu: mit Weihnachtsverlosung
89 IMPRESSUM
90 VERANSTALTUNGEN
Bauen im Kultur- und Klimawandel
Baukultur und Kulturgeschichte des Bauens gäbe es nicht, wenn nicht zahlreiche Gesellschaft en in allen Kulturregionen und Klimazonen seit je ihre Lebensweise und ihre Kulturtechniken dem ständigen kulturellen Wandel, den veränderten Umweltbedingungen und ökonomischen Möglichkeiten angepasst hätten. Nachhaltiges Verhalten angesichts der heute zunehmend komplexeren, extremeren und unberechenbareren Veränderungen kann nicht die Verfestigung des Gewohnten und Genormten bedeuten, sondern erfordert transkulturelles Lernen ebenso wie die Entwicklung mutiger Visionen.
Zuerst stellt sich eine Verständnis- bzw. Verständigungsfrage: Ist mit «Nachhaltigkeit» im Bauen die bauliche «Dauerhaftigkeit» gemeint? Ist die vitruvianische Forderung nach «firmitas» noch aktuell? Müssen oder sollen wir massiv bauen, um es dem Bestand gleichzutun, der mit 500- bis 1000-jährigen Gebäuden aufwarten kann? Mobilität, Flexibilität und Adaptabilität sind heute nicht nur Zeichen der Zeit, sondern konkrete (freiwillige oder erzwungene) Lebenshaltungen. Welche Gebäudetypen, Siedlungsmuster und urbanen Szenarien passen zu einem solchen Kulturwandel?
Wie leben wir in 10, 20, ... 50 Jahren?
Diese Frage stellt sich, wenn wir die übliche Definition von Nachhaltigkeit heranziehen. Chris Luebkeman von Arup hat zu den brennenden Problemfeldern in einem umfangreichen Katalog kritische Fragen gestellt und dazu Fakten über Entwicklungstendenzen zusammengetragen. Die Fragen sind nicht beantwortet, nur gestellt. Sie inspirieren zum Denken und Handeln. Einige der Fragestellungen treffen den Nerv im Bereich des Bauens (vgl. nebenstehenden Kasten).
Politische Formeln oder Ressourceneffizienz?
Für die politische Debatte ist es einfacher, mit einprägsamen Formeln zu operieren, beispielsweise mit «CO2», «Stromlücke», «Supergau», «Nullenergie», «Zero-Carbon», «Kioto» etc. Damit kann mobilisiert, Freund und Feind unterschieden und das Profil von Person, Partei und Staat geschärft werden. Im Gegensatz dazu erfordern Strategien, die der Sache und einer professionellen Behandlung der Probleme gerecht werden, differenziertere Muster und Modelle des Denkens und Handelns. So kann in einem Fall die Standortfrage im planerischen Szenario den Ausschlag für nachhaltige Wertschaffung geben, in einem anderen Fall der konstruktive Typus eines Gebäudes oder auch der soziokulturelle Nutzen, die langen Transportwege eines speziellen Baustoffes oder dessen Herstellungsverfahren, schliesslich die Lebensdauer einer industriellen Anlage oder deren Lebensverlängerung durch Umnutzung und Transformation. Ist es sinnvoll, alles über den Leisten «carbon neutral» zu schlagen? Wer hat schon die graue Energie eines AKW berechnet? Warum soll nicht alles daran gesetzt werden, die unendliche Verfügbarkeit von Sonnen-, Wind- und Erdwärmeenergie auszuschöpfen, wie dies im aktuellen, zweiten «Stern-Report»[1] im Hinblick auf die Uno-Klimakonferenz in Kopenhagen postuliert wird? Ist unsere Bautechnik gut beraten, mit immer dickeren Wärmedämmungen und dichteren Wänden Bauschadenpotenziale zu erzeugen, die man mit verkappten Klimaanlagen (kontrollierte Raumlüftung oder Komfortlüftung) auf Hightech-Niveau bekämpfen muss? Müsste die Forschung nicht fokussieren auf die Effizienz räumlich-funktioneller Szenarien, auf Raumklima-Zonierungskonzepte und ressourceneffiziente, hybride konstruktive Typo logien bezüglich Tragsystemen und schlanker Gebäudehüllen? Über die Wirksamkeit neuer Materialien, Composites und Technologien forscht beispielsweise die Empa vorbildlich.
Energieeffizienz - eine „nationale Frage“?
Die unterschiedlichen Lebensstandards und Instrumente zur Bewertung nachhaltiger Strategien in den verschiedenen Ländern verdeutlichen, dass je nach Kulturregion und klimatischer Betroffenheit auch andere Vorstellungen darüber existieren, was Nachhaltigkeit im Bauen bedeutet. Dazu kommen Faktoren wie historische Hintergründe, wirtschaftliche Entwicklung, Einflüsse von Denkschulen etc., welche die abweichenden Standards, Labels und Normen prägen. So gilt in den USA das LEED-System mit LEED Silber, Gold oder Platinum als «Gütesiegel» und nachhaltige Messlatten. In Deutschland wird das Gütesiegel DGNB als Hilfestellung, Bewertungsgrundlage und Planungsmethodik-Tool angewendet. In England wurde 1990 das BREEAM-Tool eingeführt (vgl. nebenstehenden Kasten). In der Schweiz kennt man Minergie, Minergie-P und Minergie-(P)-Eco (vgl. Kasten S. 54) diverse Einzel zertifizierungen etc.
Mit allen Instrumenten wird beabsichtigt, konkret bewertbare und kontrollierbare Aussagen zu einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen und Leistungen zu formulieren und «gute Noten» auch zu zertifizieren. Die Auslegeordnung[3] zeigt einerseits, dass die Standards, Zertifizierungen und Labels national festgelegt sind und unterschiedliche Schwerpunkte und Gewichtungen implizieren; andererseits verdeutlicht sie auch die offenkundige Unmöglichkeit einer «universellen Formel». Daher auch die verschiedenen Interpretationen, was denn «Nach haltigkeit» im Bauen bedeuten soll.
What's next?
Betrachtet man den Stand der Dinge heute, wie er hierzulande mit Minergie als höchster Zielstufe (statt als Ausgangspunkt für weitergehende Entwicklungen) verstanden und gehandhabt wird, fragt man sich, was nachher kommen wird.[4,5] Zero-Energy und Plus-Energie sind geschickte Kombinationen verfügbarer Techniken. Vielleicht wird man auch durch genaues Studium der Energieeffizienz natürlicher Phänomene Neuland beschreiten.[6] Das «Nächste» hingegen, das uns in 10, 20 oder 50 Jahren beschäftigen wird, kann oder muss «gedacht» werden.
Während das Hier und Jetzt («the now») von gewohnten multidisziplinären Teams und Instituten bearbeitet und das Neue («the new») durch interdisziplinäre Denkschulen entwickelt wird, erfordert die Vision von Kommendem («the next») transdisziplinäres Denken und «learning companies». Während die aktuell verfügbaren Kulturtechniken in der Architektur (ressourceneffiziente Konstruktionen, energieeffiziente Bauweisen, leistungsoptimierte Materialien und massgeschneiderte Technologien) vor 10, 20 Jahren als «new» entwickelt worden sind, drängt die Entwicklung nach Neuem, nicht nach Verfestigung des Gewohnten und Genormten. Jede Generation hat ihre Erfahrungen und Vorstellungen von Normen, wie z.B. das Erdbebenwisssen illustriert. Die Erneuerung dauert nochmals eine Generation – wir sind also immer zwei Generationen im Rückstand, wenn wir nicht laufend das aus Forschung und Experiment generierte Wissen umsetzen.
Die Institutionalisierung von Forschung und Entwicklung, deren Apparate und Agenturen sind geeignet, Neues zu erarbeiten. Die Finanzierungsinstrumente und Bewertungskriterien stehen jedoch oft auf Stufe «now». Deshalb zeigt das Studium der Baukultur- und Bautechnikgeschichte, dass epochenprägende und zukunftsweisende Erfindungen, Entwicklungen, Projektansätze und Experimente vielfach ausserhalb des institutionalisierten Geschehens generiert und später adaptiert worden sind, nachdem der soziale Nutzen gesellschaftliche Akzeptanz fand bis hin zur normativen Festsetzung. Die Beispiele im nebenstehenden Kasten sind Resultate mutiger Teams, Projektgemeinschaften und Denkschulen und stiessen anfänglich auf institutionalisierten Widerstand oder zumindest Skepsis, im besten Fall auf Interesse, bis sie den Beweis der Machbarkeit angetreten, die für den «state of the art» zuständigen Kommissionen überzeugt und schrittweise kulturelle Akzeptanz erreicht haben. Zum Zeitpunkt der Normsetzung sind dann meist schon weitergehende Ansätze im Experimentierstadium oder in der «Nullserie».[7]
An den Bauschulen müssten spezielle Experimentierangebote geschaffen werden, um innovative Arbeit an Zukunftsproblemen zu ermöglichen. Diese Workshops dürften nicht Teil des «Bologna-Systems» sein, da dieses solche Aktivitäten tendenziell einspart.[8] Wer solche Workshops, Seminarien und Studios erfolgreich besucht, erhält ein «supplement», eine qualitative Auszeichnung, die Auskunft gibt über Thema, Inhalt, Ziele, Standort und Team sowie Leistung und Erkenntnisse des Innovationsworkshops. Hier ginge es nicht um Produkt-, sondern Methodikentwicklung, Wissensgenerierung und Denkschulung.
„Huge Scale - High Speed“
Da wir es in Zukunft sowohl mit grossmassstäblichen Problemfeldern als auch schnellen Reaktionszeiten auf Kultur- und Klimawandel zu tun haben werden (z.B. urbane Wachstumsund Schrumpfungsszenarien, globale Einflüsse regionaler Umweltereignisse, Transformation der Energiequellen), scheint es angezeigt, die methodischen Prozesse zur Wissensgenerierung und die planerischen Umsetzungsstrategien den Erfordernissen der Zeit anzupassen: 1. Denken und Handeln in zukunftsfähigen Szenarien, ähnlich dem früheren Übergang vom «Städtebau zur Stadtentwicklung»; 2. Anpassung der Baukultur an die Bedürfnisse der «Risikogesellschaft» und der neuen «patterns of life in motion»;[9,10] 3. Transkulturelles Lernen von regional wirkungsvollen Kulturtechniken bezüglich Referenzumwelten, Risiken und Gefahren (auch «man-made»), soziokulturellen und ökonomischen Potenzialen, ressourceneffizienter Werteschaffung usw.[11] Dank finanziellen, personellen und Know-how-Ressourcen kann die Schweiz mit ihren Bauschulen, Forschungsinstitutionen, Entwicklungsabteilungen von Industrieunternehmungen sowie mit neuartigen innovativen Denk- und Experimentierlabors zur Modellbildung beitragen – für eine Kultur der Nachhaltigkeit im weitestmöglichen Sinne.
Anmerkungen:
[01] Nicholas Stern: Der Global Deal. Wie wir dem Klimawandel begegnen und ein neues Zeitalter von Wachstum und Wohlstand schaffen. München 2009
[02] Bsp. 26, in: Drivers of Change. London 2006 (Hg. Chris Luebkeman, Director for Global Foresight & Innovation, mit Jennifer Greitschus, Arup London); 2., erweiterte Auflage, London 2008
[03] Vgl. dazu DETAIL Green, Nr. 1/2009
[04] Vgl. «Architektur im Klimawandel», in: archplus Nr. 184 v. Okt. 2007
[05] Vgl. «Ökologisch bauen», in: archithese Nr. 4/2004
[06] Vgl. «Natur inspiriert Technik», in: TEC21, Nr. 37-38/2009
[07] Ausnahmen bilden Institutionen privater oder öffentlicher Art, die grosszügig grundlegende und zukunftsweisende Forschungen und Experimente dank üppigen Fundraising-Geldern (falls sie nicht spekulativ angelegt werden…) fördern
[08] Vgl. Beitrag «Abschied von Faust? Studieren in Bologna-Zeiten» von Bernd Roeck, Professor an der Uni Zürich, in: NZZ v. 6.10.09, S. 21
[09] Vgl. Ulrich Beck: Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit. Frankfurt a. M. 2007
[10] Vgl. Naomi Klein: Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus. Frankfurt a. M. 2007
[11] Ulrich Pfammatter: In die Zukunft gebaut. Bautechnik- und Kulturgeschichte von der Industriellen Revolution bis heute / Building the Future. Building Technology and Cultural History from the Industrial Revolution until Today. Prestel Verlag München, Berlin, London, New York 2005/2008, Kap. 6
[12] Luscher Architectes SA, Lausanne, Airlight Ltd., Biasca, und Daniel Willi SA, Montreux (Ingenieure); vgl. TEC21 Nr. 26/2005, S. 4–7TEC21, Fr., 2009.11.20
20. November 2009 Ulrich Pfammatter
Vom Haus im Haus zur Stadt im Haus
Der Merker-Park in Baden von Zulauf & Schmidlin Architekten ist verdichtet und verwinkelt, verengt sich und dehnt sich aus wie eine mittelalterliche Stadt – gebändigt durch systematische Aneinanderreihung und Stapelung. Die Dichotomie erfasst den ganzen Bau bis hin zum Energiekonzept: Dieses erfüllt die Anforderungen an den Minergie-P-Standard beim Verbrauch, nicht aber bei der Hülle.
Der Wohnungsbau «Merker-Park» ist nach dem «Gelben Viereck» der zweite Baustein der Neuplanung auf dem Gelände der ehemaligen Fabrikationsanlagen der Firma Merker in Baden (siehe TEC21, 23/2009, «Baden gehen»). Auf der Rückseite des Gelben Vierecks erstreckt sich das Gelände, das einst die Hallen des Email-Werks besetzten. Weil sie denkmalpflegerisch nicht als schützenswert eingestuft wurden – diverse Umbauten hatten ihre Integrität beeinträchtigt, und auch die Bausubstanz erwies sich als schlecht –, stand ihrem Abbruch nichts entgegen.
Planerisch lagen Zulauf & Schmidlin Architekten zwei Grundlagen vor: Der Entwicklungsrichtplan «Baden Nord» von Diener & Diener und der Gestaltungsplan aus dem Jahr 2003. Von Seiten des Bauherrn, der Merker Liegenschaften AG, gab es ebenfalls zwei vordringliche Prämissen: Es sollte ein energetisch sinnvolles Gebäude entstehen mit Eigentumswohnungen unterschiedlicher Grösse, von denen keine preislich die Millionengrenze überschreiten durfte. Es sollten also sowohl Alleinstehende und Familien als auch Alte und Junge die eigenen vier Wände erwerben können. Die städtebauliche Situation schliesslich war wiederum durch zwei Hauptfaktoren charakterisiert: Das Grundstück liegt mitten in der Stadt und in komfortabler Fussgängerdistanz zum Bahnhof sowie einerseits in unmittelbarer Nähe zum Alten Friedhof an der Bruggerstrasse, einem Grün- und Naherholungsraum, andererseits angrenzend an die rückwärtige Wohnsiedlung von Burkhard Meyer Architekten.
Planerisch
Der Entwicklungsrichtplan etablierte quasi de jure jene faktische Grenze, welche die Hangkante bildet, zwischen der Baustruktur am Hang des Martinsberges und der Ebene entlang der Bruggerstrasse: Am Hang findet sich ein kleinteiliges städtebauliches Muster, in der Ebene dominiert die Grossform. Daran orientierten sich Zulauf & Schmidlin, propagierten städtisches, verdichtetes Wohnen, definierten den Merker-Park entsprechend als der Stadt zugehörig und planten ihn als Grossform. Was den Gestaltungsplan aus dem Jahr 2003 betrifft, so reduzierte die Bauherrschaft den Druck auf die Nutzung, die 9000 m² BGF erlaubt hätte, auf deren 7000 m². Dadurch konnten die Architekten das ursprüngliche Projekt mit 64 Wohnungen auf eines mit 45 redimensionieren.
Energetisch und ökonomisch
Zu Beginn der Planung stand fest, dass der Neubau mit möglichst wenig Energie auskommen sollte. Den Architekten schwebten die Kriterien der 2000-Watt-Gesellschaft vor. Nach den positiven Erfahrungen beim Gelben Viereck zogen sie auch für den Neubau die Waldhauser Haustechnik AG bei, die ein differenziertes Konzept erarbeitete (vgl. Kasten S. 49). Um die Energiesparmassnahmen nicht durch den Aufwand an grauer Energie zu neutralisieren, luden die Architekten fast ausschliesslich lokale Unternehmer – mit wenigen Ausnahmen aus dem Kanton Aargau – zur Submission. Wie beim Gelben Viereck die Mietzinse limitierte der Bauherr hier die Verkaufspreise, und zwar auf unter 1 Million Franken. Erreicht haben die Architekten Preise von 415 000 bis 895 000 Franken (möglich ist dies auch, weil das Land nur im Baurecht abgegeben wird).
Städtebaulich: Struktur
Der Entscheid für die Grossform mündete in einem einzigen, 27 m tiefen und 70 m langen Baukörper mit fünf oberirdischen Geschossen und einem Untergeschoss mit Einstellhalle – die Bahnhofsnähe war mit ein Grund für den Verzicht auf mehr als einen Parkplatz pro Wohnung. Mit dieser Konzentration spielten die Architekten einen ausgedehnten rückwärtigen Grünraum frei. Diesen Park mit dem angrenzenden Alten Friedhof an der Bruggerstrasse zu verweben, war die landschaftsgestalterische Option. Der 1821 im noch unverbauten Haselfeld als katholischer Friedhof angelegte, ab 1875 auch von der reformierten Kirche zur Bestattung genutzte Gottesacker wurde Anfang der 1950er-Jahre aufgegeben – nicht zuletzt, weil die umgebende Industrie die Abgeschiedenheit vermissen liess, deren solche Stätten bedürfen. Dennoch zeigt die Anlage noch fast den originalen Zustand. Das Verwunschene der einzelnen, teilweise halb zerfallenen Grabsteine und Skulpturen, die als Überreste von Grabbepflanzungen wuchernden Sträucher und der alte Baumbestand werden kontrastiert von den streng aufgereihten, kegelförmig geschnittenen Eiben. Der Friedhof hat sich denn zum Naherholungsraum gemausert und ist ein wichtiges Puzzlestück im Grünraum- und Naherholungskonzept der Stadt geworden.[1] Um den städtischen Grünraum nicht abreissen zu lassen, drängte sich die Verknüpfung des Merker-Parks mit dem Alten Friedhof denn auch geradezu auf.
Städtebaulich: Materialisiserung
Optisch wird der Bau zwischen der Siedlung von Burkhard Meyer Architekten und dem Gelben Viereck eingebettet. Der an Mergel erinnernde warme Ton des Kalksteinbetons vermittelt zwischen dieser und dem «Gelben Viereck». Ausserdem ermöglichte er dem Credo nachzuleben, den bewussten Umgang mit Energie nicht mit langen Transportwegen zu torpedieren, stammt der Beton doch aus dem aargauischen Kleindöttingen.
Architektonisch: strikt und variabel
Das architektonische Konzept besticht durch seine Einfachheit – erzielt mit spielerischer Strenge, mit komplexer Konsequenz. Das Paradox wird sich auflösen: Orientiert man sich an der vertikalen Entwicklung des Baukörpers, ist er aus 5 zusammengeschobenen Häusern mit je 9 Einheiten konzipiert. Zwischen diesen Häusern liegen vier nahezu quadratische Atrien (7 × 6 m), die für natürliche Belichtung sorgen. Sie gaben aber auch das Maximum der Höhe von fünf Geschossen vor. Die horizontale Gliederung weist drei Schichten auf: Die Wohnzimmer sind nach Süden, zu Merker-Park und Martinsberg orientiert, die Schlafzimmer liegen auf der Nordseite und bieten die Aussicht auf das Gelbe Viereck. Dazwischen schiebt sich die Erschliessungs-, Sanitär- und Technikschicht. Sie umfasst die Treppenhäuser und Lifte, die Atrien, die Nasszellen, die Technikräume sowie Entrées und Studios. Der verglasten Fassade sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite vorgelagert ist eine 70 cm tiefe Balkonschicht, vor die sich eine Haut aus perforierten Aluminiumfaltläden ziehen lässt, die auch bei den Atrien als Sicht- und Blendschutz dienen. Die Perforierung nimmt sich wie ein Morse-Code aus und balanciert zwischen optimalem Sichtschutz und maximaler Lichtdurchlässigkeit.
Das Erdgeschoss beherbergt fünf 2 ½-Zimmer-Wohnungen, das 1. bis 4. Geschoss je eine 6-, eine 5-, zwei 5 ½-, vier 4 ½- und zwei 3 ½-Zimmer-Wohnungen – insgesamt eben 45 Wohnungen. Trotz unterschiedlicher Anzahl der Zimmer sind einige Grössen konstant: Mit Ausnahme der 2 ½-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss sind Wohnen/Essen (36 m²), Küche (10 m²), Bad (9 m²) und Loggia (13 m²) sowie das Studio (14 m²) – ausser die an den Kopfenden liegenden 5- und 6-Zimmer-Wohnungen, die keinen Anschluss an ein Atrium haben – in allen Wohnungen gleich dimensioniert. Variabel gestalten liessen sich somit die Abmessungen der Gebäudeschicht auf der Nord-Ost-Seite, deren Gliederung in Schlafzimmer und mithin die Wohnungsgrössen. Bei grösserer Nachfrage nach 6-Zimmer- Wohnungen beispielsweise hätte eines der Schlafzimmer der 4 ½-Zimmer-Wohnung neben der 5-Zimmer-Randwohnung dieser zugeschlagen werden können. Im Modell präsentierte sich das Gebäude denn auch als ein Baukasten, dessen «Klötze» zu ganz unterschiedlichen Kombinationen gefügt werden konnten und erst mit den Ingenieurplänen definitiv komponiert werden mussten (Abb. 11). Gebändigt wird das Spiel durch das strikte Regime der Schottenbauweise, die bedingte, dass jeweils die gleichen Wohnungsgrössen übereinander zu liegen kamen, und eben die «Sturheit» des Kerns. Dessen ver steifende Funktion haben die Architekten kenntlich gemacht, indem sie Treppenhaus und Lifttüren mit einem anthrazitfarbenen Anstrich versahen.
Stadtstruktur
Die Aneinanderreihung von fünf Häusern machen den Bau zu einem Haus im Haus. Es ergibt sich eine Art Patchwork, ein Verweben der Räume sowohl in Nord-Süd- als auch in Ost-West- Richtung. Die Zimmer von jeweils verschiedenen Wohnungen, um ein gemeinsames Atrium gruppiert, und die spannungsreiche Abfolge der Zimmerfluchten innerhalb einer jeden Wohnung mit Verengungen und Ausdehnungen machen den Bau zu einer Stadt im Haus. (Dass eine der KäuferInnen das Bild vielleicht etwas arg wörtlich genommen und die Wände eines jeden Zimmers mit einem andern Farbton versehen liess, spricht nicht gegen die Konzeption.)
Sozial
Die nachbarliche Nähe ist gewissermassen eine «übereck» Geführte: Diejenigen Nachbarn, deren Wohnungen gleichsam Tür an Tür liegen, die sich also das Treppenhaus teilen und sich dort treffen, können einander nicht in die Wohnung sehen, weil sie kein gemeinsames Atrium haben. Umgekehrt begegnen sich die Bewohner, die über die Atrien visuellen Kontakt haben, nie im Treppenhaus.
Die Befürchtung, die Bauherrschaft könnte auf den Atriumwohnungen sitzenbleiben, weil sie den geringsten Sichtschutz gegenüber den Nachbarn bieten – im Gegensatz zu den Kopfwohnungen –, bewahrheitete sich nicht: Im Gegenteil, sie waren zuerst verkauft.
Analog zur Dichotomie auf der baulichen Ebene zwischen Verdichtung und «Entgrenzung»/ Auflockerung, zwischen Starrheit und Variabilität werden auch die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Schwebe gehalten zwischen Intimität und Anonymität. Letztere «entlädt» sich dann eher in Kollektivität, wenn auch die Wohnungen im Erdgeschoss keinen direkten Zugang zum Park haben. Sie sind künstlich angehoben und bilden eine Art Hochparterre. Gleichsam als Schwelle, auf der der private Raum überschritten und in den gemeinsamen Raum getreten wird, sind sie über Stufen mit dem Park verbunden.
Hier lässt sich das Spiel zwischen dicht und transparent ebenfalls – in einer Variation – verfolgen. Die Architekten haben das Erdgeschoss nicht «ausgewrungen». Zu den 2 ½-Zimmer- Wohnungen gesellen sich die Velounterstände, die von einem «Gatter» ummantelt werden, bestehend aus Holzstäben, die zu einer Ziehharmonika ähnlichen Struktur gefügt und mit einem anthrazitfarbenen Anstrich «entmaterialisiert» wurden.
Vielfalt in der Einheit
Auch im Innern haben die Architekten das Konzept der Variabilität innerhalb eines Rasters durchsetzen können. Erreicht haben sie dies, indem sie etwa einheitliche Schrank- und Raumtrennelemente entwarfen, dann aber die Wahl zwischen verschiedenen Schliessmechanismen bzw. verschiedenen Kombinationen (Regale, Schubladen etc.) liessen. Ebenso offerierten sie die Möglichkeit, die Räume gänzlich offen zu lassen, sie mittels Raumtrennelementen partiell oder mit konventionellen bzw. Schiebetüren ganz zu schliessen. Einheitlichkeit erzielten sie ausserdem mit der gemeinsam mit dem Küchenbauer erarbeiteten Küche mit Kochinsel, Sideboard und grosszügiger Schrankwand, die alle Eigentümer übernahmen. Obwohl Manche zum Teil durchaus ins Auge fallende Modifikationen angebracht haben, erweist sich die Ausstattung als derart robust, dass sie diese «schluckt», ohne ihre Integrität einzubüssen.
Mit Ausnahme der erwähnten Wohnung, in der alle Räume verschiedene Farben tragen, und einer anderen, in der Le Corbusiers Farbpalette Einzug hielt, dominieren der Weissputz der Wände und die roh belassenen oder lasierten Betondecken. Auch das vorgeschlagene geölte Eichenparkett schwang obenauf – wenn auch zuweilen in der dunkleren Tönung des geräucherten Holzes. Urständ feiert die Individualität nur in den Badezimmern, wo das von den Architekten bevorzugte graue Steinzeugmosaik sich leider nicht gerade als Renner erwies. Wichtiger für den äusseren Ausdruck des Baus werden aber die Vorhänge sein. Auch das haben die Architekten nicht dem Zufall überlassen und frühzeitig mit verschiedenen Pastelltönen (Steinweiss, Kartäusergelb, Lindengrün, Muskatblüte, Tabakbraun) am Modell experimentiert. Die Chancen stehen gut, dass sich die Eigentümer auf die von den Architekten vorgeschlagene Farbpalette einlassen. Wenn die Wohnungen dann gleichsam ihr Inneres nach aussen kehren, wird sich die Einheit des Farbenspektrums in der Vielfalt seiner Rhythmisierung auflösen.
Dicht und locker, repetitiv und spielerisch
In der durch repetitive Aneinanderreihung und Stapelung gebändigten Struktur des Merker- Parks verbirgt sich die Verdichtung einer mittelalterlichen Stadt mit engen, verwinkelten Gassen, die sich unvermittelt auf Plätze öffnen. Analog funktioniert die Transparenz: Die Monotonie der Verglasung wird gebrochen durch die Komplexität der Sichtbeziehungen innerhalb der Wohnungen und der «Häuser».
Anmerkung: [01] Quelle: www.baden.ch/documents/Alter_Friedhof.pdfTEC21, Fr., 2009.11.20
20. November 2009 Rahel Hartmann Schweizer