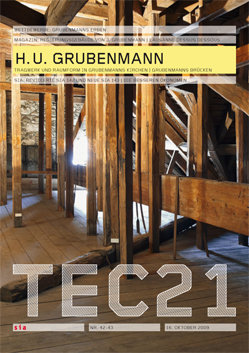Editorial
Entgegen einer verbreiteten Ansicht entwickelt sich Technik nicht als linearer Fortschritt. Die Geschichte ist voller Beispiele verloren gegangener Technik. Man braucht nicht das Ende des römischen Reichs oder anderer Hochkulturen zu bemühen, auch in unserer Moderne, einer Zeit also, die sich selbst seit der Aufklärung im Zeichen gesellschaftlichen und vor allem technischen Fortschritts sieht, ging technisches Know-how verloren. Ein Anlass, sich das vor Augen zu führen, ist das laufende Grubenmann-Jahr.
Der Zimmermann und Baumeister Hans Ulrich Grubenmann kam vor 300 Jahren, am 23. Juni 1709, im ausserhodischen Teufen zur Welt. Zusammen mit seinen Brüdern verbesserte Grubenmann die Brückenbautechnik. Er entwickelte die herkömmlichen Sprengwerke zu kombinierten Spreng-/Hängewerken weiter, was international rezipiert und in der Brückenbautheorie und der Reiseliteratur gefeiert wurde. Den Hauptbinder entwickelte er vom Stabpolygon zum Bogen weiter, und er dünnte die Konstruktionen aus, indem er aussteifende Verkleidungen baute. Seine Brücken hatten bis dahin unerreichte Spannweiten von bis zu 60 Metern, in Schaffhausen plante er gar eine 120 Meter lange Brücke ohne Pfeiler über den Rhein, doch die liess man ihn nicht bauen, weil man nicht glaubte, dass es möglich sei (vgl. S. 26ff.).
Das Wissen aus dem Brückenbau nutzten die Gebrüder Grubenmann für die Konstruktion grosser stützenfreier Räume, vor allem in Kirchen. Sie traten als Totalunternehmer auf, brachten die Facharbeiter mit und bauten eine Dorfkirche innert weniger Monate. Die Kirchen und Profanbauten H. U. Grubenmanns zeichnen sich durch einen geschickten Umgang mit verschiedenen Raumkonzepten aus und durch innovative Tragwerke, dank denen neue Raumformen möglich wurden. In seinem architektonischen Meisterwerk, der 1764–67 errichteten reformierten Kirche Wädenswil, ermöglicht die in den schwebenden Emporen und in der Rokoko-Stuckdecke verborgene Konstruktion einmalige Raumverschränkungen und Lichtführungen (vgl. S. 18ff.).
Im Revolutionskrieg von 1799 verbrannten fast alle von Grubenmanns Brücken. Beim Wiederaufbau erstellte man wieder Jochbrücken mit kurzen Spannweiten, vielen Pfeilern und einfachen Hängewerken – ein technologischer Rückschritt. Eine Briefmarke der Schweizer Post erinnert im Jubiläumsjahr an den ausserordentlichen Zimmermann und Baumeister Hans Ulrich Grubenmann und die vorübergehende Blüte des Schweizer Holzbrückenbaus im 18. Jahrhundert. Die Grubenmann-Sammlung in Teufen, die Originalmodelle und -pläne besitzt, plant den Umzug ins renovierte Zeughaus Teufen (vgl. TEC21 14-15/2009, S. 8–9) und den Ausbau zu einem Zentrum für Baukultur.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Grubenmanns Erben
11 MAGAZIN
Regierungsgebäude von J. Grubenmann | Lausanne dessus dessous | Sinn und Sinnlichkeit
18 TRAGWERK UND RAUMFORM IN GRUBENMANNS KIRCHEN
Reto Gadola
Der vor 300 Jahren geborene Hans Ulrich Grubenmann baute neben berühmten Brücken auch viele Kirchen. Mit dem Wissen aus dem Brückenbau schufen der Zimmermann und seine Brüder neue Raumformen.
26 GRUBENMANNS BRÜCKEN
Andreas Müller, Hanspeter Kolb
Im 18. Jahrhundert stand der Schweizer Holzbrückenbau in seiner Blüte. Hans Ulrich Grubenmanns Brücken zogen ein internationales Fachpublikum an. Fast alle brannten im zweiten Koalitionskrieg von 1799 nieder und wurden danach durch einfachere Konstruktionen ersetzt.
34 SIA
Revidierte SIA 142 und neue SIA 143 | Die besseren Ökonomen | Wirtschaft entdeckt grüne Energie | Sanierung unter Betrieb
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Tragwerk und Raumform in Grubenmanns Kirchen
Zwischen 1723 und 1780 bauten die Gebrüder Grubenmann in der Ostschweiz zahlreiche Brücken und Kirchen. Der einflussreichste von ihnen war Hans Ulrich Grubenmann, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum dreihundertsten Mal jährt. In ihren Kirchenbauten nutzten die Zimmermänner aus Teufen AR ihr Wissen aus dem Brückenbau. Ihre im Kirchenhimmel verborgenen innovativen Dachstuhlkonstruktionen ermöglichten grosse stützenfreie Räume. Besonders eindrücklich ist die Wechselwirkung von Tragwerk und Raumform in der reformierten Kirche Wädenswil.
Zwischen 1723 und 1780 bauten die Brüder Jakob (1694–1758), Johannes (1707–1771) und der berühmteste der drei, Hans Ulrich Grubenmann (1709–1783), neben zahlreichen Brücken auch 27 Kirchen in der Ostschweiz.[1] Gemeinsamer Nenner dieser scheinbar gegensätzlichen Bauaufgaben ist ihre strukturelle Verwandtschaft. Im Brücken- wie im Kirchenbau geht es darum, möglichst effizient grosse Spannweiten zu überbrücken. Eine wissenschaftlich begründete Tragwerkslehre im heutigen Sinn gab es zu Zeiten der Gebrüder Grubenmann noch nicht, exakte Berechnungen waren nicht möglich. Ihre Konzepte, Projekte und Realisationen beruhten auf der Wechselwirkung von Erfahrung und Ausprobieren, also einer Art «handwerklicher Intelligenz», die sich von Bau zu Bau perfektionieren liess. Erstaunlich ist, wie es den Grubenmanns damit gelang, in ihren grossmassstäblichen Bauten so schwer abzuschätzende Faktoren wie Winddruck, Aussteifung des Systems oder konstruktiver Witterungsschutz zu einem kohärenten Ganzen zu vereinigen. Ähnlich wie die genialen Empiriker Antonio Gaudì (1852–1926) oder Heinz Isler (1926–2009) testeten die Grubenmanns ihre Ideen an massstäblichen Modellen, mit denen sich der Kräftefluss und die räumlichen Verbindungen untersuchen liessen – und die zugleich ein anschauliches Kommunikationsmedium waren.
Ihre technisch-konstruktive Souveränität setzten die Grubenmanns sehr bald in Form einer Alles-aus-einer-Hand-Philosophie um. Gegenüber Auftraggebern traten sie als eigentliche Totalunternehmer auf.[2] Neben der Planung und der Koordination der Bauarbeiten brachten sie auch gleich alle Handwerker mit. Für den Bau einer mittelgrossen Kirche brauchten die Grubenmanns mit ihren Trupps von Maurern und Steinmetzen, Zimmerleuten, Gipsern und Stuckateuren, Dachdeckern usw. nur acht bis zehn Monate. Meist stellten die Kirchgemeinden das Baumaterial zur Verfügung, und Hundertschaften von Männern und Pferden leisteten Fronarbeit, um das Budget zu entlasten. Nach getaner Arbeit gab es ein grosses Fest. Von der Kirchweihe in Wädenswil am 23. August 1767 wird berichtet: «Über vierzig Schiffe legten in Wädenswil an. Es sollen zu diesem Anlasse 12 Stück Vieh, 117 Schafe, 6 Kälber und 8 Schweine geschlachtet worden sein.»[3]
Kirchenhimmel konstruieren Eine Grubenmann-Kirche fällt nicht durch ihr Äusseres auf: einfache Volumen, schlichte Gestaltung, Schutz bietende, grosse Dachflächen – einzig ein vielleicht gar spitzer und hoher Turm lässt die waghalsige innere Struktur erahnen. Auch die Gestalt des Kirchenraums ist konventionell und entspricht dem Wunsch bzw. der Konfession der Auftraggeber: üppiger Barock wie im katholischen St. Gallenkappel (1751) oder protestantische Nüchternheit wie in Oberrieden (1761), wo nur eine flüchtig wirkende Dekorationsschicht mit Stuck-Rocaillen dem schlichten Raum eine gewisse «Oberflächenspannung» verleiht.[4]
Die eigentliche Schönheit der Grubenmann-Kirchen liegt jedoch im Innenleben, das dem wahrnehmenden Auge verborgen bleibt: im kühnen Tragwerk des Dachstuhls, das auf der strukturellen Logik der Brückenbauten gründet, oder in der atemberaubenden handwerklichen Präzision, mit der die Holzverbindungen konzipiert und ausgeführt sind.
Mitte des 18. Jahrhunderts war es in der Ostschweiz Mode, einfache, langrechteckige Kirchenräume mit einem gewölbten Kirchenhimmel abzuschliessen. In den meisten Fällen sind auch die Grubenmann-Kirchen durch hohe, flache Wandscheiben gefasst. Im Vergleich zum gotischen Prinzip der Strebepfeiler und deren dominanter Ästhetik handelt es sich um ein modern anmutendes, ausgemagertes konstruktives Dispositiv. Um solche Gebäudevolumen zu schliessen, gab es alledings kaum Alternativen zu einem hölzernen Dachstuhl. Eine gewölbte Decke – paradigmatischer Ausdruck des Bauens mit Stein – provozierte wegen der horizontalen Krafteinwirkung auf die dünnen Wände einen konstruktiven Widerspruch. Er liess sich allenfalls durch Zugstangen auflösen, die die Horizontalkräfte kurzschliessen, doch derartige Elemente störten auch damals das ästhetische Empfinden.
Grössere Spannweiten Um grosse Kirchenräume ohne störende Zugstangen zu überbrücken, entwickelten die Grubenmanns verschiedene Dispositive.[5] Zum einen sind es liegende Dachstühle mit Strebebindern und Hängesäulen, an denen die Decke des Kirchenraums aufgehängt ist, wie etwa in der Kirche Hombrechtikon von 1758 (Abb. 7). Liegende Dachstühle finden sich auch in Gossau SG (1732), St. Gallenkappel (1751), Eschenbach (1753), Hombrechtikon (1758), Mollis (1761) und Trogen (1780). Im Gegensatz zu diesem handwerklich zwar perfekten und in ihren Dimensionen beeindruckenden, aber konventionellen Prinzip überrascht der Dachstuhl der Kirche in Grub AR (1752) mit einer unkonventionellen Konstruktion (Abb. 4–6). Die Primärstruktur liegt nicht in Quer-, sondern in Längsrichtung: Wie bei einer Brücke liegen zwischen Innengewölbe und Dachfirst zwei gewaltige, nach unten gespreizte Stabbogenträger. Bemerkenswert auch die formale Logik des mehrfach geknickten, kassettierten Gewölbes: Es schmiegt sich exakt an die darüberliegenden Streben, Spannriegel und Kehlbalken an. Ein solcher Firstträger in Längsrichtung kam auch in Brunnadern SG (1763) zur Anwendung. Einen dritten Lösungsansatz mit diagonal verstrebten, eng liegenden Bindern in Querrichtung entwickelten und perfektionierten die Grubenmanns in zahlreichen Beispielen, unter anderem auch in Oberrieden. Bei diesem Prinzip sind die beiden Dachflächen im First gewissermassen biegesteif miteinander verbunden und nehmen so den Dachschub auf.
An diesem verschränkten Stabwerk ist von unten eine Holzlattung befestigt, die zum Gewölbe geformt und vergipst ist und nach Bedarf mit Stuckaturen verziert werden kann. Zusammen mit den ebenfalls vergipsten Wänden entsteht so eine innere Raumhülle, die homogen über massive Wände wie über filigrane Holzstrukturen gelegt wird. Dachstühle mit diagonal verschränkten Streben finden sich unter anderem in den Kirchen von Neukirch TG (1727), Häggenschwyl SG (1728), Eggersriet SG (1738), Steinach SG (1742), Stein AR (1749), Sulgen TG (1751), Oberrieden ZH (1761) und Ebnat SG (1762).
Verborgene Schönheit - Strukturelles „Poché“ Das Meisterwerk unter den Grubenmann-Kirchen ist die reformierte Kirche von Wädenswil (1764–1767). Ein riesiger, stützenfreier, weisser Kirchenraum von 18 m Breite und 35 m Länge ist von 12 m hohen Wänden gefasst, die über eine sanfte Rundung nahtlos mit der flachen Decke verschliffen sind. Die Wände sind von drei bzw. fünf Fensterpaaren durchbrochen: Über einer hohen stehenden Öffnung ist jeweils eine ovale angeordnet, die die Deckenrundung durchstösst und den Übergang von Wand zu Decke in einen Spannungszustand versetzt.
Typologisch stellt die Wädenswiler Kirche einen ersten Höhepunkt des Querraumprinzips dar, das in der protestantischen Zürcher Landschaft zu jener Zeit aufkam.[6] Das Layout beruht auf Vorgaben und Plänen des Untervogts Hans Caspar Blattmann und des Wädenswiler Pfarrers Johann Heinrich Hofmeister.[7] Der kirchliche Versammlungsraum ist in einem breiten Rechteck organisiert und vollkommen auf die Kanzel in der Mitte der Längswand – also auf die Predigt – ausgerichtet. Steile Emporen an der gegenüberliegenden Längswand und an beiden Querwänden verdoppeln nahezu das Fassungsvermögen der Kirche. Im geometrischen Mittelpunkt steht das Taufbecken.
Ein kühnes Brückenbauwerk überspannt den Kirchenraum: In Längs- und in Querrichtung kreuzen sich zwei 6.50 m hohe Hauptbinder, die als Stabpolygon ausgebildet sind und durch komplex geformte Grat-, Kehl- und Zwischenbinder ergänzt werden (Abb. 11–17). Erstaunlich ist, mit welcher konzeptuellen, konstruktiven und handwerklichen Intelligenz die naturgegebenen Dimensionen von Schnittholz überwunden werden. Den Kirchgängerinnen und Kirchgängern jedoch präsentiert sich der Kirchenhimmel als abstrakte, weiss getünchte Form mit applizierten Verzierungen. Sein Innenleben bleibt verborgen – im ausgehenden 18. Jahrhundert galt kühne Technik noch nicht als schön. Legt man den Fokus allerdings auf das Verhältnis zwischen dem inneren Kirchenraum und der äusseren Form der Kirche – also auf den dazwischen aufgespannten Raum –, wird deutlich, dass der Dachstuhl als eine Art strukturell motiviertes «Poché»[8] gelesen werden kann.
Doch nicht alle Schönheit bleibt dem unsichtbaren Himmel vorbehalten. Bei den Emporen entfalten die strukturellen Phänomene magische plastische Qualitäten, die ihresgleichen suchen. Die Emporen sind stützenfrei von Wand zu Wand gespannt. Ein in die Brüstung integriertes Sprengwerk bildet den vorderen Abschluss. Der geneigte Emporenboden besteht aus einer mittig über Streben gestützten Balkenlage und einem Stabbogensystem, das über eine Scheibenwirkung den schrägen Schub statt in den Brüstungsträger in die seitlichen Wände leitet.[9] Auch dieses geniale Dispositiv findet nur über formale Umwege den Weg an die Oberfläche: Der Brüstungsträger ist vergipst, und auch die Emporenuntersicht ist mit elegantem Schwung verkleidet – erst die detaillierte Analyse offenbart, dass auch dieser Schwung, ähnlich wie bei den erwähnten Kirchengewölben, in engem Verhältnis zur dahinter verborgenen Struktur steht. Die Verbindung der Emporen in den Ecken, ihre gewölbten Untersichten und die formalen Spannungen bei den Fenstern – deren Anordnung eigenen Gesetzmässigkeiten gehorchen muss – lassen expressive Formen von einzigartiger Plastizität entstehen.TEC21, Fr., 2009.10.16
Anmerkungen:
[1] Eine umfassende Darstellung liefert Josef Killer: Die Werke der Baumeister Grubenmann – Eine baugeschichtliche und bautechnische Forschungsarbeit, Zürich 1942 (PDF auf http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:20590)
[2] Albert Knoepfli: Die Grubenmann – Welt zwischen Handwerk, Unternehmertum und Baukunst, in: Schweizerischer Ingenieur und Architekt 25/1983, S. 677–683
[3] Wie Anm. 1, S. 139
[4] Die Stuckaturen in Oberrieden von Anton Moosbrugger waren ursprünglich lachsfarben vom weissen Grund abgesetzt. Nach wenigen Jahrzehnten wurden sie weiss übermalt. Bei der derzeitigen Restaurierung wird diese seit 200 Jahren «modern» anmutende Raumwirkung zugunsten einer dem Original verpflichteten Präzision in den süsslichen Urzustand zurückversetzt.
[5] Überblick in: Josef Killer: Zum 250. Geburtstag von Hans Ulrich Grubenmann, in: Schweizerische Bauzeitung, 4. Juni 1959, S. 361–363
[6] Die Querkirchen der Zürcher Landschaft bestechen durch ihre fast schon funktionalistische Umsetzung von Inhalt (gesprochenes Wort) in Form (Querraum mit Blick auf die Kanzel von allen Plätzen). Verständlicherweise übte das grosse Anziehungskraft auf die Protagonisten der Moderne aus und beeinflusste den Kirchenbau nach 1945. Vgl. E. Stockmeyer: Das Querraumprinzip in den Zürcher Landkirchen um 1800, in: Werk 2/1943, S. 61–64; Otto H. Senn: Protestantischer Kirchenbau – Besinnung auf die Grundlagen, in: Werk 2/1952, S. 33–40; Otto H. Senn: Evangelischer Kirchenbau im ökumenischen Kontext, Basel 1983
[7] Ein erster Vorschlag von Hans Ulrich Grubenmann war als zu traditionell abgelehnt worden
[8] Das französische «Poché» bezeichnet ursprünglich die plangrafische Schraffur von Bauteilen, also das, was zwischen Innen- und Aussenform übrigbleibt. Der Verfasser hat anhand der Wohnhäuser der Architektin Lux Guyer das Verhältnis von innerer Raumform und struktureller Logik des Schrägdachs als eine Art modernistisches «Poché» gedeutet. Vgl. Reto Gadola: Raumfiguren, in: Lux Guyer (1894–1955) – Architektin, Zürich 2009, S. 68–70. Zum Begriff «Poché» auch: Jacques Lucan: Généalogie du poché, in: matières, no. 7/2004, S. 41–54
[9] Zur «Beruhigung der ängstlichen Gemüter» brachte Grubenmann an den Drittelspunkten schalkhaft Kapitelle an, denen allerdings die Säulen fehlen (wie Anm. 1, S. 131)
16. Oktober 2009 Reto Gadola
Grubenmanns Brücken
Schweizer Holzbrücken trugen im 18. Jahrhundert zur Weiterentwicklung des Brückenbaus bei. Die damals neuen Spreng- und Hängewerke erreichten grössere Spannweiten als die Jochbrücken, die bis dahin (und später erneut) gebaut wurden. Die Zimmererdynastie Grubenmann aus Teufen trug zur Blüte und zum internationalen Ruf des Schweizer Brückenbaus bei, allen voran Hans Ulrich Grubenmann.
Hans Ulrich Grubenmann wurde am 23. März 1709 in Teufen AR als jüngster Sohn von Ulrich Grubenmann geboren. Er wuchs in einer Umgebung auf, die von Zimmermannstradition geprägt war. Fast alle seine männlichen Verwandten und Bezugspersonen waren Bau- oder Zimmermeister. Nach kurzem Schulbesuch lernte er das Handwerk seiner Vorfahren und Brüder. Nebst einer gründlichen beruflichen und handwerklichen Ausbildung in familiärer Umgebung müssen dem jungen Grubenmann wohl auch eine grosse Begabung, viel Gefühl für statische Zusammenhänge und ein ausgeprägtes Selbstvertrauen mitgegeben worden sein. In der damaligen Zeit gab es kaum Möglichkeiten, sich theoretisches Wissen anzueignen. Entsprechende Ausbildungsstätten oder Fachbücher waren nicht vorhanden. Der Weg zur Meisterschaft führte über Learning by Doing und das Lernen aus den Bauten und Erfahrungen anderer. Offensichtlich war Grubenmann ein Mensch, der dies gut konnte. Er war äusserst kreativ und hatte den Mut, an Grenzen zu gehen oder diese auch zu überschreiten. Wie viel er durch Ausprobieren herausfand und lernte, ist heute schwer zu sagen. Tatsache ist, dass es damals üblich, ja obligatorisch war, von den zu bauenden Brücken ein massstäbliches Modell zu bauen. Von Grubenmann wird die berühmte Anekdote erzählt, dass er sich selbst auf das Modell seiner Rheinbrücke in Schaffhausen stellte, um die Ratsherren von der Tragfähigkeit seines Entwurfs zu überzeugen. Hans Ulrich Grubenmann war schon zu Lebzeiten legendär, aber nicht unumstritten. Was Konkurrenten über ihn dachten, ist nicht dokumentiert. Seine Auftraggeber trauten ihm jedenfalls nicht vorbehaltlos.
So stiess sein Entwurf für eine freitragende Brücke über den Rhein bei Schaffhausen mit damals sagenhaften 119 m Spannweite auf erbitterten Widerstand. Da half auch die erwähnte Demonstration nichts. Grubenmann erhielt zwar den Auftrag, wurde jedoch verpflichtet, den von der Vorgängerbrücke stehen gebliebenen Mittelpfeiler zu benutzen (Abb. 1–3). Wie weit sich Grubenmann an diese Auflage hielt, war lange umstritten. Dass er bei der Eröffnung der Brücke mit dem Ausspruch «Da habt ihr euren Pfeiler, aber ich habe meine Brücke» die Keile unter dem Auflager weggeschlagen haben soll, gehört wohl ins Reich der Legenden. Zahlreiche Reisende und Gelehrte der damaligen Zeit kamen nicht umhin, die gewaltige und doch elegante Brücke zu bestaunen und den «einfachen Zimmermeister» als Genie zu rühmen. Das wohl aussergewöhnlichste Werk Grubenmanns traf jedoch das gleiche Schicksal wie acht andere seiner Brücken: Die französischen Truppen zerstörten es 1799 im Krieg gegen Österreich, um ihren Rückzug zu sichern. So existieren heute nur noch zwei Brücken von Hans Ulrich Grubenmann, die Kubelbrücke und die Tobelbrücke über die Urnäsch in der Nähe von Herisau AR.
Konstruktion und Tragwerke Spreng- und Hängewerkbrücken wurden im 18. Jahrhundert auch «Schweizer Sprengwerkbrücken » genannt. Werner Blaser beschreibt sie so: «Mehrfache Streben-Spannriegelzüge vereinten sich zu stabilen Tragwerken mit hohen Steifigkeiten, in denen sich die Kräfte gleichmässig verteilten.»[1] Hans Ulrich Grubenmann hat diesen Brückentyp durch seine Konstruktionen wie kaum ein anderer beeinflusst und damit wesentlich zum internationalen Ruf der Schweizer Holzbrücken beigetragen. Heute sind elf von ihm entworfene Brücken bekannt. Sie haben Spannweiten zwischen 29 und 61 m. Vorbilder mit grossen Spannweiten gab es nur wenige, da bis dahin fast nur Jochbrücken gebaut wurden wie zum Beispiel die Kappelbrücke in Luzern von 1365.
Als junger Zimmerer konnte Grubenmann sicher von der Martinsbrücke mit 30 m Spannweite profitieren, die Zimmermeister Falk 1468 bei St. Gallen über die Goldach baute.[2] Sie war eine der ersten weitgespannten Holzbrücken und laut Josef Killer die erste Spreng- und Hängewerkbrücke überhaupt.[3] Die Brücke mit der grössten Spannweite aus der Zeit vor Grubenmann dürfte die Limmatbrücke beim Landvogteischloss Baden von 1650 mit einer Spannweite von 38 m sein. Grubenmann baute seine erste Brücke mit 33 Jahren 1743 über die Linth bei Ziegelbrücke GL (Abb. 6). Von der Konstruktionsart und der Spannweite ist wenig bekannt. Auf Bildern ist zu erkennen, dass sie durch einen Mittelpfeiler im Fluss unterstützt war. In überlieferten Texten ist aber auch die Rede davon, dass die Bauherren die Limmatbrücke in Baden AG als Wunschvorstellung genannt haben könnten. Grubenmanns bekannteste Brücke ist die von 1755 bis 1758 gebaute Rheinbrücke in Schaffhausen. Der in verschiedenen Abhandlungen detailliert dargestellte Bau besteht aus zwei Spreng- bzw. Hängewerken, die 52 und 59 m weit von den Widerlagern zum Mittelpfeiler spannen (Abb. 2–3). Dieser stammt von der steinernen Vorgängerbrücke. Zusätzlich hat Grubenmann ein drittes Sprengwerk über die gesamte Länge eingebaut – vermutlich ein Relikt aus seinem ursprünglichen Entwurf, der eine 119 m weit gespannte Brücke ohne Pfeiler vorsah (Abb. 5). Auch später wurden trotz weiterentwickelten Techniken und Möglichkeiten in der statischen Nachweisführung keine solchen Spannweiten mehr gebaut.
Grubenmanns Kühnheit wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass es eine seiner ersten grossen Brücken war. Sogar der Verdacht der Selbstüberschätzung ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Unter diesem Gesichtspunkt kann man die Schaffhauser Ratsherren gut verstehen, die den Mittelpfeiler forderten. Durch diesen Befehl ergab sich ein Knick im Grundriss über dem Auflager. Damit war die Brücke auch tatsächlich auf den Pfeiler angewiesen, denn durch den Knick wären sonst hohe Umlenkkräfte in Querrichtung der Brücke entstanden. Gut sind im Modell die trägerrostförmigen Dia gonalfachwerke sowohl in der Gehbahnebene als auch in der Dachverbandsebene zu erkennen (Abb. 4). Gut ausgebildete und leistungsfähige Windverbände und eine sehr gute Queraussteifung der Gesamtkonstruktion zeichnen alle Brücken Grubenmanns aus.
Vom Stabpolygon zum Bogen Bei seiner 1764/65 erstellten Brücke über die Linth bei Ennenda GL verwendete Grubenmann ein dreiteiliges Trapezhängewerk über acht Felder (Abb. 7). Dieses verstärkte er durch ein einfaches (Dreieck-)Hängewerk in der Mittelachse und angrenzende Trapezhängewerke über die drei verbleibenden Endfelder. Mit diesen zusätzlichen Tragsystemen wurden die Lasten der Gehbahn in jeder Achse aufgenommen und in das Haupttragwerk eingeleitet. In beiden Endfeldern wurde die Gehbahn noch mit weiteren Streben nach unten gegen die Widerlager abgestützt.
Um grössere Spannweiten zu erreichen, entwickelten die Baumeister Grubenmann das Stabpolygon zum leistungsfähigeren Bogen weiter. Beispielhaft dafür ist die Limmatbrücke beim Kloster Wettingen (1765–1766) mit 61 m Spannweite (Abb. 8). Grubenmann konstruierte sie als Bogenbrücke mit Hängesäulen in Kombination mit Abstrebungen der Gehbahn gegen das Widerlager an den ¼-Punkten. Den Bogen setzte er aus sieben übereinander gelegten, sehr gut verzahnten und verschraubten Balken zusammen. Es wird vermutet, dass die Ende des 15. Jahrhunderts erbaute Holzbrücke über die Sitter ihm als Vorbild für diese Konstruktionsart diente. Dort waren erstmals zusammengesetzte, gebogene Bauteile verwendet worden. Josef Killer lobt die von Grubenmann veredelte Konstruktion für ihre hohe Steifigkeit: «Zeichnung und Modell zeigen deutlich, dass die Verzahnung und Verschraubung so gut ausgeführt wurden, dass fast mit dem vollen Trägheitsmoment gerechnet werden konnte.»[4] Laut Blaser verwendete er dazu mechanisch gebogene Kanthölzer.[5] Diese Bauweise wurde später bis zu den heute bekannten Bogenkonstruktionen aus Brettschichtholz weiterentwickelt. Bei der Linthbrücke Netstal (1766–1768) verwendete Grubenmann erneut ein polygonzugartiges Hängewerk mit jeweils in den Achsen abgeknickten Streben (Abb. 9–10). Nur in den mittleren drei Feldern, wo der bogenartige Polygonzug sehr flach verläuft, wird die Tragstruktur durch Streben etwas versteift.
Wer heute auf den Spuren Hans Ulrich Grubenmanns wandeln will, kann dies auf den beiden noch verbliebenen Brücken bei Herisau tun (Abb. 11–13). Die 29 m weit gespannte Urnäschbrücke von 1778 zwischen Hundwil und Herisau hat Grubenmann mit einem zweiteiligen Stabpolygon über fünf Felder konstruiert. Die im Vergleich zu seinen andern Brücken stark ausgedünnte Konstruktion wird durch die mit eingezogenen Diagonalen verstärkte Schalung versteift. Man kann den auch hier sehr sorgfältig ausgebildeten gekreuzten Windverband in der Gehbahnebene gut erkennen. Die 30 m weit gespannte Kubelbrücke über die Urnäsch zwischen Stein und Herisau von 1780 ist fast baugleich. Auch hier wird die Haupttragkonstruktion mit einem zweiteiligen Stabpolygon über fünf Felder durch die mit eingezogenen Diagonalen verstärkten Schalung versteift. Nachdem die französischen Truppen 1799 die meisten der berühmten weitgespannten Holzbrücken des 18. Jahrhunderts zerstört hatten, wurden ab 1800 wieder eher Jochbrücken mit kürzeren Spannweiten oder Kombinationen von Joch- und Spreng- bzw. Hängewerken erstellt. Ein Beispiel ist die 1804 gebaute Brücke über die Aare bei Wangen BE, die heute als Geh- und Radweg genutzt wird (Abb. 14). Hans Ulrich Grubenmann musste das Ende seiner Bauwerke nicht mehr miterleben; er starb 1783.
Brückenschlag in die Gegenwart Grubenmann war Zimmermeister und kein Ingenieur. So hat er für die Bemessung seiner Bauten sicher keine statischen Berechnungen durchgeführt. Das war zur damaligen Zeit eine normale Vorgehensweise. Die Wahl der Querschnitte und die Dimensionierung basierten auf seinen Erfahrungen. Er beobachtete seine gebauten Brücken in der späteren Nutzung sehr genau, um Schwachstellen zu identifizieren und um seine Konstruktionen weiterzuentwickeln. Dass einige seiner Brücken «singende Brücken» genannt wurden, deutet darauf hin, dass einzelne Bauteile bis an ihre Grenzen belastet waren und die Tragstruktur durch Lastumlagerung räumlich beansprucht wurde. Natürlich ging dies mit grossen Verformungen einher, dennoch waren Grubenmanns Konstruktionen durch die aussergewöhnlich guten Queraussteifungen sehr robust.
Was würde wohl heute aus einem Talent wie Hans Ulrich Grubenmann? Er könnte sich an einer Hochschule ein grosses theoretisches Wissen aneignen, seine praktische Begabung und sein statisches Gefühl aber vielleicht nicht in dem Mass entwickeln, wie es zu seiner Zeit möglich war. Damals wurde konstruiert und kaum gerechnet. Grubenmanns Kreativität und sein Mut, an Grenzen zu gehen und diese gar zu überschreiten, brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure aber auch heute, wenn sie bei den heutigen Normen und Vorgaben aussergewöhnliche Bauwerke schaffen wollen.TEC21, Fr., 2009.10.16
Anmerkungen:
[1] Werner Blaser, Othmar Birkner: Schweizer Holzbrücken. Birkhäuser, Basel 1982
[2] Eugen Steinmann: Hans Ulrich Grubenmann. Niggli, Niederteufen und Schläpfer, Herisau 1984
[3] Josef Killer: Die Werke der Baumeister Grubenmann – Eine baugeschichtliche und bautechnische Forschungsarbeit, Zürich 1942 (PDF auf http:// e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:20590)
[4] ebd.
[5] wie Anm. 1
Weitere Literatur:
Josef Killer: Die Werke der Baumeister Grubenmann. 3. Auflage. Birkhäuser, Basel 1985
Rosemarie Nüesch-Gautschi: Baumeister Hans-Ulrich Grubenmann von Teufen, Teufener Hefte 4, Tschudi, Druck u. Verlag, Glarus 1985
Christian von Mechel: Plan, Durchschnitt und Aufriss der drey merkwürdigsten hölzernen Brücken der Schweiz. Basel 1803
16. Oktober 2009 Andreas Müller, Hanspeter Kolb