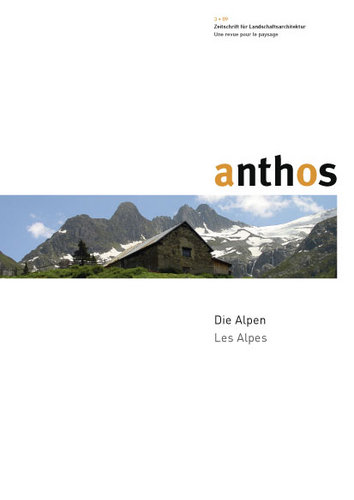Editorial
Das Eröffnungsbild in diesem anthos (S. 5) zeigt es: Die Alpen sind ein Mythos, ein Symbolraum. Sie sind Teil der beworbenen «Marke Schweiz» – und mit ihnen kann man auch für allerlei anderes werben. Für die Bewohner der Schweiz sind sie identitätsstiftend. Selbst die grösste Schweizer Stadt, Zürich, sich durch und durch urban gebend, sonnt sich im Lichte der Alpen, und zur emotionalen Erhöhung auch gleich noch in den falschen.
Doch die Schweizer Alpen – Teil des 1200 Kilometer langen Alpenbogens in der Mitte einer der stärksten europäischen Wirtschaftsregionen – sind natürlich auch Realität, Lebens- und Handlungsraum. Und erschreckend real sind ihre Probleme: in den überlasteten Intensivregionen, geprägt vom Massentourismus mit ausgedehnten Infrastrukturen und Angeboten und mit einer hohen kommerziellen Wertschöpfung – sowie in den Entleerungsregionen mit einem flächendeckenden Rückzug von Landwirtschaft und Gewerbe, ohne eine vordergründige kommerzielle Wertschöpfung, aber mit grossen und unersetzlichen natürlichen und kulturellen Werten. Und alle zusammen sehen unter dem Damoklesschwert der Klimaveränderung, die die Alpen besonders hart treffen wird, einer ungewissen Zukunft entgegen.
anthos befasst sich seit langem mit Problemen und Lösungswegen in den Alpen, so auch in diesem Heft. Eine kontrovers geführte Diskussion dreht sich zurzeit um den Bau von grossen, komplexen Ferienresorts, von denen etwa 50 in der Schweiz geplant sind. Sind diese der wirtschaftliche Rettungsanker, wie ihre Protagonisten sagen – oder sind sie nur ein weiterer Schritt der Zerstörung landschaftlicher, kultureller und sozialer, vielleicht sogar ökonomischer Werte? Andererseits entstehen im Rahmen der neuen Parkpolitik des Bundes regionale Naturpärke in den Alpen, vielleicht sogar einige Nationalpärke. Was bewirken diese, und halten sie, was sie versprechen?
Mit vielen baulichen und landschaftsplanerischen Massnahmen zur Stärkung der traditionellen Wirtschaft, der naturnahen Erholung, zum immer notwendiger werdenden Hochwasserschutz, zum Klima- und Ressourcenschutz oder zur grossräumigen, länderübergreifenden ökologischen Vernetzung wird versucht, dem negativen Trend in den sich konträr entwickelnden alpinen Problemregionen entgegenzuwirken. anthos stellt Beispiele von Programmen, Konzepten und Einzelmassnahmen vor.
Bernd Schubert