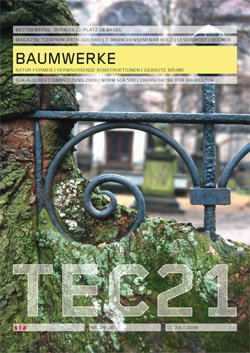Editorial
Jean Perréal malte 1516 die Miniatur «La complainte de Nature à l’alchimiste errant»1 zur Illustration eines eigenen Gedichtes – interessant ist dabei ein besonderer «Stuhl»: Die Äste eines im Boden verwurzelten, anscheinend noch lebendigen Baumes sind so verformt und miteinander verwachsen, dass der Baum zu einem Möbel wird. Ob Perréal damals wirklich einen ähnlich verwachsenen Baum gesehen hat oder ob es eine Fantasie nach einer Erzählung war – heute gilt dieses Bild als ältester «Beweis» für Baumskulpturen. Später beschäftigten sich unter anderem James Hall und Arthur Wiechula mit dem Bauen aus lebendigen Pflanzen. Am bekanntesten wurden die Werke von Axel Erlandson, der 1947 sogar einen «Tree Circus»2 in Santa Cruz, Kalifornien, eröffnete und die von ihm verformten Bäume ausstellte (vgl. «Natur formen»).
Heute wird diese Disziplin in Amerika «Arborsculpturing» genannt, an der Universität Stuttgart hat sich der Begriff «Baubotanik» etabliert. Am dortigen Institut «Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen» entwickeln die Mitarbeiter der Forschungsgruppe Baubotanik Mischobjekte, deren Tragkonstruktion aus lebendigen Pflanzen besteht, die nach und nach eingefügte Elemente wie Stege, Dächer und Plattformen umwachsen und diese mit der Zeit selbstständig tragen. Je nach Verbindungsmethode verwachsen sie schon nach einigen Monaten miteinander oder überwallen fremde Objekte innerhalb einiger Jahre. Die Baubotaniker erforschen besonders die konstruktiven und die botanischen Aspekte, um Werte zu finden, die die zunehmende Tragfähigkeit des lebendigen Baumaterials berechenbarer machen (siehe «Verwachsende Konstruktionen»). In eine ganz andere Richtung gehen die Forschungen am Institut für Stahl- und Holzbau der TU Dresden: Hier wird untersucht, wie Holztragwerke materialsparender und gleichzeitig tragfähiger gebaut werden können. Nach Versuchen zur Verdichtung von Holz und zur Textilbewehrung konnten nun Formholzrohre produziert werden, die mit ihren Eigenschaften – kein Quellen, kaum Schwund, sehr stabil und vielseitig einsetzbar – überzeugen.
Beide Forschungsgruppen haben mit ihrer Arbeit kein völlig neues Feld eröffnet. So wie es die Baubotanik unter anderem Namen gab, so ist die Verdichtung von Holz unter Wärme und Feuchtigkeit bekannt. Aber die Weiterentwicklung beider Techniken, die Kombination mit anderen Werkstoffen und die Forschung nach sinnvollen Anwendungen macht sie zu interessanten und auch bereits prämierten Beiträgen.
Katinka Corts
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Bernoulli-Platz in Basel
10 MAGAZIN
Bären und Wölfe in Arth-Goldau | 7. Branchenseminar Holz | Leserbrief: Fliessende Schnittstellen | Bücher
16 NATUR FORMEN
Hannes Schwertfeger
Lebende Pflanzen zu weiterwachsenden Gebilden und Bauten zu formen, ist eine ganz spezielle Form des Holzbaus. Ein geschichtlicher Exkurs.
19 VERWACHSENDE KONSTRUKTIONEN
Ferdinand Ludwig, Oliver Storz
An der Universität Stuttgart erforschen Baubotaniker Mischkonstruktionen mit technischen und pflanzlichen Elementen.
23 GEBAUTE BÄUME
Charles von Büren
An der TU Dresden wird nach neuen und effizienten Halbfertigprodukten für das Bauen mit Holz geforscht.
27 SIA
4. Direktionssitzung 2009 | Philosophiewechsel: Norm SIA 500 | Drehscheibe für Baukultur
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Natur formen
Der Geologe James Hall, der Gartenbauingenieur Arthur Wiechula und der Farmer Axel Erlandson beschäft igten sich im 19. und 20. Jahrhundert mit einer besonderen Form des Holzbaus: Sie formten lebende Pflanzen zu gotischen Fenstern, flochten sie zu Zäunen, bauten Türme mit ihnen – und liessen sie miteinander verwachsen. Ein geschichtlicher Abriss zu den drei Persönlichkeiten, die auch heutige Baubotaniker beeinflussen.
Die Entstehungsprozesse von Materialien, die wir gemeinhin als «natürlich» bezeichnen, erscheinen uns als langsam. Ein Baum wächst, solange er lebt, und produziert dabei Holz. Baubotaniker verwenden wachsende, lebendige Materialien für die Konstruktion von Bauten und sammeln dabei Erkenntnisse über die botanischen Eigenschaften von Pflanzen, ihr Verhalten und ihre Entwicklung. James Hall, Arthur Wiechula und Axel Erlandson haben aus unterschiedlichen Motivationen heraus Holzpflanzen geformt oder für konstruktive Zwecke eingesetzt.
James Hall, ein schottischer Geologe und Physiker, interessierte die Vortäuschung des Pflanzencharakters in einem anderen Material. In seinem 1813 veröffentlichten Essay «Ursprünge, Geschichte und Prinzipien der gotischen Architektur»[01] bemerkt er, dass gerade die «Verborgenheit der Naturformen» in der Gotik Aufmerksamkeit errege. In Konsequenz dieser Beobachtung konzentrierte sich Hall auf die Imitation der Natur als kulturelle Praxis. Er versuchte experimentell nachzuweisen, dass es keine in der Gotik vorkommende Form gebe, die nicht durch Holzpflanzen nachgebildet werden könne. Die Naturformen in der Gotik seien zwar an die räumlichen Anforderungen der Architektur angepasst worden, jedoch unter der Prämisse der plastischen Verformbarkeit der verwendeten Pflanzen. Die Übertragung der Form in Stein diente für Hall allein der Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Kunstwerks, das nun das Bedürfnis des Betrachters nach der Echtheit des Objekts auf zweierlei Art erfülle. Das Kunstwerk erscheint als real, denn all seine Formen sind mit Pflanzen zu bilden, während die künstlerische Fiktion in der Übertragung des Kunstwerks in den Stein zu finden ist, die ihm den Wert der Dauerhaftigkeit verleiht. Fiktion und Realität werden damit zur Basis des Kunstwerks, wobei die Realität von der plastischen Verformbarkeit der Pflanzen abhängt, die Hall in seiner Untersuchung nachzuweisen versucht hat.
Holzpflanzen verwachsen und überwallen Fremdkörper
James Hall war jedoch nicht der Einzige, der sich auf die Anfertigung gotischer Strukturen aus lebenden Pflanzen verstand. Die Herstellung gotisch anmutender Fenster, wahlweise auch romanischer, kennzeichnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Arbeit des Gartenbauingenieurs Arthur Wiechula. Dieser schätzte besonders die Fähigkeit von Holzpflanzen, miteinander verwachsen und technische Bauteile überwallen zu können. In seinem Buch «Wachsende Häuser aus lebenden Bäumen entstehend»[02] beschrieb er das von ihm beobachtete Phänomen am Beispiel der zufälligen Verwachsung zweier Kiefern. Anhand dieses Beispiels machte er deutlich, dass Verwachsungen von Pflanzen nicht nur eine stabile Verbindung eingehen können, sondern sich zudem gegenseitig versorgen, sodass bei Verwachsungen von einem zusammenhängenden Pflanzensystem gesprochen werden kann. Statt Bäume im Wald zu ziehen und diese anschliessend mit hohem Energie-, Arbeits- und Kapitalaufwand zu Bauholz zu verarbeiten, wollte Wiechula Pflanzen unmittelbar zu Gebrauchsgegenständen wie Zäunen und Häusern verwachsen lassen. Mittels gärtnerischer Methoden wie beispielsweise der Verpfropfung schlug er vor, Pflanzen so zu Gittern zu verbinden, dass sie durch ihr Dickenwachstum letztlich zu geschlossenen, lebenden Holzwänden verwachsen.Eine besondere Konsequenz seiner Arbeit sah Wiechula in den Möglichkeiten, die sich dabei für die Gartenkunst eröffnen würden, denn durch die Anlage von «schweben den Gärten mit Hilfe des Naturbauverfahrens wird die Gartenkunst mit einem Stoff bereichert, um den sie bisher die Bautechnik vergeblich beneidet hat»2. Gartenanlagen könnten mittels Rampen und Treppenanlagen nun dreidimensional konstruiert und erschlossen werden.
Baumplastik
1928 begann der amerikanische Farmer Axel Erlandson seine ersten Versuche, Pflanzen zu ungewohnten Formen verwachsen zu lassen. 1947 eröffnete er seinen ersten «Tree- Circus». Er sah sich vornehmlich als Gärtner, der mit wachsenden Bäumen Strukturen bildet. Der Pflanzenkünstler Richard Reames, der in Kalifornien lebt und dort verschiedene Baumformen wachsen lässt[03], beschreibt die Arbeit Erlandsons folgendermassen: «Spalierobst ist die der Baumplastik wahrscheinlich ähnlichste Kunstform. Aber Spalierbäume sind eindimensional, denn sie ähneln sich. Ihre Zweige sind alle gleichmässig horizontal angeordnet. Baumplastiken hingegen können alles sein. Sie können dreidimensional angeordnet werden, verschiedene Formen annehmen, eigentlich sogar jede. Es scheint keine Grenzen zu geben. Und diese Freiheit verleiht dem Umgang mit Pflanzen völlig neue Dimensionen.» Neben skulpturalen Baumstrukturen wie Spiralen, Ringen, Herzen und Knoten entstanden durch Erlandsons Versuche auch Leitern und Stühle. 1929 entstand die erste architektonische Zeichnung für einen Baum, der zu einem Eingangsportal zusammenwachsen sollte, und etwa zeitgleich begann der Versuch, einen «lebenden Turm» wachsen zu lassen. Nach mehrmaligem Verpflanzen sind von den 60 bis 70 verschiedenen, seltsam geformten Bäumen nur noch wenige am Leben.
Was verwächst, wächst
Wenn Baubotaniker mit lebenden Pflanzen konstruieren, treffen die Prinzipien der Botanik[04] auf die uns gewohnt erscheinenden Prinzipien der Architektur. Dieser Ansatz hat verschiedene Vorläufer, für die jeweils ein bestimmter Aspekt eines Bauens mit wachsenden Pflanzen im Vordergrund gestanden hat. In der Baubotanik wird versucht, diese verschiedenen Aspekte in Konstellation zueinander zu setzen. Die Forschungsgruppe «Baubotanik – Lebendarchitektur»[05] der Universität Stuttgart forscht interdisziplinär mit Architekten, Ingenieuren, Natur- und Geisteswissenschaftern (vgl. S.19ff.). Arbeiten in den Bereichen Botanik, Konstruktion, Ästhetik, Ethik und Kulturtheorie bilden einen sich gegenseitig befruchtenden Erkenntnisprozess, indem aus natur- und ingenieurwissenschaftlicher Perspektive die Grenzen des botanisch Machbaren ausgelotet und aus kulturtheoretischen Sicht die Konsequenzen untersucht werden, die eine Implementierung von Werdensprozessen in die Architektur nach sich ziehen wird.
Denn wenn wir die Pflanze im Zustand ihrer Physis belassen, dann benötigt sie weiterhin ihre Blätter und Wurzeln, um die gewünschten Prozesse wie Verwachsungen und Überwallungen aufrechterhalten zu können. Unterstellen wir der Architektur, dass sie vornehmlich menschlichen Bedürfnissen zu nützen habe, erscheint die Verwendung von Pflanzen eher als störend. Denn die Konsequenz daraus ist, dass die zukünftige, räumliche Entwicklung der Architektur über ihre Wachstumszeit hinweg massgeblich vom Pflanzenwachstum mitbestimmt wird. Vielleicht lässt sich in Zukunft die Konstruktion einer baubotanischen Struktur dahingehend optimieren, dass die Anforderungen der Pflanze in Bezug auf ihre Versorgung technisch so in den Bau integrierbar sein wird, dass sie den uns bekannten und gewohnten Planungs prozessen so wenig wie möglich hinderlich ist.
Doch aus Sicht der Architekturtheorie stellt gerade die Verwendung von lebenden Pflanzen als Tragstruktur eine Herausforderung dar. Denn die Entwicklung einer baubotanischen Struktur ist so stark von den vorherrschenden Umweltbedingungen ihres Ökosystems bestimmt, dass ihre Entwicklung und der Systemerhalt der in ihr ablaufenden Prozesse oft im Widerspruch zu den komplexen, gesellschaftlich bedingten Anforderungen an die Architekturproduktion steht. Wenn wir damit anfangen, nicht nur einzelne Materialeigenschaften für unsere Zwecke zu nutzen, sondern Materialien mit all ihren systemischen Eigenschaften und den daraus resultierenden Konsequenzen in die Architektur zu implementieren, muss die Architektur darauf reagieren. Sie muss sich dann an der Offenheit und Unabschliessbarkeit, der Komplexität, kurz, dem Werdenscharakter dessen orientiert, das wir gewohnt sind, Natur zu nennen. Dabei wissen vielleicht eher Gärtner die zuweilen nervenaufreibende, permanent um Aufmerksamkeit heischende baubotanische Pflanze zu schätzen, die unsere architektonischen Gewohnheiten von Stabilität und Festigkeit stört. Weil sie im Entwurfs- und Entstehungsprozess eigene Raumanforderungen stellt, sprechen Baubotaniker zuweilen von einem Emanzipationsprozess des Tragsystems in der Architektur. Denn auch die Pflanzen, die zu Gebäuden werden, fordern Licht, Luft und Sonne.
[Hannes Schwertfeger, Dipl.-Ing., Mitglied der Forschungsgruppe «Baubotanik – Lebendarchitektur» am Institut Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen (IGMA) der Universität Stuttgart. Er promoviert an diesem Institut im Themenschwerpunkt Architekturtheorie.]
Anmerkungen
[01] Hall, James: Essay on the origin, history and principles of Gothic Architecture. W. Bulmer, London, 1813, S. 2
[02] Wiechula, Arthur: Wachsende Häuser aus lebenden Bäumen entstehend. Verlag Naturbau-Gesellschaft Berlin-Friedenau, S. 196
[03] www.arborsmith.com
[04] Siehe hierzu: Mayr, Ernst: Die Entwicklung der Biologischen Gedankenwelt, Springer, Berlin, 1984
[05] Die FG Baubotanik-Lebendarchitektur ist 2006 am Institut Grundlagen moderner Architektur (IGMA) an der Universität Stuttgart gegründet worden. Institutsleiter ist Prof. Dr. Gerd de Bruyn.
[06] Wiechula, Arthur: Wachsende Häuser aus lebenden Bäumen entstehend. Verlag Naturbau-Gesellschaft, Berlin-FriedenauTEC21, Fr., 2009.07.17
17. Juli 2009 Hannes Schwertfeger
Verwachsende Konstruktionen
Baubotanische Gebilde sind als Mischkonstruktionen technischer und pflanzlicher Elemente konzipiert. Sie vereinen Eigenschaft en des Lebendigen wie des Technischen. An der Universität Stuttgart erforschen Baubotaniker diese Systeme und haben bereits Bauten wie einen Steg und eine Vogelbeobachtungsstation errichtet. Diesen Sommer wollen sie einen mehrgeschossigen Turm pflanzen. Vielleicht ermöglicht es die Baubotanik in einigen Jahren, Städte mit konstruierten Baumstrukturen auszustatten.
Der Begriff Baubotanik entstand 2005 am Institut Grundlagen Moderner Architektur und Entwerfen der Universität Stuttgart. Er steht für den Ansatz, Tragstrukturen aus lebenden Bäumen zu bilden. Sowohl in der Architektur als auch in der Gartenkunst sind Beispiele zu finden, bei denen versucht wurde, Bäume architektonisch zu formen oder gar Bauwerke aus Bäumen entstehen zu lassen (vgl. S.23ff.). Auch die Forschung und die Praxis der Baubotanik bewegen sich in diesem Feld, sie versuchen jedoch, den Ansatz auf natur- und ingenieurwissenschaftlicher Grundlage in Richtung einer Bauweise weiterzuent wickeln und die technischen wie ästhetischen Potenziale systematisch zu erforschen.
Steg und Vogelbeobachtungsstation
Das erste grössere Baubotanik-Bauwerk ist ein Steg, der im Frühjahr 2005 realisiert wurde. Die Konstruktion ist einfach: Die begehbaren Laufflächen und die Handläufe wurden konventionell aus Stahl konstruiert, während alle vertikalen lasttragenden und aussteifenden Konstruktionselemente aus Bündeln von Weidensteckhölzern gebildet wurden. Weil die verwendeten Weiden unter geeigneten Bedingungen am unteren Ende eines abgeschnittenen Triebes neue, sogenannte Adventivwurzeln bilden können, verankerte sich das Bauwerk selbsttätig im Boden, ohne dass ein klassisches Fundament nötig war. Oberirdisch trieben die Pflanzen unmittelbar nach Fertigstellung aus, und mit den ersten Blättern stellte die anfangs eher technisch anmutende Struktur ihre Lebendigkeit unter Beweis. Im Verlauf des Sommers entstanden fast blickdichte «grüne Wände», und das Bauwerk ähnelte zunehmend einem grossen Gebüsch oder einer Hecke (Abb. 1). Nur an den Stahlelementen und der geometrischen Form war es als ein artifizielles Gebilde zu erkennen. Mit dem Blattfall im Herbst dominierten wieder Technik und Geometrie. Doch auch im Winter ist offensichtlich, dass sich die Gestalt des Bauwerks durch die Wachstumsprozesse verändert, weil sich beispielsweise durch den Austrieb die ursprünglichen Proportionen verschieben (Abb. 2). Die Grundgeometrie der Tragstruktur verändert sich jedoch nicht, da Bäume nur an den Triebspitzen ein Streckungswachstum zeigen – die Stegfläche wächst nicht in die Höhe. Die einzelnen Pflanzen werden jedoch im Laufe der Zeit dicker, und insbesondere an Knotenpunkten kann es durch Verwachsen und Überwallen zu einer sichtbaren Zunahme der Tragfähigkeit kommen (Abb. 5–7 / Kasten S. 21) – die anfangs jungen Ruten entwickeln sich zu einer knorrigen Verbundstruktur, deren Ausformung im Detail nicht planbar ist. Dennoch weist die Konstruktion einige «Kinderkrankheiten» auf. Beispielsweise kam es an einigen Verbindungsstellen zu Strangulationen des Saftflusses, und in den Bündelstützen stehen die Pflanzen so dicht, dass es zu einem sehr ausgeprägten Konkurrenzkampf um die knappe Ressource Licht kommt: Einige wenige Pflanzen setzen sich durch und wachsen stark, viele andere bleiben in der Entwicklung zurück oder sterben sogar ab. Diese in allen Pflanzenbeständen völlig normale Entwicklung kann in einer baubotanischen Konstruktion problematisch werden, weil absterbende Pflanzenteile einen potenziellen Fäulnisherd darstellen.
Mit einem etwas anderen Konstruktionssystem und verbesserten Details versuchte man bei der 2007 fertig gestellten Vogelbeobachtungsstation im Bayrischen Wald diese kritischen Punkte zu verbessern. Auch bei diesem Bauwerk bilden lebende Weidensteckhölzer das Haupttragwerk, hier wurden jedoch immer nur vier Pflanzen zu einem Bündel zusammengefasst. Während diese Bündel im unteren Bereich zu X-förmigen Stützen verbunden sind, bilden sie im oberen Bereich eine Art Gitterwand. So kommt es innerhalb der Stützen weniger schnell zu Strangulationen, und jeder einzelnen Pflanze steht mehr Raum und Licht zur Verfügung, wobei gleichzeitig durch die gitterartige Wandbildung der Eindruck eines geschlossenen Raumes entsteht. Mit einer 2.70 m über dem Erdboden eingehängten elliptischen Plattform aus Holz und Stahl und einem kelchförmigen Membrandach, das zwischen einem ebenfalls einwachsenden Ring in 6 m Höhe und der Ebene verspannt ist, ist die Vogelbeobachtungsstation das erste und bisher einzige baubotanische Bauwerk mit zwei «Stockwerken ». Auch der Aufgang zur begehbaren Ebene ist baubotanisch gelöst: Der Besucher erklettert sich den Raum mit Hilfe von Leitersprossen, die in das Baumtragwerk eingebunden sind. Bis zu zehn Personen finden dann auf der Ebene, zwischen Membrandach und pflanzlicher Gitterwand, Platz.
Konstruktive Forschung in der Baubotanik
Verglichen mit konventionellen Konstruktionen sind Grösse und Nutzlast der Vogelbeobachtungsstation marginal, für die Baubotanik stellen sie jedoch bereits eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Zum einen ist die mögliche Grösse eines Bauwerks zunächst durch die Grösse der Pflanzen limitiert, und zum anderen fordert das empfindliche Pflanzenmaterial an allen Detailpunkten eine besondere Vorsicht ein, denn das lebende Gewebe sollte möglichst nicht beschädigt werden. Technische Elemente wie die begehbaren Plattformen können nur mit den Pflanzen verbunden werden, indem sie mit möglichst geringem Druck an diese gepresst werden – eine Verbindung, die natürlich zunächst nicht sehr belastbar ist. Gleichzeitig ist die Anzahl derartiger Detailpunkte begrenzt, denn die Zahl der Stützen kann nicht beliebig gesteigert werden, weil jeder Pflanze ein adäquater Kronenraum für die Fotosynthese zugestanden werden muss. Erst durch das einsetzende Dickenwachstum und das damit einhergehende Einwachsen der technischen Elemente kann die Tragfähigkeit im Verlauf der Zeit zunehmen.
Leistungsfähige Tragstrukturen können also nur bedingt konstruiert werden, die Tragfähigkeit entsteht zu grossen Teilen durch Wachstumsprozesse nach dem Konstruieren. Möchte man jedoch Wachstumsprozesse tatsächlich konstruktiv nutzen, müssen sie auch in statische Berechnungen einbezogen werden. Baubotanische Tragstrukturen stehen als lebende Bäume in ständigem Austausch mit ihrer Umwelt und sind mit dem Pflanzenwachstum an schwer vorhersagbare Umweltfaktoren gekoppelt. Das Ziel konstruktiver Forschung in der Baubotanik ist es daher, einfache Regeln zu erarbeiten, durch die die potenzielle Zunahme der Tragfähigkeit bereits in Entwurf und Planung integriert wird, beispielsweise indem Nutzungsphasen mit sukzessiv steigender Belastung entwickelt werden.
Auch wird zurzeit an einer möglichst einfachen Methode gearbeitet, die Tragfähigkeit einer wachsenden baubotanischen Struktur anhand visuell erkennbarer oder einfach zu messender Schlüsselparameter erfassen und quantifizieren zu können. Neben der Durchmesserzunahme der einzelnen Stämme ist es hier insbesondere der Grad der Überwallung technischer Bauteile, der die Tragfähigkeit wesentlich bestimmt und zurzeit in breit angelegten Versuchsreihen an unterschiedlichen Knotenpunkten untersucht wird. Neben diesen unmittelbar zugänglichen Punkten ist auch die Entwicklung des «Wurzelfundaments» von besonderer Bedeutung für die Tragstruktur. Sie entzieht sich jedoch der unmittelbaren Beobachtung und kann daher kaum visuell überprüft werden.
Botanische Forschung in der Baubotanik
Entscheidend für das Entwerfen baubotanischer Bauten sind jedoch nicht nur Wachstumsprozesse nach dem Konstruieren. Ein baubotanischer Entwurf ist immer auch sehr stark durch die geometrischen sowie die mechanischen Eigenschaften der zum Konstruieren verwendeten Pflanzen geprägt, die ebenfalls durch einen mitunter Jahre dauernden Wachstumsprozess entstehen. Für baubotanische Konstruktionen sind hauptsächlich solche Pflanzen geeignet, die möglichst wenig verzweigt, lang, schlank und gerade gewachsen sind. Zudem sind hauptsächlich junge Triebe geeignet, da diese u. a. am besten miteinander verwachsen und sich am einfachsten formen lassen. Bei Weiden ist derartiges Pflanzenmaterial durchaus verfügbar, mit zunehmender Länge werden die Stämme aber auch immer dicker und steifer. Pflanzen, wie sie beispielsweise für die Vogelbeobachtungsstation verwendet wurden, sind bereits so kräftig, dass sie sich kaum biegen lassen. Bei anderen Baumarten ist derartiges Material kaum verfügbar und muss erst in Baumschulen wachsen. Gleichwohl bieten andere Baumarten wie Platanen viel grössere konstruktive und gestalterische Möglichkeiten. Weiden wachsen zwar sehr schnell, benötigen aber besonders viel Licht und Wasser. Sie sind deshalb der freien Landschaft vorbehalten und eignen sich nicht für urbane Räume. Doch gerade in Städten, in denen die ästhetischen wie ökologischen Qualitäten von Bäumen besonders gefragt sind, könnten baubotanische Strukturen ihre Qualitäten voll zur Geltung bringen. Bei den botanischen Forschungen in der Baubotanik soll ein möglichst breites Artenspektrum erschlossen werden. Auch das Zusammenfügen des lebenden Konstruktionsmaterials muss weiter untersucht werden. Dabei nimmt die Erforschung von Verwachsungen eine Schlüsselstellung ein. Wenn Verwachsungspartner fest und dauerhaft beispielsweise mittels sehr dünner Drahtseile aufeinandergedrückt werden, ist es möglich, Pflanzen gezielt so miteinander zu verbinden, dass innerhalb weniger Monate eine Art «Baumverschweissung » entsteht, die nicht nur mechanisch belastbar ist, sondern auch den Austausch von Wasser und Nährstoffen zwischen ursprünglich getrennten Pflanzen ermöglicht (Abb. 10). So konnte in ersten Versuchen gezeigt werden, dass sich aus jungen und eher kleinen Pflanzen grosse und mehr oder weniger frei formbare baubotanische Strukturen bilden lassen, indem mehrere Pflanzen mitsamt ihren Wurzeln im Raum angeordnet und untereinander verbunden werden. Nachdem dann durch Verwachsung eine physiologische Einheit entstanden ist und sich im Boden ein leistungsfähiges Wurzelsystem etabliert hat, können die im Luftraum angeordneten Wurzeln sukzessive entfernt werden, und die Struktur «ernährt» sich ohne die anfangs notwendige Bewässerungstechnik selbstständig vom Boden aus. Im Sommer 2009 sollen diese Ansätze erstmals an einem 8 m hohen prototypischen Turm nahe dem bestehenden Steg in die Praxis umgesetzt werden (Abb. 8 und 9).
[Ferdinand Ludwig, Dipl.-Ing., Forschungsgruppe Baubotanik
Oliver Storz, Dipl.-Ing., Forschungsgruppe Baubotanik
Die Autoren promovieren derzeit: Ferdinand Ludwig befasst sich insbesondere mit den botanischen Aspekten der Baubotanik, während Oliver Storz über konstruktive Möglichkeiten der Baubotanik schreibt.]TEC21, Fr., 2009.07.17
17. Juli 2009 Ferdinand Ludwig, Oliver Storz