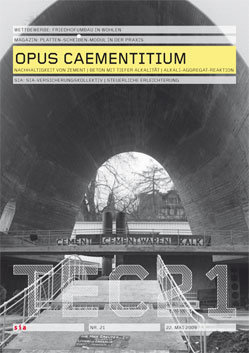Editorial
Der Titel dieses Hefts erinnert daran, dass unser Massenbaustoff Beton im Prinzip schon in der Antike bekannt war. «Opus caementitium» nannten die Römer einen betonähnlichen Baustoff aus Steinen, Sand und gebranntem Kalkstein mit natürlichen Puzzolanen als hydraulisches Bindemittel. Dieser auch unter Wasser aushärtende, fast beliebig formbare Kunststein trug wesentlich zur Blüte des römischen Imperiums bei, denn viele Kilometer Aquädukte, aber auch Hafenmolen, Brücken und öffentliche Bauten konnten nur mit Opus caementitium realisiert werden.
Seit mehr als einem Jahrhundert übt der Baustoff Beton bzw. Stahlbeton eine vergleichbare zivilisatorische Schrittmacherfunktion aus. In dieser Ausgabe von TEC21 werden aktuelle Forschungen zu verschiedenen Aspekten von der Erzeugung bis zur Zerstörung unseres wichtigsten Baustoffs vorgestellt.
Für die Herstellung des Opus caementitium musste, unter anderem, Kalk gebrannt werden, was mit zur Abholzung der Wälder im Mittelmeerraum beigetragen hat. Die Puzzolane kamen jedoch in der Natur vor und mussten nicht gebrannt werden, sodass die ökologischen Auswirkungen des Herstellungsprozesses moderat waren. Beim heutigen Zement verbraucht der Herstellungsprozess grosse Mengen fossiler Brennstoffe, was angesichts der globalen CO2-Problematik, etwa im Vergleich zu Holzbaustoffen, ein Nachteil ist. Die Nachhaltigkeit heutiger zementöser Baustoffe und ihrer Rohstoffe und mögliche Alternativen werden auf den Seiten 14 bis 16 beschrieben.
Das Opus caementitium war für die antiken Bauarbeiter wegen seiner Alkalität auch ein gefährlicher Baustoff. Der heutige Beton ist meist noch alkalischer, was für den Korrosionsschutz der Bewehrung durchaus erwünscht ist. Bezüglich Umweltverträglichkeit ist die hohe Alkalität jedoch problematisch. Wenn Beton im sensiblen Kontext der Lagerung radioaktiver Abfälle verwendet wird, müssen diesbezügliche Risiken minimiert werden. Deshalb wird mithilfe puzzolanischer Zusatzstoffe Beton mit tieferer Alkalität entwickelt (S. 17-19). Für spezielle Anwendungen verläuft die Entwicklung gewissermassen zurück zu den antiken Vorbildern ohne Portlandzement, aber mit modernen Zusatzstoffen anstelle der römischen Puzzolane.
Etliche Bauwerke aus Opus caementitium haben sich, auch dank günstigen Umgebungsbedingungen, über mehr als 2000 Jahre erhalten. Für unsere heutigen Betonbauten ist das wenig wahrscheinlich. Die Beanspruchungen aus der Umwelt sind stärker geworden, und durch den heutigen Zement kann Beton durch früher unbekannte Reaktionen geschädigt werden. Dazu gehört die Alkali-Aggregat-Reaktion, die nicht nur in der Schweiz zu den wichtigsten Schadensursachen gehört. Der Beitrag auf den Seiten 20 bis 23 befasst sich mit diesem noch wenig erforschten Mechanismus.
Aldo Rota
Inhalt
WETTBEWERBE
Friedhofumbau in Wohlen
MAGAZIN
Platten-Scheiben-Modul
NACHHALTIGKEIT VON ZEMENT
Susanne Kytzia, Christina Seyler
Die CO2-Bilanz der energieintensiven Zementproduktion kann durch den Einsatz von Sekundärbrenn- und -rohstoffen deutlich verbessert werden.
BETON MIT TIEFER ALKALITÄT
Thomas Spillmann et al.
Geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle sollen mit Spritzbeton verschlossen werden. Dafür wird ein Beton mit niedrigem pH-Wert entwickelt.
ALKALI-AGGREGAT-REAKTION
Christine Merz, Fritz Hunkeler
Durch diesen - noch nicht vollständig aufgeklärten - Schadensmechanismus werden immer mehr Betonbauwerke in der Schweiz gefährdet.
SIA
PRODUKTE
VERANSTALTUNGEN
IMPRESSUM
Nachhaltigkeit von Zement
Der Baustoff Beton gilt allgemein nicht als besonders ökologisch. Meistens wird seine Herstellung mit Ressourcenverschwendung und, was die Komponente Zement betrifft, übermässiger CO2-Produktion gleichgesetzt. Eine ganzheitliche Betrachtung, unter Berücksichtigung rezyklierter Rohmaterialien und alternativer Brennstoffe, ergibt aber ein differenzierteres Bild.
Die Schweiz verfügt über ausreichende natürliche Lager von Kies, Sand, Kalkstein und Mergel, um den Bedarf an Kiessanden und Zement in den kommenden Jahrzehnten zu decken. Trotz einer gewissen räumlichen Konzentration der natürlichen Lagerstätten können nahezu alle Schweizer Regionen versorgt werden, ohne dass erhebliche Transportdistanzen überwunden werden müssen. Der Abbau der Kieslagerstätten erfolgt mit einem relativ geringen Energieaufwand, denn 65 % aller Kieslager der Schweiz produzieren Rundkies, der direkt zu Beton weiterverarbeitet werden kann.[1] Die restlichen 35 % der Kiesvorkommen erfordern ein zusätzliches, energieintensives Brechen des Gesteins. Die Schweiz ist ausserdem ein hervorragend durch die Bahn erschlossenes Land, sodass beachtliche 46 % aller Zementtransporte auf dem Schienenweg erfolgen.[2] Auch zur Energieversorgung kann die Industrie zu einem grossen Teil auf heimische Rohstoffe zurückgreifen. Im Durchschnitt aller Zementwerke wurden 2008 über 46 % des Brennstoffbedarfs durch sogenannte Sekundärbrennstoffe, d. h. Brennstoffe, die in anderen Industrien als Abfälle anfallen, gedeckt.[3] Die Grundlage dazu bildet die Richtlinie des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) «Entsorgung von Abfällen in Zementwerken».
Ein aktuelles Forschungsprojekt im Rahmen des Forschungsprogramms «Nachhaltige Sied lungsund Infrastrukturentwicklung» des Schweizerischen Nationalfonds (NFP 54) zeigt, dass die verbleibenden Risiken eines Eintrags von Schwermetallen in den Beton durch den Einsatz von Sekundärbrenn- und -rohstoffen für Mensch und Umwelt vertretbar sind.[4] Beton ermöglicht die Konstruktion von Bauwerken mit langer Lebensdauer und kann bei ihrem Abbruch in einer Qualität wiedergewonnen werden, die seine Verwendung als Kiesersatz erlaubt.
Was kommt jetzt auf die Industrie zu?
Heute steht die Industrie vor Herausforderungen, die die bestehenden Strukturen verändern werden. Dazu gehören einerseits globale und nationale Initiativen zum Klimaschutz. CO2-Reduktionsziele sind sowohl in der privaten Wirtschaft als auch in der Umweltpolitik weit verbreitet und beginnen aktuell zu wirken. Die Zementindustrie setzt und realisiert eigene CO2-Reduktionsziele, um ihre Handlungsspielräume unter verschärften klimapolitischen Rahmenbedingungen zu erhalten.[5]
Der zweite grosse Problemkreis ist der Umbau des Bauwerks Schweiz: Seit Beginn des letzten Jahrhunderts wächst das umbaute Volumen in der Schweiz ununterbrochen, und der Bestand an Infrastrukturen nimmt ebenfalls kontinuierlich zu.[6] Ein grosser Teil dieses «Bauwerks» wird in den kommenden Jahrzehnten das Ende seiner technischen Lebensdauer erreichen. Zusammen mit dem anhaltend hohen Druck, den begrenzten Siedlungsraum möglichst effizient zu nutzen, wird dies zu steigenden Abbruchraten führen. Damit wird Gesteinskörnung für die Betonherstellung, die aus Bauabfällen gewonnen wird (vgl. TEC21 10/2004, 3-4/2005, 10/2006), zu einer spürbaren Konkurrenz für Material aus dem Kiesabbau.
Ersatz von Primärressourcen als Lösung
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen hat die Schweizer Zement- und Betonindustrie weitgehende Handlungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Sekundärbrenn- und -rohstoffen in der Produktionskette von Beton (Abb. 2). Vereinfachend betrachtet, besteht diese aus den drei Schritten Klinkerproduktion, Zementproduktion und Betonproduktion. Im ersten Schritt wird in einem Hochtemperaturprozess Rohmehl (Gesteinsmehl) zu Klinker verarbeitet.
Im Rohmehl können die Primärressourcen Kalkstein und Mergel durch Sekundärrohstoffe wie kontaminiertes Erdreich oder Trockenklärschlamm ersetzt werden. Zur Feuerung des Drehrohrofens können neben den Primärressourcen Kohle und Schweröl auch Sekundärbrennstoffe wie Tiermehl, Trockenklärschlamm, Altreifen, Altöl oder Lösungsmittel und Kunststoffabfälle eingesetzt werden.
Im zweiten Produktionsschritt – der Zementherstellung – wird der Klinker mit Zumahlstoffen, beispielsweise Kalkstein, gemischt und gemahlen. Auch hier können Sekundärrohstoffe eingesetzt werden, die teilweise als Rückstände anderer Hochtemperaturprozesse ähnliche zementöse Eigenschaften haben wie der Klinker – beispielsweise Hüttensand aus Hochöfen oder Flugasche aus Kohlekraftwerken. In der Betonproduktion, dem dritten Produktionsschritt, werden Zement, Kies, Sand und Wasser sowie in speziellen Fällen auch Zusatzstoffe wie beispielsweise Flugasche eingesetzt. Hier können Kiessande aus dem Abbau natürlicher Kieslager durch Gesteinskörnungen aus Betonabbruch ersetzt werden.
Reduktion der CO2-Emissionen
Um dieses Ziel zu erreichen, bietet der erste Produktionsschritt die grössten Möglichkeiten, weil der massgebliche Teil der CO2-Emissionen bei der Klinkerproduktion entsteht. Verantwortlich dafür ist neben der Verbrennung fossiler Energieträger im Zementofen vor allem der Ausstoss von Kohlendioxid beim Brennen (Kalzinieren) von gemahlenem Kalkstein zu Klinker. Diese sogenannten geogenen CO2-Emissionen sind naturgegeben und können durch den Einsatz alternativer Brennstoffe nicht vermindert werden. Gelingt aber die Reduktion des Anteils von Klinker pro Tonne Zement, werden sowohl die geogenen CO2-Emissio nen als auch die Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen gesenkt. In der Schweiz ist dieser Weg erfolgreich beschritten worden (Abb. 1). Zementarten mit einem hohen Klinkeranteil wie Portlandzement haben deutlich an Marktanteil verloren – mit den entsprechenden positiven Auswirkungen für den Klimaschutz.
Allerdings hat die Schweizer Zement- und Betonindustrie in dieser Entwicklung eine denkbar schlechte Ausgangslage. In der Schweiz sind weder Hochöfen noch Kohlekraftwerke vorhanden, sodass Hüttensande und Flugaschen über weite Distanzen importiert werden müssen. Andere Länder verfügen hingegen über Quellen von Zusatzstoffen mit klinkerähnli chen Eigenschaften. In Italien sind dies beispielsweise natürliche Puzzolane aus Vulkantätigkeit; in Deutschland, Frankreich und Österreich sind es die lokal anfallenden Rückstände aus Stahlhütten oder Kohlekraftwerken.
Der zweitwichtigste Schritt auf dem Weg zu den CO2-Zielen ist der Einsatz von Sekundärbrennstoffen im Zementofen. Interessant sind vor allem hochkalorische Abfälle wie Altöl oder Lösungsmittel. Deren Verfügbarkeit ist aber begrenzt. Die Schweizer Abfallpolitik hat über Jahrzehnte die stoffl iche Wiederverwertung, beispielsweise von PET, gefördert und die zahlreichen Kehrichtverbrennungsanlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Diese Massnahmen sind abfallpolitisch sicher sinnvoll, sie schränken aber die Möglichkeiten der Zementindustrie ein, durch Verbrennung von Sekundärbrennstoffen ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen, da deren Verfügbarkeit auf dem Abfallmarkt abnimmt.
Der Einsatz von Betonabbruchgranulat als Kiesersatz bringt keine wesentliche Reduktion des CO2-Ausstosses. Dieser Ausstoss hängt massgeblich von der eingesetzten Zementmenge und der Zementart ab.[7] Verwendet man für Beton mit einem hohen Anteil von Betonabbruchgranulat – d. h. Recyclingbeton – mehr Zement als für Beton mit natürlicher Gesteinskörnung, kann dies in der Gesamtbilanz sogar zu mehr CO2-Emissionen führen.
Der Umbau des Bauwerks Schweiz
Bis heute können in den meisten Schweizer Kantonen die anfallenden Mengen an Betonabbruchgranulat in loser Form als Kiessande wiederverwertet werden – zumeist im Strassenbau. Dabei werden sehr hohe Wiederverwendungsquoten von über 90 % erreicht, einfach weil heute wesentlich mehr gebaut als abgebrochen wird (Abb. 3). Wird jedoch davonausgegangen, dass das Abbruchvolumen im Verhältnis zum Neubauvolumen steigt, dann wird in einigen Kantonen in den nächsten Jahren mehr Betonabbruchgranulat zur Verfügung stehen, als in der bisherigen Form eingesetzt werden kann. Die Kantone Genf und Zürich propagieren daher den vermehrten Einsatz von Betonabbruchgranulat in der Betonproduktion.
Die Dauerhaftigkeit von Bauwerken aus Recyclingbeton ist dabei ein neuer Aspekt, auf den im folgenden Beitrag hingewiesen wird. Diese Initiative schlägt sich auch im neu entwickelten Baustandard «Minergie-Eco» nieder,[8] in dem ein Mindestanteil von Recyclingbeton in Bauprojekten vorgeschrieben wird, falls dieser innerhalb von 25 km Transportdistanz verfügbar ist. Dies erhöht den Druck auf die Betonproduzenten, Recyclingbeton anzu bieten. Vorreiter sind dabei Unternehmen, die über begrenzte natürliche Kiesvorkommen verfügen. Vor den Entscheid gestellt, in die teure Erschliessung neuer Vorkommen zu investieren oder auf den neuen Markt für Recyclingbeton zu setzen, fällt die Wahl nicht schwer. Denn beim Recyclingbeton lässt sich heute zweimal verdienen: bei der Aufbereitung des Bauabfalls und beim Verkauf des Betons.
Unternehmen mit ausreichenden natürlichen Kiesvorkommen warten hingegen eher ab. Denn ein tatsächlicher Angebotsüberhang von Betonabbruchgranulat ist erst in Jahrzehnten zu erwarten. Gleichzeitig sind die Gewinne bezüglich «Klimaschutz» – dem aktuell wichtigeren Thema für die Industrie – unter dem Strich bestenfalls gering.
Durchzogenes Zukunftsszenarios
Die Schweiz ist ein rohstoffarmes Land. Für eine CO2-freundliche Zement- und Betonproduktion fehlen ausreichende Sekundärbrenn- und -rohstoffe. Ihr Reichtum an natürlichen Kiesvorkommen hingegen verzögert den Strukturwandel hin zu einer Produktion von Beton aus Abbruchgranulaten. Deshalb besteht Handlungsbedarf. Die Zement- und Betonindustrie ist sicher gut beraten, wenn sie (weiter) versucht, den Einsatz von Sekundärbrenn- und -rohstoffen zu fördern – unter Gewährleistung einer positiven Bilanz für den Klimaschutz und als Beitrag in Richtung energieautarker Produktion in der Schweiz. Dabei sollten die Spielräume in der Beschaffung von Sekundärbrenn- und -rohstoffen mit der Abfallpolitik neu ausgehandelt werden. Aus Sicht des Staates sollte dabei die Frage erlaubt sein, ob es nicht auch Synergien zwischen Abfall- und Wirtschaftspolitik geben kann. Gefordert sind jedoch auch – und vor allem – Innovationen in der Zement- und Betonindustrie selbst. Das Ziel ist eine Produktionsweise in der Schweiz, die die vorhandenen Standortvorteile nutzt, um weiterhin eine führende Position in der nachhaltigen Zement- und Betonproduktion einzunehmen.
[ Susanne Kytzia, Prof. Dr., Professur für Nachhaltigkeit im Bauwesen, Institut für Bau und Umwelt IBU, Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Christina Seyler, Dr. sc. Nat., Ernst Basler Partner AG, Zollikon ]TEC21, Fr., 2009.05.22
Anmerkungen
[1] Kellenberger, D., Althaus, H.-J., Jungbluth, N., Künniger, T.: Life Cycle Inventories of Building Products. Final report ecoinvent 2000 No. 7, Empa Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventries, Dübendorf 2003
[2] Cemsuisse. Jahresbericht 2006. Bern 2006. www.cemsuisse.ch
[3] Angaben von Cemsuisse (Gespräch mit Heiner Widmer am 15. 4. 2009)
[4] Kytzia, S., Seyler, C., Leuz, A.-C. und Johnson, A.: Sustainable Development of the Built Environment. Evaluation of structural changes in the Swiss building industry, Final Scientifi c report (to be published)
[5] Siehe dazu auch Informationen zur Branchenvereinbarung der Zementindustrie mit dem Bund. www.cemsuisse.ch
[6] Arioli, M. und Haag, M.: Bauabfälle Schweiz – Mengen, Perspektiven und Entsorgungswege. Band 1 und 2. Umwelt-Materialien Nr. 131, Buwal, Bern 2001
[7] Künniger, T., Werner, F. und Richter, K.: Ökologische Bewertung von Kies, Zement und Beton in der Schweiz (Kurzfassung). Verlag Empa-Akademie, 2001
[8] Siehe Dokumentation zum Minergie-Standard: www.minergie.ch
22. Mai 2009 Susanne Kytzia, Christina Seyler
Beton mit tiefer Alkalität
Die geplanten geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle sollen dereinst mit Spritzbeton verschlossen werden. Die hohe Alkalität des Betons kann dabei für gewisse Teile auch nachteilig sein und angesichts der langen Zeithorizonte zu Instabilitäten führen. Im Fels labor Grimsel der Nagra wird deshalb ein Spritzbeton mit geringer Alkalität und ausreichender Festigkeit als Verschlussmaterial entwickelt.
Das Sicherheitskonzept zur geologischen Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz beruht auf mehrfachen passiven Sicherheitsbarrieren. Die äusserste bei der Beurteilung der Sicherheit in Betracht gezogene Barriere ist das Gestein, in welches das Tiefenlager platziert werden soll (Wirtgestein). Im Tiefenlager übernehmen technische Barrieren wie Endlagerbehälter, die Verfüllung der Lagerstollen sowie ihre Versiegelung weitere wichtige Funktionen im Sicherheitskonzept. In internationalen Entwicklungsprogrammen wird die gegenwärtige Technologie zur Handhabung der Abfälle und zum Einbau der technischen Barrieren sowie für den Verschluss der Anlage verfeinert und optimiert. Der nachfolgend beschriebene Demonstrationsversuch im Felslabor Grimsel im Rahmen des EU-Forschungsprojekts ESDRED1 hat die Entwicklung eines technischen Barrierensystems unter Verwendung von Spritzbeton mit optimierten chemischen Eigenschaften zum Ziel.
Im Felslabor Grimsel
Ein Felslabor tief im Berg bietet mit seinen unterschiedlichen geologischen Verhältnissen ideale Rahmenbedingungen zur Untersuchung der Wirkungsweise geologischer und technischer Barrieren. Das Felslabor Grimsel (FLG) liegt 1730 m über Meer in granitischen Gesteinen des Aarmassivs (Abb. 1). Es wird über den Zugangsstollen zur Zentrale Grimsel II der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) erreicht (Abb. 2). Das Labor ist rund einen Kilometer lang und wurde 1983 mit einer Tunnelbohrmaschine und im Sprengvortrieb aufgefahren. Im Anschluss wurden die geologischen, hydrogeologischen und geochemischen Verhältnisse gründlich untersucht.
Ein generisches Felslabor wie das an der Grimsel dient ausschliesslich Forschungszwecken. Mit der gut ausgebauten Infrastruktur und Betreuung durch Fachpersonal stehen die technischen Voraussetzungen für wissenschaftliche Experimente bereit. In der Vergangenheit wurden wichtige Grundlagen zur Konzeption geologischer Tiefenlager erarbeitet. Aktuelle Experimente fokussieren stärker auf die technologische Umsetzung und die Überprüfung der Machbarkeit. Die Lagerung von radioaktiven Abfällen in einem generischen Felslabor ist ausgeschlossen.
Ein Stollenverschluss aus Niedrig-pH-Spritzbeton
Das europäische Forschungsprojekt ESDRED umfasst unterschiedliche Versuche mit dem Ziel, die technologische Entwicklung zum Bau, Betrieb und Verschluss eines Tiefenlagers international zu koordinieren. Für hochaktive Abfälle gilt eine Lagerungsdauer von einer Million Jahren. Der Versuch «Stollenverschluss» im Felslabor Grimsel dient als Demonstration für ein temporäres oder ein endgültiges Abschlussbauwerk in horizontalen Lagerstollen für hoch aktive Abfälle. Die Endlagerbehälter mit der sie umgebenden Verfüllung aus Bentonit (ein hauptsächlich aus Tonmineralien bestehendes Gestein, das eine hohe Wasseraufnahmeund Quellfähigkeit aufweist) werden damit vom Zugangsstollen isoliert. Ein Verschlussbauwerk aus Spritzbeton übernimmt die Aufgabe des mechanischen Widerlagers.
Der Einsatz von konventionellem Spritzbeton aus Portlandzement für solche Bauwerke kann die Bentonitverfüllung und das Wirtgestein chemisch beeinfl ussen. Die Flüssigkeit im Porensystem zementhaltiger Materialien ist im Wesentlichen eine gesättigte Kalziumhydroxidlösung (Ca(OH)2) mit einem pH-Wert von ca. 12.6. Gelangt diese stark alkalische Lösung in den angrenzenden Bentonit oder das angrenzende Wirtgestein (pH-Fahne), kann sie durch chemische Wechselwirkung deren Langzeitstabilität und Stofftransporteigenschaften be einträchtigen. Der Einsatz von Portlandit-armem (Niedrig-pH-)Spritzbeton reduziert diese chemischen Wechselwirkungen. Angestrebt wird dabei ein um etwa ein bis zwei Einheiten niedrigerer pH-Wert.
Die Entwicklung von Niedrig-pH-Spritzbeton für Anwendungen in geologischen Tiefenlagern ist einer der Schwerpunkte des interdisziplinär ausgerichteten ESDRED-Projekts. Dieser Beton soll mit «normalem» Spritzbeton möglichst vergleichbare mechanische und verfahrenstechnische Eigenschaften aufweisen. Verschiedene Labor- und Feldversuche in Spanien, Schweden und der Schweiz, die unter dem ESDRED-Projekt koordiniert werden, haben dazu die Nachweise erbracht. Ziel ist, die Machbarkeit eines Stollenverschlusses aus Niedrig-pH-Spritzbeton im Massstab 1:1 zu demonstrieren.
Herstelklung, Applikation und Prüfung
Zur Vermeidung von Hoch-pH-Wässern (pH-Fahne) im Nahfeld wurde in verschiedenen Versuchen ein Spritzbeton entwickelt, bei dem der Gehalt an löslichem Portlandit begrenzt wird. Dies wird erreicht, indem der Gehalt an Portlandzement reduziert und mit puzzolanisch reagierendem Silicafume ergänzt wird, sodass sich das Bindemittel aus 60 % Portlandzement und 40 % Silicafume zusammensetzt (siehe Kasten S.17). Trotz dem niedrigen Zementgehalt von 165 kg / m3 und dem relativ hohen Anteil an Silikaten konnten die üblichen Anforderungen an die Früh- und Endfestigkeit sowie an die Verarbeitbarkeit erreicht werden. Vorgesehen war die Applikation im Nassspritzverfahren mit Förderdistanzen von etwa 70 m. Der Spritzbetonverschluss war in vier Schichten von jeweils 1 m Dicke aufzutragen.
Zur Optimierung der Spritzbetonrezeptur und zum Nachweis der Funktionalität aller Elemente bis zur Spritzbetonapplikation wurde ein umfassender Vorversuch im Versuchsstollen Hagerbach in Flums durchgeführt. Die Applikation erfolgte in einem geschalten runden Tunnelabschnitt mit einem Durchmesser von 3.5 m (Abb. 4). In diesem simulierten Labortunnel musste der Beton auf der gesamten Höhe in praktisch einem Arbeitsgang mit einer Dicke von 1 m aufgebaut werden. Er wurde in mehreren, zwiebelartigen Lagen über den gesamten Querschnitt aufgebracht, um durchgehende Risse infolge des Abbindens zu vermeiden. Die hohe Klebrigkeit des Spritzbetons reduzierte den anfallenden Rückprall, sodass sich bezüglich Rückprallhandling keine Probleme stellten. Die Verfl üssigerdosierung wurde optimiert, um eine gut pumpbare Mischung mit einem trotzdem relativ niedrigen Ausbreitmass von ca. 450 mm herzustellen.
Beim eigentlichen Versuch im Felslabor Grimsel konnten die Erkenntnisse aus dem Vorversuch erfolgreich übertragen werden. Abb. 5 zeigt die Applikation des Spritzbetons während des Baus des Spritzbetonverschlusses. Die Eigenschaften des Spritzbetons wurden mittels Frischbetonkontrollen und Festigkeitsbestimmungen an Bohrkernen überprüft.
Technische Ausführung und Bau
Abb. 3 illustriert schematisch den Versuchsaufbau am Ende des Laborstollens im Felslabor Grimsel. Hier wurde der 4 m lange Stollenverschluss aus Niedrig-pH-Spritzbeton erstellt. Er dient als mechanisches Widerlager gegen den sich langsam aufbauenden Quelldruck im anschliessenden Bentonitkörper. Diese rund 1 m mächtige Schicht aus Bentonit simuliert den Abschluss eines horizontalen Lagerstollens. Dazu wurden hoch kompaktierte Bentonitblöcke in sieben vertikalen Sektionen aufgeschichtet (Abb. 6).
Mehrere Jahrzehnte wären nötig, um diesen Bentonitkörper mit natürlichem Formationswasser zu sättigen. Deshalb wurden Bewässerungsmatten zwischen einzelne Bentonitsektionen eingezogen. Mittels Wasserinjektionen kann die Wassersättigung und somit das Quellen der Tonminerale im Bentonit gezielt beschleunigt werden.
Momentaner Status und Überwachung
Nach Abschluss der Bauarbeiten Anfang 2007 begann der Belastungstest mit den ersten Wasserinjektionen. Die Wassersättigung verläuft auch mit der künstlichen Bewässerung relativ langsam, und der Aufbau des Quelldrucks ist noch nicht abgeschlossen. Der erwartete Quelldruck bei vollständiger Sättigung liegt bei 4.5 MPa, wobei sich gegenwärtig etwa die Hälfte dieses Druckes aufgebaut hat.
Die kontinuierliche Überwachung der mechanischen und hydraulischen Druckentwicklung ist durch ein dichtes Netzwerk von verschiedenen Sensoren in Bentonitkörper, Verschluss und Wirtgestein gegeben. Würden die Datenkabel eines Überwachungsnetzes durch die technischen Barrieren geführt, könnten sie deren Funktion beeinträchtigen. Deshalb werden im ESDRED-Versuch auch kabellose und indirekte Überwachungsmethoden eingesetzt und getestet. Die kabellose Überwachung beruht auf einem redundanten Netzwerk von Messsensoren im Bentonitkörper. Die Datenübertragung erfolgt über ein moduliertes quasistatisches Magnetfeld, das feste Materie über einige 100 m durchdringen kann. Da sich die kabellose Übertragung von elektrischer Energie noch in Entwicklung befi ndet, wird der einzementierte Sender durch langlebige Batterien mit Strom versorgt.
In Zusammenarbeit mit der ETH Zürich werden geophysikalische Methoden für die indirekte Überwachung entwickelt. Dazu wurde ein Fächer aus sechs Überwachungsbohrungen abgeteuft (Abb. 3). Diese Bohrungen lassen die technische Barriere und die Auflockerungszone im Wirtgestein intakt. Mittels einer geeigneten Quelle und Empfängern wird das Gebiet zwischen den Überwachungsbohrungen mit seismischen Wellen durchstrahlt. Regelmässige Wiederholungsmessungen erlauben Rückschlüsse auf Änderungen des Wassergehalts und der Druckverhältnisse. Gegenwärtig wird an der computerunterstützten Analyse der aufgezeichneten Wellenfelder gearbeitet, damit Veränderungen der Druckverhältnisse quantitativ dargestellt werden können. Die seismische Tomografie ist ein bildgebendes Verfahren, ähnlich der medizinischen Computertomografie.
Die Überwachung eines künftigen geologischen Tiefenlagers in der Schweiz ist gesetzlich vorgeschrieben. Methoden, wie sie hier vorgestellt werden, könnten dereinst zur Überwachung des vorgesehenen Pilotlagers herangezogen werden.
[ Thomas Spillmann, Dr. sc. nat., Projektleiter Geowissenschaften, Nagra, Thomas Fries, dipl. Bauing. ETH/SIA, Ressortleiter Ingenieurwesen, Nagra, Volker Wetzig, dipl. Bergbauing. TU, VersuchsStollen Hagerbach AG, Andrea Stefan Koch, dipl. Bauing. FH, VersuchsStollen Hagerbach AG, José-Luis García-Siñeriz, Mining Engineer, Head of Engineering and Risks Department, AITEMIN, Ignacio Bárcena, Mining Engineer, Project Engineer, Engineering and Risks Department, AITEMIN ]TEC21, Fr., 2009.05.22
22. Mai 2009 Thomas Spillmann, Thomas Fries, Volker Wetzig, Andrea Stefan Koch, José-Luis García-Siñeriz, Ignacio Bárcena