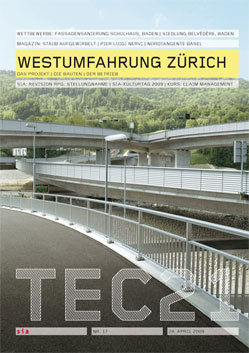Editorial
Die Nationalstrassen bilden das Rückgrat des schweizerischen Strassennetzes: 2.5 % übernehmen ein Drittel des Verkehrs.[1] Aktuell sind 1763.6 km Nationalstrassen in Betrieb und gemäss Netzbeschluss von 1960 insgesamt 1892.5 km geplant. Die zur Netzvollendung fehlenden rund 130 km sollen in den nächsten 15 Jahren gebaut werden.[2]
1971 wurden die nördliche und die westliche Umfahrung von Zürich in den Netzbeschluss aufgenommen. Nach Jahrzehnten der Planung und Projektierung, der Rechtsmittelverfahren und der Ausführung wird die Westumfahrung Zürich am 4. Mai 2009 nun endlich eröffnet. Sie verbindet die A1 Zürich–Bern mit der A3 Zürich–Chur. Damit kann der Ost-West-Durchgangsverkehr um die Stadt Zürich herumgeführt und diese vom Transitverkehr entlastet werden (siehe auch TEC21 40/2008). Im vorliegenden Heft wird das Gesamtprojekt «Westumfahrung Zürich» vorgestellt und auf einige markante Teilprojekte speziell eingegangen. Mit der Eröffnung der Autobahn A4 Knonaueramt im November 2009 wird auch die Lücke des Nationalstrassennetzes Richtung Innerschweiz geschlossen. Dieses Teilstück verbindet die Westumfahrung Zürich mit der A4 im Kanton Zug.
Seit dem Netzbeschluss von 1960 haben sich Mobilitätsverhalten, Besiedlung und Verkehrsaufkommen stark verändert. Als Folge davon sind die Autobahnen vielerorts an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangt. Die bestehenden Anlagen werden nun umgestaltet: Zusätzliche Fahrspuren oder Tunnelröhren wurden gebaut, Lärmschutzwände und Wildtierquerungen errichtet, Tunnelsicherheitsmassnahmen vorgenommen, neue technische Anlagen erstellt oder Anschlüsse neu gestaltet.[3]
In diesem Sinne wird auch die Nordumfahrung Zürich, die im Limmattal an die -Westumfahrung anschliesst, ausgebaut. Die Strecke zwischen der Kantonsgrenze -Zürich/Aargau und der Verzweigung Zürich West soll voraussichtlich im Jahr 2012 durchgehend auf zweimal drei Fahrstreifen befahrbar sein. Zu diesem Zweck wird eine dritte Röhre im Gubrist gebaut, die den Verkehr Richtung Bern und Basel aufnehmen und das Nadelöhr im Norden Zürichs entschärfen soll.
Daniela Dietsche
Anmerkungen:
[01] Bundesamt für Strassen (Astra): Strassen und Verkehr: Zahlen und Fakten 2008
[02] Hans-Ulrich Berger, Peter Güller, Samuel Mauch, Jörg Oetterli: Verkehrspolitische Entwicklungspfade in der Schweiz
[03] Monica Hediger: Strassenverkehr Schweiz 2009. Das Autobahnnetz anpassen und ausbauen
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Fassadensanierung Schulhaus, Baden | Siedlung Belvédère, Baden
15 MAGAZIN
Staub aufgewirbelt | Pier Luigi Nervi: Dichter und Techniker | Nordtangente BS entlastet Quartiere | 50 Jahre Tscharnergut | Tümmler: kurzfristig taub durch Sonar | Umweltbelastung durch Schiffe steigt
22 DAS GESAMTPROJEKT
Paul Meili
Die Westumfahrung Zürich verbindet die A1 mit der A3: ein Überblick über das Gesamtprojekt.
25 DAS DREIECK ZÜRICH SÜD
Walter Scherrer, Hans Vollenweider, Andreas Vogt
Die Sihlbrücken des Verkehrsdreiecks Zürich Süd bilden das grösste Brückenensemble im Kanton Zürich.
28 DER AESCHERTUNNEL
Christian Amstad, Hans-Martin Braun, Werner Schmid
Der Aeschertunnel ist der längste der drei Tunnels der Umfahrung Birmensdorf. Verschiedene Herausforderungen warteten auf die Beteiligten.
31 DER ÜETLIBERGTUNNEL
Otto Schnelli, Stefan Maurhofer, Michael Glättli, Josef Bolliger
Die Bauverfahren zur Durchörterung wurden der wechselhaften Geologie des Üetlibergs und des Ettenbergs angepasst.
34 BETRIEB UND SICHERHEIT
Roger A. Egolf
Die Westumfahrung ist mit modernen elektromechanischen und sicherheitstechnischen Anlagen ausgerüstet.
38 SIA
Revision RPG: Stellungnahme | SIA-Berufshaftpflicht-Versicherung | SIA-Kulturtag 2009| Kurs: Claim Management
43 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Das Gesamtprojekt
Im September 1996 erfolgte der Spatenstich für die West umfahrung Zürich. Nach einer mehr als zwölf Jahre dauernden Ausführungszeit können die Bauwerke am 4. Mai 2009 dem Verkehr übergeben werden. Damit sollen der Transit beschleunigt und viele Gemeinden vom Durchgangsverkehr entlastet werden.
Von den 10.6 km Autobahn der Westumfahrung von Zürich liegen 8.4 km, das heisst rund 80 %, in Tunneln. Die Autobahn A3 führt vom Bergermoos (Urdorf Süd) westlich um die Gemeinde Birmensdorf herum und unterquert die Geländeerhebungen in drei Tunneln (Eggrain-, Hafnerberg- und Aeschertunnel). Im Raum Wettswil am Albis wird sie im Verkehrsdreieck Zürich West (Fildern) mit der A4 aus dem Knonaueramt verknüpft, um anschliessend den Ettenberg und den Üetliberg als Üetlibergtunnel zu durchfahren. Im Gebiet Brunau (Verkehrs dreieck Zürich Süd) wird sie mit der A3 nach Chur bzw. der Stadt Zürich zusammengeschlossen. Mit dem Halbanschluss Uitikon im Gebiet Ristet, dem Anschluss Birmensdorf im Lunnerental, dem Anschluss Wettswil am Albis (integriert in das Verkehrsdreieck Zürich West) und dem Anschluss Zürich Brunau (kombiniert mit dem existierenden Teil des Verkehrsdreiecks Zürich Süd) stehen vier Anschlüsse zur Verfügung. Die für eine Ausbaugeschwindigkeit von 100 km/h projektierte Autobahn weist in jeder Richtung eine Fahrbahnbreite von 10.5 m mit je zwei Fahrstreifen und einer für Sonderbetriebszustände befahrbaren Standspur auf. Das Quergefälle beträgt in der Geraden 2.5 %, in den Kurven bis 5 %.
Südwassermolasse und Lockergestein
Die Tunnelstrecken durchqueren zu 75 % die Obere Süsswassermolasse. Charakteristisch für dieses Gebiet im Raum Zürich ist die Wechsellagerung von Sandstein-, Siltstein- und Mergelschichten mit allen Zwischenstufen. Die restlichen 25 % liegen in teilweise wassergesättigten Lockergesteinen, die aus verschwemmtem Gehängelehm beziehungsweise Gehängeschutt und Sandlinsen bestehen. Es handelt sich grösstenteils um Moränen. Diese sind kompakt, wenn sie von Gletschern überlagert wurden, ansonsten locker gelagert. Das anfallende Aushub- und Ausbruchmaterial, das im Projektgebiet keine Verwendung fand, wurde per Bahn zu Kiesgruben am Rhein in den nördlichen Teil des Kantons Zürich transportiert. Drei Bahnverladeanlagen in Urdorf Ristet, Fildern und Brunau standen zur Verfügung. Sie dienten auch der Anlieferung von Material und trugen dazu bei, Hunderttausende Lastwagenfahrten im Raum Zürich zu vermeiden. Für den Bau wurde die Westumfahrung in die drei im Folgenden beschriebenen Nationalstrassenabschnitte gegliedert.
Umfahrung Birmensdorf
Die 5.4 km lange Umfahrung Birmensdorf erstreckt sich von der Gemeindegrenze Urdorf / Birmensdorf bis Üetliberg West einschliesslich des Verkehrsdreiecks Zürich West und der Zufahrtsstrasse Sternen–Ristet (Verbindung zur Waldegg). Das Reppischtal wird mit zwei 210 m langen Brücken überquert. Vom Reppischtal ins Lunnerental durchquert die Autobahn den Hafnerberg. Das Lunnerental wird mit einer 130 m langen Zwillingsbrücke überquert. Im Zentrum des Anschlusses Birmensdorf liegen ein Retentionsbecken mit 50 000 m³ Fassungsvermögen, eine ökologische Strassenabwasser-Behandlungsanlage sowie eine Wildtierunterführung.lange Tagbaustrecke, in die die Lüftungszentrale Reppischtal integriert ist. Die maximale Überlagerung der Tunnelröhren beträgt 320 m. Die erstmalige Verwendung einer Tunnel bohr- Erweiterungsmaschine (TBE) mit dem damals weltweit grössten Fräsdurchmesser (14.4 m) war der Höhepunkt bei der Bauausführung.
Verkehrsdreieck Zürich Süd (Brunau)
Zum Verkehrsdreieck Zürich Süd (Brunau) zählen die Anpassung der bestehenden A3 bis zum Anschluss Wollishofen und die Überdeckung Entlisberg. Die Form des Verkehrsdreiecks Zürich Süd ist weitgehend durch die Lage des Ostportals des Üetlibergtunnels bestimmt. Es wurde so gelegt, dass alle Verkehrsbeziehungen über möglichst kurze Verbindungsrampen mit der bestehenden A3 und den Stadtzubringern verbunden werden konnten. Durch die hohe Lage der Rampen soll dem Sihlraum eine gewisse Transparenz erhalten bleiben.
Kosten und Bauprogramm
Die Gesamtkosten der A3-Westumfahrung von Zürich betragen rund 2.85 Mrd. Franken (siehe Kasten), die Bauzeit dauert ungefähr 12 ½ Jahre. Ein Teilabschnitt, die Umfahrung Birmensdorf, wurde im Jahre 2006 in Betrieb genommen. Anlässlich dieser Teileröffnung wurden der Eggraintunnel mit den Ein- und Ausfahrtstunneln Ristet (Halbanschluss Uitikon), die Reppischtalbrücke und der Hafnerbergtunnel dem Verkehr übergeben. Teile des Anschlusses Birmensdorf sind seither ebenfalls provisorisch offen. Die Eröffnung der Gesamtstrecke mit Aescher- und Üetlibergtunnel erfolgt nun rund 2 ½ Jahre später, am 4. Mai 2009.TEC21, Fr., 2009.04.24
24. April 2009 Paul Meili
Das Dreieck Zürich Süd
Die Sihlbrücken des Verkehrsdreiecks Zürich Süd bilden das grösste Brückenensemble im Kanton Zürich. Sie verbinden die neue Westumfahrung mit der bestehenden A3 Zürich–Chur. Die Frage, wie sich ein solches Grossbauwerk ökologisch abfedern lässt, prägte die Planung von Beginn an.
Im Naherholungsgebiet Allmend Brunau und im Naturraum Sihltal liegt das Verkehrsdreieck Zürich Süd. Zwei imposante Brücken schliessen hier den Üetlibergtunnel an die bestehende A3 an. Sie sind das Ergebnis einer über dreissigjährigen Planungsgeschichte, das grösste Brückenbauwerk im Kanton Zürich. Von Anfang an waren die Planer darum bemüht, Umweltund Verkehrsanforderungen im Sihltal «unter einen Hut» zu bringen. Doch die Vorstellungen davon, was als umweltfreundlich zu gelten hat, änderten sich im Lauf der Zeit beträchtlich. In den 1980er-Jahren wurde darüber diskutiert, grosse Dämme aufzuschütten, um so die Länge der Brücken möglichst stark zu reduzieren. Hauptsache grün und möglichst wenig Beton, war die Devise. Die Ingenieure prüften auch unterirdische Varianten, die jedoch den Sihl-Grundwasserstrom durchquert hätten. Das Generelle Projekt von 1986 legte schliesslich die heute sichtbare Lösung fest: ein raumgreifendes Brückenbauwerk, das die Landschaft prägt und der darunter fliessenden Sihl möglichst viel Freiraum lässt.
Leichtigkweit und Transparenz
Auf drei Ebenen verbinden die neu entstandenen Brücken den Üetlibergtunnel mit der bestehenden A3. Der überbrückte Flussraum sollte möglichst unverbaut und «transparent» bleiben: Die Sihl braucht Platz zum Mäandrieren und Fluten, der Flussraum durfte nicht durch Brückenpfeiler verstellt werden. Die Spannweiten der Brücken wurden deshalb vom Fluss bestimmt. Die Sihl und ihre Überflutungsebene wurden mit grosszügigen Feldern von 49 bis 52 m Länge überquert. Die Brückenpfeiler entlang der Sihl und im Überflutungsraum wurden parallel zum Fluss und zu den Höhenlinien angeordnet. So entstand ein offener, geordneter Raum. Hätte man die Pfeiler orthogonal zur Brückenachse orientiert – die statisch naheliegendere Lösung –, wäre ein verschachteltes Pfeilergewirr entstanden. Die Brückenfelder im Flussbereich sind leicht gevoutet von 2.4 m über dem Pfeiler auf 1.8 m Höhe im Feld. Die Vouten schaffen optisch deutlich mehr Raum über der Sihl und bilden den Verlauf der Kräfte ab. Ein weiteres Detail sorgt für eine optische Verschlankung: Die 80 cm hohen Leitmauern der Brücken erhielten aussen ein schmales Profi lband. Durch den so erzeugten Schattenwurf wirkt die Mauer graziler und die Brücke als Ganzes weniger massiv.
Wiederbelebung eines Flussraums
Ein Grossbauwerk wie die Sihlbrücken ist und bleibt ein massiver Eingriff in den Naturraum und in das Landschaftsbild. Ökologische Kompensationsmassnahmen waren deshalb ein wichtiger Bestandteil des Gesamtprojekts. Die Sihl verlief im Bereich der neuen Autobahnbrücken früher in einem künstlichen Flussbett, das unterschiedlich stark befestigt war. In Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Hydrologie, Biologie und Landschaftsarchitektur wurde der Talraum naturnah umgestaltet. Das Gelände unterhalb der Brücken wurde um bis zu 3.5 m abgesenkt, um die Barrierewirkung des Bauwerks optisch abzumildern und die Ausbreitungsmöglichkeiten von Flora und Fauna zu verbessern. Das künstliche Flussbett wurde aufgebrochen, Flutmulden, Böschungen und Kiesbänke wurden angelegt. So entstand ein kleinräumiges Mosaik von Lebensräumen. Bei Hochwasser hat die Sihl ausreichend Platz, um über ihre Ufer zu treten und ihr Flussbett selbst zu formen. Das entschärft auch die Hochwasserspitzen im nahen Zürich. Mit dem neu geschaffenen Flussraum hat das Naherholungsgebiet Allmend Brunau an Attraktivität gewonnen. Der Erholungsraum wurde wie die umliegenden Wohngebiete mit Dämmen oder Lärmschutzwänden gegen den Verkehrslärm abgeschirmt.
Siedlungs- und Erholungsraum vereinigen
Ein Teilprojekt des Verkehrsdreiecks Zürich Süd wurde bereits 2005 eingeweiht: die Überdeckung Entlisberg. Seit ihrer Fertigstellung 1969 durchschnitt die A3 Zürich–Chur in einem bis zu 15 m tiefen Einschnitt die Landschaft und trennte den Siedlungsraum von seinem Grüngürtel. Mit dem Bau der Westumfahrung sollte die A3 auf sechs Spuren ausgebaut werden. Das hätte die Lärmbelastung in Wollishofen weiter verschärft. Die Zeit war damit reif für den lang gehegten Wunsch der Wollishofener, die Autobahn zu überdecken. Die Überdeckung Entlisberg lässt das Siedlungsgebiet Wollishofen wieder mit seinem Familiengarten- und Naherholungsgebiet zusammenwachsen. 200 000 m³ Ausbruchmaterial aus dem Üetlibergtunnel wurden für die Auffüllung dieses Einschnitts auf einer Länge von 550 m genutzt. Die so gewonnenen fünf Hektaren Landfläche wurden zu einem Naherholungsgebiet mit Familiengärten, Wald, Wiesen, Feuchtbiotop und Aussichtsplattform umgestaltet.TEC21, Fr., 2009.04.24
24. April 2009 Walter Scherrer, Hans Vollenweider, Andreas Vogt