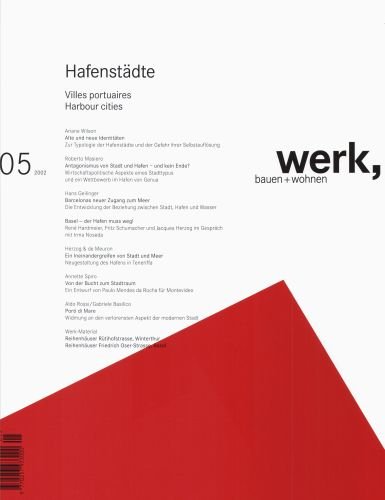Editorial
Alle Hafenstädte - nicht nur Amsterdam, Rotterdam oder London - sind im Umbruch. Die Umstellung des Schiffstransports auf Containerfracht hat die bestehenden Häfen wertlos gemacht und zum Bau von neuen, weit ausserhalb der Städte liegenden Anlagen geführt. Damit hat sich in den vergangenen zwanzig, dreissig Jahren die endgültige Trennung der Häfen von ihren Städten vollzogen. Viel stärker als die Verflechtung mit den lokalen und nationalen Wirtschafts- und Gesellschaftszentren wirkt sich jetzt die Einbindung des Hafens ins Netzwerk des globalisierten Handels und Konsums aus. Unversehens ist damit auch die spezifische Identität der Hafenstädte in Frage gestellt. Die grossen Lagerhäuser aus Backstein, bisher Inbegriff der Hafenarchitektur, sind überflüssig geworden. Manche haben sich inzwischen mit vielfältigen städtischen Nutzungen und auffallend viel Kulturbetriebsamkeit gefüllt, sind ganz Stadt geworden. Indes stapeln sich auf den immensen Lagerflächen der neuen Häfen die Container in täglich veränderten urbanen Formationen und machen augenfällig, dass die Warenlagerung mit der «Just-in-Time»-Produktion mobil geworden ist. An den «verlassenen» Städten liegt es nun, die Hafenbrachen zu urbanisieren. Das lässt an die Umnutzung innerstädtischer Industriebrachen denken. Dank ihrer Lage am Wasser aber haben diese Areale gegenüber üblichen Industriebrachen grosse Vorteile. Entsprechend viele Interessenten erheben Anspruch auf die privilegierten Areale, die der Stadt den Zugang zum Wasser zurückgeben. Nutzungsvorschläge reichen von Seepromenade und Wohnungsbau über luxuriöse Seafront-Bebauungen und repräsentative Geschäftsviertel bis zur Vergnügungsmeile in grossem Massstab. Wenn diese Areale nicht blosser Vermarktung anheim fallen sollen und die Chance einer innerstädtischen Stadtentwicklung genutzt werden soll, ist die Politik gefordert. Für Städtebau und Architektur eröffnet sich damit die Möglichkeit, mit den Mitteln ihrer Disziplin die Stadt grossräumig umzustrukturieren und das Verhältnis der Stadt zu Hafen und Wasser neu zu interpretieren.
Irma Noseda