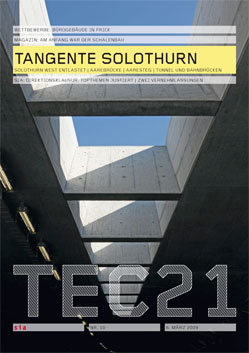Editorial
Viele Städte und Gemeinden in der Schweiz werden grossräumig von National- und Schnellstrassen umfahren. Trotzdem leidet die Mehrzahl von ihnen unter stetig wachsendem Durchgangsverkehr. Eine Umfahrung allein genügt offenbar nicht, um Ortschaften mit Verkehrsbeziehungen in verschiedenen Richtungen nachhaltig zu sanieren. Einer der Gründe dafür ist die historisch gewachsene, noch auf die alten Ortszentren ausgerichtete Strasseninfrastruktur: Die Mehrzahl der regionalen Verkehrsbeziehungen durchquert weiterhin die Ortszentren.
Die Stadt Solothurn ist ein typisches Beispiel dafür. Seit vier Jahrzehnten leitet die A1 den Transitverkehr weit südlich am Siedlungsgebiet vorbei, seit 2002 stellt die A5 eine Verbindung zwischen der A1 und Biel her, ohne Solothurn zu tangieren, und trotzdem vermochten das städtische Strassennetz und die zwei Aarebrücken das regionale Verkehrsaufkommen nicht mehr zu bewältigen. Was den drohenden städtischen Verkehrskollaps verhindern kann, war im Grundsatz schon seit den 1960er-Jahren bekannt: eine neue Verbindung zwischen den Strassen an der Aare im Süden und den Strassen am Jurasüdfuss im Norden der Stadt, westlich in der unüberbauten Ebene an der Stadt vorbei und mit einer neuen Brücke über die Aare.
Die neue Strassenverbindung, die im letzten Jahr dem Verkehr übergeben wurde, ist das Thema dieses Hefts. Die Projektverfasser stellen in ihren Beiträgen das Gesamtkonzept und die Bauwerke der Solothurner Westtangente vor. Neben den konstruktiven Aspekten wird dabei Wert auf die Gestaltung der Kunstbauten gelegt.
Die lange Projektgeschichte illustriert den Wandel der verkehrspolitischen Prioritäten in den letzten Dekaden: Am Anfang der Planung stand eine vierspurige, kreuzungsfreie und richtungsgetrennte Schnellstrasse. Entstanden ist endlich eine zweispurige, nicht richtungsgetrennte, mit moderater Geschwindigkeit zu befahrende und mehrfach mit dem lokalen Strassennetz verknüpfte Kantonsstrasse. Dafür hat der Langsamverkehr eine eigene Brücke über die Aare bekommen.
Als wesentlicher Teil des Konzepts berücksichtigt die neue Strasse die langfristige Stadtentwicklung. Parallel zur Planung der neuen Verkehrsverbindungen wurde auch die Nutzungsplanung der dadurch erschlossenen, potenziellen neuen Stadtteile in die Wege geleitet. In TEC21 3-4/2007 («Vor Ort») haben wir unter dem Titel «Weitblick in Solothurn» ausführlich über den Planungswettbewerb zur Entwicklung des neu erschlossenen Landes westlich der Altstadt berichtet.
Die ersten Erfahrungen mit der Tangente West zeigen die erwartete Verkehrsentlastung. In den nächsten Jahren wird sich erweisen, wie nachhaltig die Sanierung des Solothurner Verkehrsknotens ist und wie sich die neuen Stadtteile entwickeln.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Bürogebäude in Frick
13 MAGAZIN
Am Anfang war der Schalenbau
16 SOLOTHURN WEST ENTLASTET
Markus Dettwiler
Auch die Stadt Solothurn konnte kürzlich nach langer Planungszeit ihre Westtangente in Betrieb nehmen.
20 AAREBRÜCKE
Armand Fürst, Massimo Laffranchi
Das grösste Bauwerk der Solothurner Westtangente schont die Uferlandschaft der Aare und ihre Vorländer.
22 AARESTEG
Armand Fürst, Beat Petri
Die Fussgänger und Velofahrer im Westen Solothurns bekommen eine eigene, elegante Verbindung über die Aare.
24 TUNNEL UND BAHNBRÜCKEN
Martin Brotzer, Christian Birchmeier
Ein Tagbautunnel und zwei Brücken entflechten den Verkehr und sichern die Stadtentwicklung.
27 SIA
Direktionsklausur: Topthemen justiert | Zwei Vernehmlassungen
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Solthurn West entlastet
Lange Planung – kurze Bauzeit: Die Solothurner Westtangente ist ein typisches Beispiel dafür, wie der Takt der Realisierung der Verkehrsinfrastruktur von den langsam mahlenden Mühlen der Politik und nicht von der effizienten Arbeit bei Planung und Erstellung bestimmt wird. Das jetzt ausgeführte, mehrfach redimensionierte Projekt mit zwei bemerkenswerten Aarebrücken bestätigt aber auch eine alte Weisheit: Was lange währt, wird endlich gut.
Die Strassen im Stadtkern von Solothurn waren bis im vergangenen Jahr von einem starken regionalen Verkehrsaufkommen beansprucht, das sich über die beiden Aareübergänge Rötiund Wengibrücke drängte. Daran änderte auch die durchgehende Inbetriebnahme der A5 zwischen dem Anschluss an die A1 bei Luterbach und Biel-Ost am 18. April 2002 grundsätzlich wenig.
Bereits in den 1940er- und den 1950er-Jahren wurde immer wieder nach Lösungen gesucht, um das Verkehrsproblem durch eine westliche Umfahrung der Stadt in den Griff zu bekommen. Lange Zeit stand die Idee einer vierspurigen kreuzungsfreien Hochleistungsstrasse in unmittelbarer Stadtnähe – die «innere Westtangente» – im Vordergrund. 1972 wurde die konkrete Projektierung in Auftrag gegeben. Nachdem sich in der Bevölkerung eine starke Opposition gegen die geplanten Eingriffe in die Vorstadt gebildet hatte, wurde das Vorhaben fallen gelassen – aus heutiger Sicht wohl zu Recht. Die hierauf ausgearbeitete neue Linienführung entsprach etwa der heute realisierten (siehe die Übersicht in Bild 3) und wurde als Grund lage für die Festsetzung der Bau- und Strassenlinien genehmigt. Noch immer war eine vierspurige, richtungsgetrennte Anlage vorgesehen. Erst 1991 ist das Projekt auf den heutigen Umfang reduziert worden. Die Strasse sollte dabei neu neben dem Durchgangsverkehr auch der Erschliessung des Entwicklungsgebiets Obach / Mutten dienen. Nach weiteren sechs Jahren konnte das Projekt dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieses genehmigte es mit grosser Mehrheit, lehnte aber gleichzeitig die zur Finanzierung vorgesehene Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer ab. Eine zweite Vorlage im Jahr 2002, die auch die Umfahrung von Olten in die Finanzierung einschloss, fand eine knappe Mehrheit. Kanton und Stadt Solothurn schrieben in der Folge einen zweistufigen, anonymen Projektwettbewerb aus. Aus den 13 eingegangenen Projektideen der ersten Stufe wurden drei ausgewählt, deren Verfasser in der zweiten Stufe ein vollständiges Vorprojekt mit Honorarangebot einreichen konnten. Aus der Bewertung durch die Jury ging das Projekt «LEPORELLO» als Sieger hervor. Die Zuschlagskriterien waren gewichtet mit 30 % Angebot (Team und Preis) und 70 % Projekt. Bei Letzterem standen die Aspekte Städtebau und Landschaft, Verkehr sowie die statische und konstruktive Lösung der Kunstbauten im Vordergrund. Mitte 2006 konnte mit den Hauptarbeiten begonnen werden. Die Westtangente wurde am 08.08.2008 pünktlich um 08.08 Uhr dem Verkehr übergeben. Einem halben Jahrhundert Planung standen lediglich zweieinhalb Jahre Bauzeit gegenüber.
Funktion
Die Westtangente verbindet den A5-Anschluss Solothurn West im Süden der Stadt mit der Biel- und der Weissensteinstrasse im Norden (Bild 2). Sie übernimmt nacheinander die Verkehrsfunktionen Durchleiten, Abbremsen, Bewältigen und Verteilen (Bild 4). Entsprechend diesen Funktionen ist der Strassenraum unterschiedlich ausgebildet und gestaltet (Bild 3). Die Verkehrsteilnehmer, die mit hoher Geschwindigkeit von der Autobahn herkommen, sollen sukzessive auf die Innerortssituation im Nordabschnitt vorbereitet werden. Die hohen Trogwände der Aarebrücke (S. 20ff.) und die im Norden anschliessenden, analog gestalteten, massiven Lärmschutzwände lenken die Konzentration der Verkehrsteilnehmer auf die Strasse. Sie geben die Sicht auf die umgebende Landschaft nicht frei. Einzig die ausserhalb der Lärmschutzwände angeordneten, auf dem Niveau des umgebenden Terrains gepflanzten Baumreihen sollen das Abtauchen in die Ebene Obach / Mutten bewusst machen. Anschliessend weitet sich das Blickfeld auf die einmündenden Sammelstrassen am Knoten Obach (Bild 3 Mitte). Kurz nach dem Knoten sinkt die Strasse unter Terrain ab – die Verkehrsteilnehmer werden mit der Einfahrt in den Tunnel Gibelin (Tunnel und Bahnbrücken S. 24) weiter abgebremst und auf die folgende, grundlegend andere Verkehrssituation vorbereitet: Ab dem Tunnelausgang Nord erwarten sie städtische Verkehrsverhältnisse mit Gemischtverkehr, Fussgängern und Buslinien und einer kurzen Abfolge von Knoten. Der gewünschte Takt des sukzessiven Umstellens des Verkehrsregimes wird unterstützt durch entsprechend geregelte Lichtsignalanlagen und den Kreisel an der Bielstrasse (Bild 3 rechts). Die Gestaltung übernimmt diese unterschiedlichen Funktionen der Strasse.
Gestaltung
Zu den tragenden Gestaltungsprinzipien des Projekts gehört auch die Schonung der bestehenden Ufergestaltung der Aare durch zurückgezogene Brückenwiderlager. Die Aarebrücke folgt der Linienführung des schnellen Strassenverkehrs und überquert die Flusslandschaft als Strassenviadukt. Sie zieht sich weit in die Vorländer hinein und tangiert den Flussraum und die Ufer nur minimal. In diesem Bereich wird auf einen Damm verzichtet, um eine möglichst grosse Transparenz zu gewährleisten. Diesem Zweck dienen auch die Stellung der Brückenpfeiler, die Ausbildung der Widerlager des Aarestegs (S. 22 ff.) und die Gestaltung der Flächen unter der Aarebrücke. Die Pfeilerstellung und die Querrippen an der Untersicht der Brücke nehmen Bezug auf die durch die Aare und die Strassen dominierte Landschaft (Bilder 1 und 3). Im Gewerbegebiet um den Knoten Obach wird die Strasse zum Bestandteil der Landschaft. Bepflanzungen auch entlang der Querstrassen unterstützen dies. Im Bereich des Tunnels Gibelin soll in Zukunft ein Wohn- und Erholungsgebiet entstehen. Der Tunnel verhindert, dass dieses Gebiet durch eine Strassenschneise zerschnitten wird. Die Westtangente wird dort durch die Fortsetzung der für die Landschaft zwischen Jurafuss und Aare typischen, alleeartigen Baumreihen visuell bewusst gemacht. Im Gegensatz zur Strassenbrücke wurde die 150 m flussabwärts der Westtangente angelegte Fussgänger- und Veloüberquerung der Aare als Brücke im eigentlichen Sinne konzipiert (S. 22ff.). Als direkte Verbindung der Aareufer überquert sie den Fluss rechtwinklig. Sie ist Bestandteil einer neuen, parallel verlaufenden Verbindung für den Langsamverkehr. Die Massstäblichkeit der beiden Brücken ist grundsätzlich verschieden und entspricht der Geschwindigkeit und der Art der jeweiligen Nutzung: Der Strassenviadukt grosszügig und grossmassstäblich, die Fussgängerbrücke filigran und feinmassstäblich.
Erwartungen erfüllt
Verkehrserhebungen zeigen, dass nur wenige Monate nach Inbetriebnahme täglich bereits bis zu 28 000 Fahrzeuge die Solothurner Westtangente benutzen. Auf den Alternativrouten ist eine Verkehrsabnahme um bis zu 30 % zu verzeichnen. Die Sperrung der Wengibrücke für den motorisierten Individualverkehr (siehe Bild 2) als die wichtigste der zahlreichen flankierenden Massnahmen unterbindet den Durchgangsverkehr in der Altstadt komplett. Damit ist der Grundstein für eine neue Entwicklungsphase in diesem attraktiven Siedlungsgebiet gelegt. Die Erwartungen an die Westtangente haben sich diesbezüglich erfüllt.TEC21, Fr., 2009.03.06
06. März 2009 Markus Dettwiler