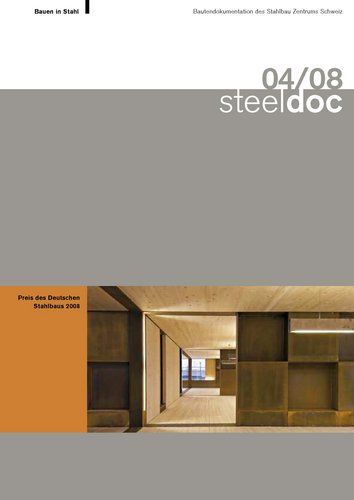Editorial
Die Schweiz hat den Prix Acier – und Deutschland hat den Preis des Deutschen Stahlbaus. Er ist einer der ältesten Architekturpreise Deutschlands und wird alle zwei Jahre von «Bauen mit Stahl» vergeben. So vielfältig wie das grosse, den meisten von uns recht unbekannte Deutschland ist seine Architekturlandschaft. Eine deutsche Architektursprache gibt es so wenig wie einen gemeinsamen Dialekt. Wie die Schweiz, hat Deutschland seine Architekturschulen, die sich meist im Einfluss ihrer Meister und grossen Professoren bewegen. So galt der Süden bislang als das Land der modernen, teilweise sperrigen Stahl- und Glasarchitektur – der Norden, insbesondere unter dem Einfluss der Berliner Schule, als das Land der Neo-Konservativen und gewichtigen Tektonen – derer also, die wieder im historischen Bewusstsein und im rechten Winkel auf deutschem Boden bauen. So hat Deutschland beides – und alles, was dazwischen liegt. Der Preis des Deutschen Stahlbaus spiegelt diese Haltung wieder.
Obwohl Deutschland auch heute noch eine bedeutende Stahlindustrie hat, ist das Bauen mit Stahl eher die Ausnahme als die Regel. Umso interessanter ist es, wie sich die deutsche Architektur in ihrer Polarität dem Baustoff Stahl annimmt. Zwar erhielt die neue BMW-Welt von Coop Himmelb(l)au eine Anerkennung, der Preis des deutschen Stahlbaus 2008 ging jedoch an ein für den klassischen Stahlbau relativ untypisches Projekt: das Werk- und Denklabor Pauker, dem deshalb in diesem Heft ein Schwerpunkt gewidmet ist. Während die BMW-Welt Stahl als Mittel zum Zweck benutzt – nämlich die freie, um nicht zu sagen frei erfundene Form des Gebäudes zu stützen – wird im Werk- und Denklabor der Stahl selbst zum raum- und strukturgebenden Element. Hier wie dort trägt der Stahl – doch im Werk- und Denklabor wird Stahl als tragendes Material auch formal zelebriert. Umso konsequenter wird dieser Akt, als dass die nichttragenden Elemente in Holz ausgeführt sind. Das Projekt ist deshalb auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit zukunftsweisend. Hier sind zwei ökologisch sinnvolle Baustoffe genau dort eingesetzt worden, wo sie ihre Stärke entfalten: Stahl in der tragenden Funktion, Holz in der raumbildenden.
Nachhaltiges Bauen in Stahl verkörpert auch ein weiteres Projekt in diesem Heft: das Montagezentrum ESTA – ein leichter, flexibel nutzund umnutzbarer Produktions- und Verwaltungsbau, der sich energetisch selbst versorgt. Dass er auch architektonisch überzeugt, hat ihm die Auszeichnung mit dem Preis deutschen Stahlbaus beschert. Wir dokumentieren in diesem Heft ausführlich vier der insgesamt zehn ausgezeichneten Projekte. Sechs weitere werden im Überblick vorgestellt. Auffallend ist eine merkliche Freude deutscher Architekten und Ingenieure an der Materialität des Stahls und an seinem ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Einsatz. Der Ernst der alten Meister scheint bei der Schüler-Generation einer gewissen intellektuellen Leichtigkeit gewichen zu sein.
Wir wünschen unseren Lesern viel Freude und Leichtigkeit bei der Lektüre und dem Studium der folgenden Seiten von Steeldoc.
Inhalt
03 Editorial
04 Werk- und Denklabor Pauker, Friedberg
Denkanstoss im Quadrat
12 ESTA Montage- und Verwaltungszentrum, Senden
Leicht – flexibel – sparsam
18 Mensa Adolf Weber- und Rupprecht-Gymnasium, München
Kostprobe
22 Hauptpforte Firma Trumpf, Ditzingen
Kompetenz in eigener Sache
26 Weitere Preisträger
31 Impressum
Denkanstoss im Quadrat
(SUBTITLE) Werk- und Denklabor Pauker, Friedberg
Vom gelernten Schlosser zur High-Tech-Ideenschmiede – die Liebe zum Stahl ist dem Bauherrn geblieben. Mit der Architektin Regina Schineis realisierte er das «Werk- und Denklabor» im Businesspark am Friedberger See bei Augsburg: aussen spiegelnd und glatt, erschliesst sich der besondere Charme des aussergewöhnlichen Gebäudes erst im Inneren.
Der Name «Werk- und Denklabor» kommt nicht von ungefähr: von der Glühfadeneinfädelmaschine bis zur 3D-Kamera entwickelt das Mitte der 1980-er Jahre gegründete Unternehmen Prototypen für spezielle Aufgaben in der Medizintechnik, Sensorik und Sondermaschinen für Fertigung und Qualitätskontrolle. Der zweigeschossige Industriebau auf quadratischem Grundriss präsentiert sich von aussen glänzend und glatt. Doch schon hier kommt das spezielle Material, der wetterfeste Stahl, mit seiner stumpfen Oberfläche und seinen farblichen Variationen ins Spiel: Die gläserne Hülle wird gezielt von Öffnungselementen durchbrochen, die mit wetterfestem Stahl beplankt sind. Die raue, dennoch warm und lebendig anmutende Stahloberfläche prägt, zusammen mit sägerauem Holz und dem geschliffenen, roh belassenen Betonboden in der Werkstatt, auch den Charakter der Innenräume.
Die Summe der Quadrate ergibt das Ganze
Der Reduktion auf wenige Materialien – Stahl, Glas, Holz, Beton – entspricht die Reduktion der Form: auf das Quadrat. Die Grundfläche des 23,20 Meter langen und 8,30 Meter hohen Industriebaus ist in drei mal drei annähernd gleich grosse Quadrate aufgeteilt. Vertikal wird das Gebäude von vier Achsen stählerner, zweigeschossiger Tragwerksrahmen gegliedert, die, gleichsam Schotten, jeweils drei Felder entlang ihrer Kanten zu einem Bereich zusammenfassen. Horizontal werden die Rahmen in der Deckenebene über dem Erdgeschoss durch einen geschweissten Stahlträgerrost zusammengeführt, der auf gefalteten Wandsegmenten aus wetterfestem Stahl aufliegt. Die Stahlplatten wurden so gekantet, dass sich – analog zum Grundriss – wiederum Quadrate ergeben.
Von der Stütze zur Fläche
Die sichtbar gelassenen, nahezu skulptural wirkenden Kassettenwände prägen das Werklabor im Erdgeschoss. Auch hier orientiert sich die Grundstruktur am quadratischen Raster. Die tragende Konstruktion, die «Stütze» des Skelettbaus, wird als flächiges Element neu interpretiert. Dadurch bekommt das Tragwerk eine zusätzliche Funktion: es wird zum Raum gestaltenden Element. Aus Kostengründen wurde ein Konzept erarbeitet, welches durch das Kanten der Blechtafeln mit einer Materialstärke von nur acht Millimeter auskommt.
Vom offenen Raum zum offenen Denken
Über eine Holztreppe mit sägerau belassenen Stufen aus Weisstanne gelangt man ins Obergeschoss. Hier gruppieren sich um einen zentralen Besprechungsraum die verschiedenen Bürobereiche, die mit Glasschiebetüren voneinander getrennt werden können. Es gibt keine Hierarchie der Räume, ihre Nutzung kann flexibel den Anforderungen des jeweiligen Projektteams zugeordnet werden. Die offene Raumstruktur ermöglicht einen Gedankenaustausch, der mit der Unternehmensphilosophie von Fritz Pauker Ingenieure konform geht.Steeldoc, Do., 2009.03.19
19. März 2009 Martina Helzel, Anne-Marie Ring
Leicht – flexibel – sparsam
(SUBTITLE) ESTA Montage- und Verwaltungszentrum, Senden
Inmitten eines architektonisch wenig ansprechenden Gewerbegebiets entstand ein gläserner Kubus, der Gestaltung, Konstruktion und technische Gebäudeausrüstung zu einem überzeugenden Ganzen verbindet. Der aussergewöhnliche Industriebau steht für die Unternehmenswerte Innovation, Kommunikation und Transparenz.
Das neue Verwaltungs- und Montagezentrum von ESTA Apparatebau verzahnt die Bereiche Verwaltung, Entwicklung und Produktion. Im Erdgeschoss des sechsstöckigen Neubaus befindet sich die Montage der Grossgeräte, die von einer umlaufenden Galerie aus einsehbar ist. Den kommunikativen Mittelpunkt des Unternehmens bildet das zentrale Atrium, das die oberen vier Geschosse verbindet. Die beidseits angeordneten, flexibel aufteilbaren Flächen werden im 1. Obergeschoss für die Kleingerätemontage genutzt, in den darüber liegenden Etagen sind Verwaltung und Konstruktion angesiedelt.
Konstruktion
Die Architekten nutzten die Vorteile des Stahlbaus, um die Auflast des über einem bestehenden Kellergeschoss angeordneten Neubaus so gering wie möglich zu halten. Zudem konnte so das Erdgeschoss stützenfrei ausgeführt werden: Fachwerkträger spannen über 17,95 Meter zwischen den vier Hauptstützen, auf denen das gesamte Gebäude ablastet. Zur Horizontalaussteifung bindet die umlaufende Galerie an Hauptstützen und Fachwerkträger an. Die vier Obergeschosse sind als Verbundkonstruktion von Stahl-Vierendeelträgern und Sichtbetondecken ausgebildet, die zusätzlich durch Verbände ausgesteift werden. Bei der Gestaltung der stark biegebeanspruchten Stahlknoten aus Vollmaterial konnte eine reduzierte und hocheffiziente Lösung realisiert werden. Ein neu entwickeltes Isolierglas reduziert denWärmeeintrag in das Gebäude. Hoher Sonnenschutz bei gleichzeitg maximaler Transparenz wird durch die Bedruckung mit einem feinen Netzmuster erreicht: dieses verdichtet sich zu den Geschossdecken und löst sich zur Scheibenmitte auf.
Innovatives Brandschutzkonzept
Die flächige Sprinklerung des gesamten Neubaus in Kombination mit einer VSG-Verglasung mit Seitenwandsprinklerung waren die Voraussetzung, um die vom Bauherrn angestrebte Transparenz auch über die Fluchtreppenhäuser hinaus fortführen zu können. Zu- und Abluftflächen in Fassade und Innenhof gewährleisten im Brandfall eine hinreichende Entrauchung des Verwaltungs- und Montagezentrums.
Energiekonzept
Das zukunftsorientierte Energiekonzept nutzt ausschliesslich regenerative Energien. Über Wärmepumpen wird Grundwasser zur Gebäudeklimatisierung herangezogen. Die für deren Betrieb erforderliche elektrische Energie liefern ein mit Rapsöl betriebenes Blockheizkraftwerk sowie die Solaranlage auf dem Dach des Neubaus. Durch Bauteilaktivierung werden die Geschossdecken im Winter zur Heizung und im Sommer zur Kühlung genutzt. Kühlsegel in den Deckenrandfeldern können bei Bedarf unterstützend zur Gebäudetemperierung hinzugezogen werden. Eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gewährleistet den erforderlichen Luftwechsel und die Behaglichkeit der Arbeitsplätze entlang der Fassade.Steeldoc, Do., 2009.03.19
19. März 2009 Martina Helzel, Anne-Marie Ring