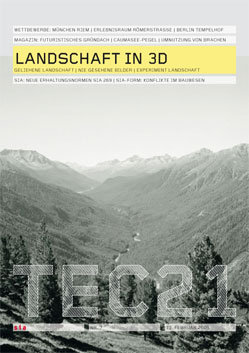Editorial
1884 veröffentlichte Edwin Abbott eine Kurzgeschichte unter dem Titel «Flatland: A Romance of Many Dimensions».[1] Der Protagonist der Geschichte, der Ich-Erzähler, lebt in Flatland, einer zweidimensionalen und unendlich weiten Welt. Entsprechend haben ihre Bewohner die Gestalt zweidimensionaler regelmässiger Polygone – Dreiecke, Quadrate, Hexa- und Pentagone. Dem Erzähler mit Namen A. Square, ist – nomen est omen – die Form eines Quadrats gegeben. Alles, was die Polygone sehen können, sind Linien, die von den Seiten ihrer Mitbewohner gebildet werden. Es gibt kein Oben und kein Unten – bis die dreidimensionale Kugel in A. Squares Leben tritt. Zunächst erscheint sie nur als Punkt, wächst sich dann, als die plane Ebene von Flatland den Äquator der Kugel passiert, zu einem Kreis aus, ehe sie sich wieder auf einen Punkt verdichtet. Da Flachländer nicht imstande sind, höhere Dimensionen zu imaginieren, «entführt» die Kugel A. Square nach Spaceland. Zusammen mit ihm erfahren wir das atemberaubende Erlebnis einer bisher unvorstellbaren Dimension.
Wer Debatten über die Auswirkungen von Bauten auf das Landschaftsbild beiwohnt, fühlt sich zuweilen «förmlich» nach Flatland versetzt. Während manche Architekten auf den Faktor Zeit in ihren Gestaltungen verweisen – mithin die vierte Dimension –, blenden wir die dritte aus, wenn es um die Landschaftsverträglichkeit eines Bauwerks geht: Wenn nur der «Fussabdruck» gering genug ist, wird es «zertifiziert» – als könnten wir die dritte Dimension nicht einmal imaginieren, geschweige denn sehen. Das ist erstaunlich in einem Land, dessen touristisches Kapital die Berge sind. Auch die Landschaft kann man nicht mit Hypotheken überfrachten. Dass das System kollabiert, wenn man auf Pump lebt, bedarf keiner Anschauung mehr – zumal, wenn man auf die folgenden Generationen setzt. Denn von ihnen ist die Landschaft geliehen.
Daher möchte man, um die Artikel in diesem Heft zu «gewichten», Abbott anstimmen: «Doch lebe ich in der Hoffnung, dass diese meine Erinnerungen [...] ihren Weg in die Gehirne der Menschheit irgendeiner Dimension finden und ein Geschlecht von Rebellen hervorbringen mögen, die sich weigern, sich in einer beschränkten Dimensionalität einschliessen zu lassen.»[2]
Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkungen
[1] Der Mathematikprofessor Ian Stewart publizierte 2001 den Roman «Flatterland: like flatland, only more so», in dem er das Prinzip von Abbotts Werk auf die Gegenwart überträgt. Protagonistin ist die Ururenkelin von A. Square, Victoria Line, die nun in null- und mehrdimensionale Welten, fraktale Geometrien, gekrümmte Räume und Raum-Zeit-«Gebilde» eingeführt wird.
[2] Abbott, Edwin A.: Flächenland – ein mehrdimensionaler Roman, verfasst von einem alten Quadrat, aus dem Englischen von Joachim Kalka. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart 1982, S. 239
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Letzter Bauabschnitt München Riem | Erlebnisraum Römerstrasse | Berlin Tempelhof – neue Rezepte
10 MAGAZIN
Futuristisches Gründach | Caumasee-Pegel wird ausgeglichen | Brachen: grosses Umnutzungspotenzial
16 GELIEHENE LANDSCHAFT
Hansjörg Gadient
Das Wort Landschaft bezeichnet sowohl das Bild selbst als auch seinen Gegenstand. Die lange Tradition der Landschaftsbetrachtung und -gestaltung zeigt in der Schweiz kaum Wirkung. Angesichts der Verstädterung fehlt es an einer Planung in der dritten Dimension.
22 NIE GESEHENE BILDER
Hansjörg Gadient
Der Künstler Florio Puenter schafft Bilder von Landschaften, wie sie nie ein Mensch gesehen hat. Er greift in das Naturbild auf eine Weise ein, dass die im doppelten Sinn verbrauchte Landschaft erhabener und ergreifender ins Bild gerückt wird denn je.
24 EXPERIMENT LANDSCHAFT
Annemarie Bucher
Mit dem Forschungsprojekt «Landschaft im Ballungsraum» postuliert die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ein Umdenken in der Landschaftsplanung: Experimentell und proaktiv soll sie sein sowie Wissenschaft und Praxis miteinander verbinden.
28 SIA
Neue Erhaltungsnormen SIA 269 | Brückenschlag ins 21. Jahrhundert | SIA-Form: Konflikte im Bauwesen
31 FIRMEN
32 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Geliehene Landschaft
Das Wort Landschaft, Paysage, Landscape bezeichnet in vielen Sprachen so wohl das Bild selbst als auch seinen Gegenstand. Die lange Tradition der Landschaftsbetrachtung und -gestaltung zeigt in der Schweiz bis heute keine Wirkung. Angesichts der zunehmenden Verstädterung und Zersiedelung fehlt es immer schmerzlicher an einer Landschaft splanung in der dritten Dimension.
«Geliehene Landschaft»[1] – Jie Jing – nennen die Chinesen seit über tausend Jahren eine Szenerie ausserhalb des Gartens, die von einem bevorzugten Ort innerhalb des Gartens aus zu sehen ist. Ihr Bild wird in dessen Gestaltung einbezogen. Schon der Garten selbst ist eine Abfolge von kunstvoll gestalteten dreidimensionalen Bildern, die über ein Wegenetz erschlossen wird. Diese Ansichten sollen sich dem Spaziergänger nach und nach zeigen, wie sich die Bilder auf einer Tuschrolle enthüllen. Das entwerferische Denken ist bildhaft und eng verknüpft mit der Malerei, die ihrerseits bestehende und imaginäre Gärten abbildet. Im 18. Jahrhundert gelangen erstmals Abbildungen von chinesischen Gartenan lagen[2] nach England und fördern dort die Mode des sino-englischen Landschaftsgartens.
Auch die zweite gartenarchitektonische Mode dieser Zeit, die Antike-Sehnsucht, ergeht sich in Bildern. Reisende bringen von ihrer Grand Tour nach Italien Ansichten von arkadischen Landschaften mit. Befördert von dem auch im Westen starken Bezug zwischen Malerei und Landschaftsarchitektur werden in den grossen Landschaftsparks solche Bilder nachgebaut. Man errichtet antikisierende Bauten, um Bilder der mediterranen Sehnsuchtsorte auferstehen zu lassen.[3] Während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts emanzipiert sich die Gartenarchitektur, vor allem mit den Arbeiten von Lancelot Brown, vom Diktat der Antike; auf Bauten und Statuen wird verzichtet, das Bild der Landschaft genügt ohne Verweis auf mythische oder geschichtliche Orte. Stattdessen widmet man sich ausschliesslich der Gestaltung der Landschaftselemente Topografie und Bepflanzung. Unter enormem Aufwand werden Seen ausgehoben, Hügel aufgeschüttet und Flüsse verlegt, um bestimmte Bilder zu erzeugen.
Wege durchziehen diese Landschaften und führen zu den schönsten Veduten. Die Bepflanzung dient zur Betonung der räumlichen Tiefe und dazu, malerische Effekte hervorzurufen. Aber sie wird auch genutzt, um hässliche Teile der sichtbaren Landschaft abzudecken. Wo Waldstücke oder Einzelbäume reizvolle Szenerien verdecken, werden sie entfernt.[4]
Vom zweidimensionalen Bild zur dreidimensionalen Landschaft
Die Idee, die Landschaft nach ästhetischen Kriterien umzugestalten, hat zwar auch in England nie den als Garten oder Park definierten Raum verlassen, aber die Dimensionen der Eingriffe sprengten den Begriff des Gartens durchaus. Für Europa ist dies einmalig. In China erreichten die Dimensionen der Gärten hingegen schon viel früher diejenigen einer Landschaft.[5] Aus der Gartengestaltung ist Landschaftsarchitektur geworden. Aus der Betrachtung und der zweidimensionalen Abbildung der Landschaft wird ein aktives dreidimensionales Umgestalten nach bildnerischen Kriterien.
Der Bündner Künstler Florio Puenter[6] hat fotografische Panoramen des Engadins geschaffen, in denen er Betrachtung und Veränderung verbindet (siehe «Nie gesehene Bilder», S. 22). Er bildet die Landschaft ab und greift in sie ein. Die entstandenen Bilder zeigen Landschaften vor dem Eingriff des Menschen: Geht es hier um die Sehnsucht nach der vollkommenen Natur? Enthalten darin ist der Schmerz über die Beeinträchtigung, wenn nicht Zerstörung dieser grossartigen Landschaft. Das Entfernen der zivilisatorischen Eingriffe macht ihre Erhabenheit wieder sichtbar. Die Idee und die Bilder sind grossartig; wegweisend ist der Ansatz: Landschaft muss wieder wahrgenommen und als Bild aktiv gestaltet werden – statt nur eine Fläche zu sein, die genutzt und verwaltet wird.
Planung im „Flachland“
Ein merkwürdiges Versäumnis der Planung wird hier sichtbar. Orts-, Regional- und Landesplanung sind mit wenigen Ausnahmen eine rein zweidimensionale Angelegenheit. Zonen werden definiert, Art und Mass der Nutzung festgelegt. Das alles passiert in der Regel nach rein ökonomischen und politisch-pragmatischen Gesichtspunkten. Was auf dem Massstab der Landschaft als Bild daraus resultiert, ist weder Gegenstand des Planungsprozesses noch des resultierenden Planes. Wie seltsam! Man stelle sich zum Vergleich einen Architekten vor, der nur die Grundrisse seines Gebäudes entwirft und die Fassaden den Handwerkern überlässt. Planung hat in der Schweiz einen schweren Stand, vor allem wo ihr ureigenstes Anliegen, die geordnete Entwicklung des Raumes, auf den harten Widerstand von finanziellen und politischen Interessen stösst. In der Verfassung und im Raumplanungsgesetz sind zwar hehre Ziele definiert, aber in der Praxis sieht es anders aus. Der Jurist Martin Bertschi weist in seiner Dissertation nach, dass die Bauzonen fast in allen Kantonen massiv und gesetzwidrig überdimensioniert sind und dass es vor allem am politischen Willen fehlt, diesen Missständen zu begegnen.[7] Nicht einmal das wichtigste Ziel, die Trennung von Bau- und Nichtbauzonen, wird erreicht. Wo stärkere Interessen wirken, kann Nichtbauland bebaut werden. Dafür sorgen von der Bauernlobby bis zu potenten Investoren eine lange Reihe ausschliesslich von Profitmaximierung Geleiteter. Bei Galmiz hat es trotz der Willfährigkeit aller beteiligten Behörden nicht funktioniert, beim Andermatter Resort des Spekulanten Sawiris schon.
Im letzten halben Jahrhundert haben wir mehr gebaut als in allen Jahrhunderten zuvor. Die damit verbundene Zersiedelung hat in breiten Kreisen der Bevölkerung zu Unwillen geführt. Die Landschaftsschutzinitiative ist eine Frucht dieser Entwicklung, und ihre Befürworter haben sich das Bild der Landschaft zum Argument gemacht. Ihr Ziel soll hier nicht debattiert werden, aber ihr Verdienst ist zweifellos, einen Missstand zum Thema zu machen, dem politisch und planerisch begegnet werden muss: das desolate Bild unserer Umwelt. Wir müssen uns um die Erscheinung unserer Landschaft kümmern. Nicht nur Aufteilung und Nutzung der Flächen dürfen die Planung leiten. Neue Fragen sind notwendig, so zum Beispiel: Wo soll die Kontur einer Siedlung verlaufen, damit sie als abgegrenzt und definiert erscheint? Welche Flächen müssen frei bleiben, damit Dorf, Stadt und Siedlung einen Rand haben? Wo könnten Aufforstungen Räume schaffen, die eine Landschaft wieder gliedern und strukturieren? Wo müsste zurückgebaut werden, wenn Einzelbauten, Industrie ruinen oder nutzlos gewordene Infrastrukturbauten die Landschaft beeinträchtigen? Ganz wichtig ist dabei auch eine erweiterte Sichtweise. Wo bisher praktisch ausschliesslich die bebauten Bereiche im Fokus standen, muss auch die Gestalt der nicht bebauten Bereiche definiert und geplant werden. Zuerst aber muss die Trennung von Bau- und Nichtbauzonen durchgesetzt werden. Mit der Schleifung der barocken Befestigungsanlagen um 1800 begann das Ausufern der Stadt auf die Landschaft, ein Prozess, der überhitzt und unumkehrbar zur heutigen Situation mit all ihren Schwächen und Problemen geführt hat. Nur prozesshaft kann die Landschaft weiterentwickelt werden. Ob allerdings die fatalistische Akzeptanz und die theoretische Über höhung der Agglomeration zur «Zwischenstadt»[8] oder «Metropolitanregion » genügen, ist zu bezweifeln. Das sind Worte und Ansätze, die kaum mehr zeigen als die Kapitulation vor dem Ist-Zustand.
Neue Sichtweisen und Instrumente der Planung sind nötig. Während Architekten bei planerischen Projekten oft Ansichten als Arbeitsinstrument nutzen, ist dies im normalen Planungsbetrieb höchst unüblich. Und das in einem Land, dessen bewegte Topografie zu einem bildnerischen Ansatz nicht nur verpflichtet, sondern geradezu einlädt. Wie könnten mit Bildern, Szenerien oder Veduten planerische Ziele und langfristige Prozesse festgelegt werden? Wie kann in einem so dicht besiedelten Land wie der Schweiz tatsächlich ein zukunftsfähiges Gleichgewicht zwischen baulicher und nichtbaulicher Nutzung gesichert werden? Die drei Aspekte der Nachhaltigkeit – ökologische, ökonomische und soziale – müssen um einen vierten, den ästhetischen, erweitert werden, wenn unsere Umwelt lebenswert bleiben soll.
In die Vertikale kippen verstellt den Blick über den Tellerand
Nötig ist nicht nur die Erweiterung der Arbeitsmittel, sondern auch der Betrachtungsweisen. Bisher ist das Bild der Landschaft fast völlig von ihrer Nutzung bestimmt. Das hat eine lange Tradition, auf die hier nicht eingetreten werden soll. Der Verbrauch an Landschaft durch Be bauung und deren Bewertung muss ein wichtiges Thema werden. Naiv wirkt die Äusserung von Thomas Held, Direktor von Avenir Suisse, zum geplanten Turm auf der Davoser Schatzalp: «Die vorgeschlagene [...] Lösung geht ja gerade von der Idee des Landschaftsschutzes aus. Die Schatzalp, die aufgrund der geltenden Bestimmungen mit den üblichen Chalets gesprenkelt werden könnte, soll von einer solchen Streusiedlung verschont werden.
Mit dem genialen Kunstgriff, das Volumen dieser Häuschen in einem Baukörper zusammenzufassen und gleichzeitig die horizontale Gestalt des alten Sanato riums beziehungsweise des bestehenden Hotels in die Vertikale zu kippen, wird die Alp als öffentlicher Erholungsraum und als Landschaft bewahrt [...].»[9] Held behauptet also, dass der Turm die Landschaft schütze, weil sein Fussabdruck im Vergleich mit niedrigen Bauten gleichen Volumens klein sei. Hier fehlt im Wortsinn der Blick über den Tellerrand. Der Turm wäre das ganze Landwassertal auf und ab sichtbar. Von allen umgebenden Bergflanken aus gesehen würde er die Davoser Landschaft dominieren. Der Verbrauch an bebautem Boden ist in der Tat gering, der Konsum an Landschaft aber enorm: ein ganzes Tal als Hintergrund für einen Bau. Dieses von ästhetischen Bedenken unbeleckte Verbrauchen von Landschaft ist die Regel und traditionell gewachsen. Der bäuerischen Gesellschaft der Schweiz war Landschaft Objekt der Nutzung bis zur Ausbeutung. So wurde beispielsweise im Unterengadin jahrhundertelang fast der gesamte Tannenwald abgeholzt und ins Tirol zum Salzsieden verkauft.[10] Die Lärchen, die die kahlen Hänge daraufhin als Pioniere wieder besiedelten, sind heute «typisch». Aber eigentlich sind es späte Zeugen eines Raubbaus.
Als im 19. Jahrhundert im Zuge der Entdeckung der Landschaft und ihrer Erhabenheit der Tourismus in die Berg- und Seenregionen Einzug hielt, bestückte man die Landschaften, die zu bestaunen die Fremden gekommen waren, ganz selbstverständlich mit den grössten Hotelpalästen, vorzugsweise an landschaftlich besonders exponierten Stellen. Landschaft war ja genug da, man dachte sich nichts dabei. Der Blick aus den Zimmern dieser Paläste zeigte eine spärlich besiedelte agrarische Landschaft, die als Idylle galt.
Wenn heute mit einer ähnlichen Attitüde ein Turm in die Alpenlandschaft gestellt werden soll, ist das ein Anachronismus, denn hundert Jahre später hat sich die Situation der Landschaft radikal geändert. Nur die rücksichtslos ökonomisierte Sichtweise ist dieselbe wie vor hundert Jahren geblieben. Immer stärker wird es aber um das Bild der Landschaft und dessen Wert gehen.11 Bereits gibt es Bestrebungen, den ästhetischen Wert der Landschaft mittels Rastern und Punktsystemen zu erfassen und zu ökonomisieren. Was «bringt» eine Landschaft als Erholungsraum, wie viel als Tourismusdestination? Aus dem Wert soll ein Preis werden, der Landschaft handelbar und Eingriffe «kompensierbar» macht.
Geliehen
Wie hoch ist der Verlust an Landschaft zu bewerten, wenn entlang der Anflugschneisen des Flughafens Zürich und auf exponierten Hügelkuppen entlang der Autobahn in Hektargrösse für Taschenmesser, Handyfirmen oder Möbelhäuser geworben wird?12 Wie viel darf oder muss eine Jurahöhe in ihrer heutigen Erscheinung kosten? Und wie viel vom Preis ist abzuschreiben, wenn man sie mit Windmühlen spickt? Wie niedrig müssten die Preise von Landschaft angesetzt werden, damit deren Beeinträchtigungen «bezahlbar», die Gewinne aus Energieertrag oder Werbung höher bleiben als die Kompensationszahlung? Die Idee ist absurd; Landschaft hat einen Wert, keinen Preis. Um sie zu entwickeln und zu schützen, muss ihre Erscheinung zu einem zentralen Argument ihrer Nutzung und Gestaltung werden. Wir zehren vom Kapital Landschaft. Statt sie klug zu nutzen, verbrauchen wir sie. Aber wir besitzen sie nicht, unsere Kinder und Enkel haben sie uns nur geliehen.
Anmerkungen
[1] Der Begriff der geliehenen Landschaft oder Szenerie, Jie Jing, erscheint in der Zeit der Nördlichen Song-Dynastie (960–1279 n. Chr.). Diese Epoche gilt als Zeit der Hochblüte der chinesischen Gartenkultur. Zum Begriff selbst s.borrowed landscape in: Patrick Taylor. The Oxford Companion to the Garden. S. 55. Zur Entwicklung der chinesischen Gartentradition s. «Die Gärten Chinas», in: Penelope Hobhouse. Der Garten. Eine Kulturgeschichte. London 2002. S. 319 ff .
[2] 1724 bringt der Missionar Matteo Ripa 36 Kupferstiche des kaiserlichen Sommer palastes in Chengde nach England
[3] Im Park von Wörlitz liess Fürst Friedrich Franz von Anhalt-Dessau sogar den Vesuv in Miniaturform nachbauen, der richtig Feuer spucken konnte. S. Frank Maier-Solgk und Andreas Greuter in Landschaft sgärten in Deutschland. Stuttgart 1997. S. 76
[4] (…) so much Beauty depending on the size of the trees and the colour of their leaves to produce the effect of light and shade so very essential to perfect in a good plan: as also the hideing of what is disagreeable and whewing what is beautifull (…) (sic) Lancelot Brown in einem Brief an einen Auftraggeber. Zit. In: Elli Mosayebi und Christian Müller Inderbitzin: The Picturesque – Synthese im Bildhaften. Pamphlet Nr. 9 des Instituts für Landschaftsarchitektur. Professur Christophe Girot. S. 32
[5] S. Hobhouse. Der Garten. Op.cit.
[6] Vgl. Thomas Kaiser. Kunstrenaturierung. In: Bündner Tagblatt vom 1. April 2006. S. 18
[7] Vgl. Martin Bertschi: Die Umsetzung von Art. 15 lit.b RPG über die Dimensionierung der Bauzonen: Bundesrecht, föderalistische Realität und ihre Wechselwirkungen. Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Nr. 144, Zürich 2001
[8] gl. Thomas Sieverts. Zwischenstadt. Basel, Boston, Berlin 1997
[9] Thomas Held. Ein Leuchtturm für die Verdichtung. In: Anthos Nr. 2, 2008. S. 52
[10] S. Christian Küchli: Wurzeln und Visionen. Promenaden durch den Schweizer Wald. Aarau, Stuttgart 1993. S. 104 ff .
[11] Zur Wahrnehmung von Landschaft vgl. Lucius Burckhardt: Warum ist Landschaft schön? Die Spaziergangswissenschaft. Kassel, o. J.
[12] Vgl. Tages-Anzeiger vom 15. Juli 2008TEC21, Fr., 2009.02.13
13. Februar 2009 Hansjörg Gadient
Nie gesehene Bilder
Florio Puenter[1] schafft Bilder von Landschaften, wie sie nie ein Mensch gesehen hat. Als Standorte für seine Fotografien wählt er Positionen und Ausschnitte, die vor ihm schon viele Maler oder Fotografen genutzt haben. Er bildet Landschaften ab, wie sie von Plakaten und Postkarten seit Langem bekannt sind. Es sind Motive, deren Häufung ihren Inhalt verbraucht hat bis zu Überdruss und Unsichtbarkeit. Seine Eingriffe verwandeln sie zu Bildern, in denen die im doppelten Sinn verbrauchte Landschaft wieder erscheint, unberührt, grösser, erhabener und ergreifender als in allen ihren früheren Abbildungen.
Das Vorgehen ist einfach. Der Künstler entfernt die Spuren der Zivilisation. Er radiert die Häuser, Bahnen und Strassen aus; auf die Weiden und Äcker pflanzt er Fichten, Arven und Lärchen. Es sind Landschaften des Engadins, die er so in einen Zustand versetzt, wie ihn vielleicht einmal die allerersten Siedler gesehen haben könnten, lange bevor es Medien der Abbildung gab und lange bevor Menschen begannen, die Landschaft als Bild wahrzunehmen. Der Blick schweift von Muottas Muragl (Bild 1) über das Oberengadin; wo sonst die Dörfer von St. Moritz, Silvaplana und Sils dem Auge Anhaltspunkte geben, sind im dichten Wald nur die Seen und der Fluss zu sehen, Seen und ein Fluss, die keine Namen haben, weil es niemanden gibt, der sie benennt. So hat diese Landschaft vor dem Menschen ausgesehen, und so wird sie aussehen, wenn sich – nach langer Zeit von Verfall und natürlicher Sukzession – der Wald wieder alle Standorte zwischen Seeufer und Waldgrenze zurückerobert haben wird. In einer Zeit, wo es wieder keine Menschen geben wird.
Ein Bild zeigt den Blick vom Julierpass hinunter auf St. Moritz: eine Bergkette, zu deren Füssen die Topografie in flachere Formationen übergeht, an der tiefsten Stelle ein See, scheinbar klein wie ein Teich. Es fehlen die Hochhäuser, die Wohnblöcke, die Hotelpaläste. Es fehlt jeder massstäbliche Anhaltspunkt von Bauten. Keine Bahnen schneiden sich in die Berghänge, keine Strassen winden sich durch die Ebene. Sichtbar werden die Konturen der Bergflanken, der langsame Übergang des Waldes in Magerrasen und darüber der nackte Fels. Sichtbar werden die kühle Luft und die Erosion an einem der Hänge. Sichtbar wird die sanfte Wellenbewegung der Hügel. Und das Bild führt über seine Ränder hinweg weiter; die Landschaft setzt sich unendlich weit fort. Es ist ein Bild, das zeitlich und räumlich über alle menschlichen Begrenzungen, Kategorien, Namen und Orte hinausführt.
Ein Bild (Bild 3) zeigt einen kahlen Felsen vor einer kegelförmigen, dicht bewaldeten Bergflanke: Schloss Tarasp ohne Schloss. Wo nichts ist, ist des Bildes Brauchbarkeit.[2] Ein anderes (Bild 2) zeigt eine Flussaue, aus der sich wie eine Insel ein flacher Felsrücken erhebt, von einem Tannenhain besetzt: der Kirchhügel von San Gian bei Celerina, ohne Kirche. Schloss Tarasp und die Kirche San Gian sind uralte Orte der Kultur. Seit Generationen sind diese Landschaften von den Gebäuden besetzt und nicht mehr von ihnen zu trennen. Aber wo die längst zu Bild motiven gewordenen Bauten den Blick nicht mehr binden, wird er frei, die Landschaft zu sehen.
Der Künstler sieht seine Arbeit nicht als Zivilisationskritik. Diese Vermutung läge bei einigen Arbeiten nahe, die zwischen Naturzustand und menschlichem Eingriff changieren. Es gibt ein Panoramabild in vier Teilen, auf dem das ganze Engadin zu sehen ist. Darin sind zwar alle Häuser und Infrastrukturbauten entfernt, aber die Wiesen sind nicht bewaldet. Es ist ein seltsames Bild von einem Zustand, in dem unsichtbare Menschen eine agrarisch geprägte Landschaft mit Weidewirtschaft pflegen. In einem anderen Bild (Bild 5) sieht man den Ort, wo das Dorf Silvaplana stehen würde. Die Häuser sind von den Wiesen entfernt, aber sie spiegeln sich wie ein irrer Traum noch immer im Wasser. Das offene Non-Finito dieser Arbeit zeigt den Prozess der Veränderung einer Landschaft. Zu sehen ist zugleich die Agrarlandschaft und was mit ihr durch Bauten geschehen ist. Das Entfernen der Bauten macht durch das Wieder-Erscheinen der Landschaft den Prozess des Verlustes von Landschaft sichtbar. Die Bilder zeigen aber auch das «Material» Landschaft, mit dem planerisch ganz anders umgegangen werden könnte. Diese Varianten von Puenters Arbeit betonen im Vergleich mit den völlig bewaldeten Panoramen die ergreifende Erhabenheit einer von zivilisatorischen Eingriffen entblössten Natur. Schon der Rauch des Lagerfeuers der ersten Siedler hat begonnen, diese Erhabenheit zu zerstören. Das ist paradox, denn Erhabenheit ist eine menschliche Kategorie, und ohne Betrachter gibt es sie nicht. Puenter macht uns zu paradoxen Betrachtern.
Er beschreibt sein Vorgehen als Korrekturarbeit. Er entferne, was ihn störe, so wie er einen Kratzer auf einem Negativ retuschieren würde. Wenn ihn die Spuren der Zivilisation stören, so folgt er einem inneren, idealen Bild einer Landschaft, deren Reinheit überwältigt. Dabei illustriert der Künstler nicht botanisch korrekt den mutmasslichen Urzustand. Er nimmt sich auch die Freiheit, im Vordergrund Waldstücke einzusetzen, wo es keine geben kann, um einem Bild mehr Tiefe zu geben. Die Bilder sind hochartifiziell, nicht um einen natürlichen Zustand zu zeigen, sondern eine Sehnsucht.
Es ist die ungeheure Sehnsucht nach der Verschmelzung mit dieser Natur. Genau das aber ist nicht möglich, denn nur ohne den Menschen sieht diese Landschaft so aus. Der Schmerz, der diesen Landschaftsbildern innewohnt, ist die Trauer des Betrachters, dass er so vollständig ausgeschlossen ist. Florio Puenter schafft Bilder von Landschaften, wie sie nie ein Mensch sehen wird.
Anmerkungen
[1] Florio Puenter (1964) ist im Engadin aufgewachsen. Er lebt und arbeitet im St.Moritz und New York. Seit 2000 beschäft igt ihn das Thema der Engadiner Landschaft. Er fotografiert mit einer Grossformatkamera analog und bearbeitet seine Bilder in zeitaufwendigen Verfahren am Computer und analog weiter. Ausstellungen im In- und Ausland.
[2] «Der Speichen dreimal zehn / Auf einer Nabe stehn. / Eben dort, wo sie nicht sind, / Ist des Wagens Brauchbarkeit.» Erste Strophe aus dem 11. Kapitel des Tao-Tê-King des Lao-Tse (Übersetzung von Günther Debon, Stuttgart 1961, S. 35)TEC21, Fr., 2009.02.13
13. Februar 2009 Hansjörg Gadient