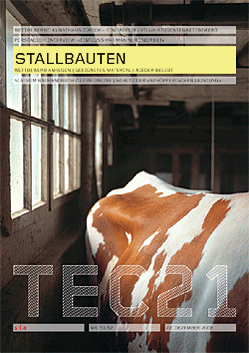Editorial
TEC21 widmet das letzte Heft des Jahres den Stallbauten. Aktuell ist das Thema in zweierlei Hinsicht: – 1977 wurde die Milchkontingentierung in der Schweiz eingeführt. Nach 32 Jahren wird sie am 30. April 2009 nach einer kurzen Übergangsphase abgeschafft. Die staatliche Produktionslenkung des Milchmarkts soll den Kräften von Angebot und Nachfrage überlassen werden und die Mengenregelung privatrechtlich erfolgen – so mindestens ist die Absicht des Parlaments.
Milchproduzenten sind gezwungen, ihre Betriebsauslegung und Produktionsmethoden zu hinterfragen und allenfalls neu zu gestalten. Die Artikel von Christof Baumgartner und Fredi Leuthold (S. 20 ff. und S. 23 ff.) geben Hinweise, wie Stallbauten idealerweise beschaffen sein sollten. Die Anforderungskriterien an die Bauten sind auf die Leistungsmerkmale der heutigen Züchtungen und auf einen möglichst wirtschaftlichen Betriebsablauf ausgelegt. Sie haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert. Eine Kuh des 17. Jahrhunderts gab beispielsweise etwa 700 kg Milch pro Laktationsperiode. Heutige Kühe liefern im Durchschnitt 6500 kg Milch.
Gegen Ende jedes Jahres erhält der Stall als Behausung – umgenutzt notabene – mit der Weihnachtsgeschichte eine besondere Bedeutung. Der Stall in der weihnachtlichen Erzählung diente den Protagonisten als ungewöhnliche Liegestatt, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Im Artikel «Wieder belebt» wird ebenso die Geschichte eines umgenutzten Stalles erzählt (S. 27ff.). An einem ungewöhnlichen Ort wird auf spezielle Weise ein Raum geschaffen, in dem der Bauherr Inspiration und Ruhe finden kann – nicht nur über die Weihnachtszeit.
In diesem Sinne wünscht die Redaktion der gesamten Leserschaft besinnliche Weihnachten, erholsame Feiertage und einen fröhlichen Jahreswechsel.
Clementine van Rooden