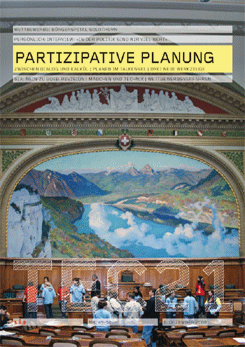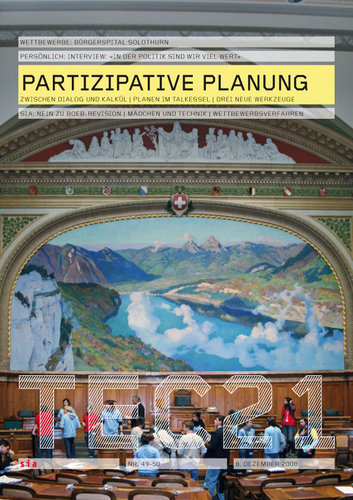Editorial
Wird Planung besser, wenn viele mitreden? Oder sollen das Volk und seine Vertreter nur Rahmenbedingungen vorgeben und das Planen Fachleuten überlassen? Die Antwort hängt davon ab, was mit Planung gemeint ist: Das Entwerfen von Gebäuden und Ingenieurbauwerken soll Sache der Spezialistinnen und Spezialisten sein. Auf übergeordneten Ebenen jedoch, in Stadt-, Orts- und Raumplanung, wo eben die Rahmenbedingungen der baulichen Entwicklung festgelegt werden, müssen möglichst viele mitreden können, wenn das Resultat nachhaltig sein soll. Das fordern die Vereinten Nationen: «Eine der Grundvoraussetzungen für die Erzielung einer nachhaltigen Entwicklung ist die umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus hat sich im spezifischeren umwelt- und entwicklungspolitischen Zusammenhang die Notwendigkeit neuer Formen der Partizipation ergeben. Dazu gehören die Mitwirkung von Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen an Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie ihre Unterrichtung und ihre Beteiligung an Entscheidungen, insbesondere solchen, die eventuell die Gemeinschaft betreffen, in der sie leben und arbeiten.» So steht es in Kapitel 23.2 der Agenda 21, die die Uno-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio verabschiedet hat.
Partizipation ist umständlich, aber mittel- und langfristig effizient. Durch den Einbezug aller Interessen wird nicht nur Akzeptanz für die Resultate der Planung geschaffen, sondern auch für deren reale Umsetzung. Das Design von mehrheitsfähigen Vorlagen ist jedoch nur der eine, mittelfristige Vorteil von Partizipation. Wenn sie ernsthaft betrieben wird, birgt sie noch eine zweite, langfristige Effizienz: Durch die Konsultation möglichst Vieler werden Erfahrungen aus allen Teilen der Gesellschaft gesammelt und damit Warnungen vor unintendierten Handlungsfolgen, Fehlern, Unachtsamkeiten, Rücksichtslosigkeiten und damit vor Sackgassen der Entwicklung. Darin liegt die eigentliche Effizienz oder eben Nachhaltigkeit von basisdemokratischer Kultur.
So weit die schöne Theorie. In der Praxis ist die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Laien schwierig. Im Bereich der Orts- und Raumplanung gibt es kaum Verfahren und Werkzeuge, die Laien verständlich sind und ihnen produktive Inputs ermöglichen. Ein Forschungsprojekt der ETH Zürich analysiert deshalb partizipative Planungen und entwickelt dabei tauglichere Instrumente. Lesen Sie dazu die Artikel von Lukas Kueng und Michael Martin. Philippe Cabane legt den Finger auf einen weiteren wunden Punkt: Noch zu selten gewähren Behörden und Experten partizipativen Prozessen effektiven Entscheidungsspielraum. Da helfen auch die besten Werkzeuge nichts.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Bürgerspital Solothurn
14 PERSÖNLICH
Interview: «In der Politik sind wir viel wert»
15 MAGAZIN
Minergie steigert den Marktwert | Gestaltungswille und Ordnungswahn | Sensible Fledermausohren
24 PARTIZIPATION ZWISCHEN DIALOG UND KALKÜL
Philippe Cabane
Mitwirkung der Bevölkerung macht Ortsplanung nachhaltiger. Doch nicht jede partizipative Planung wird ihrem Namen gerecht. Ein Überblick über die häufigsten Pannen.
27 PLANEN IM TALKESSEL
Lukas Kueng
Ein Forschungsteam der ETHZ begleitete die Planung im Talkessel von Schwyz, untersuchte deren Methoden und entwickelte neue Werkzeuge, die sich besser für partizipative Prozesse eignen.
31 DREI NEUE WERKZEUGE
Michael Martin
Regeln für einheitliche Pläne, maschineller Modellbau und ein Kartenset zur Prozessmoderation könnten schon bald partizipative Planungen erleichtern.
36 SIA
SIA sagt Nein zu BoeB-Revision | OTIA-Preis 2009 | Mädchen und Technik | SIA-Fachverein A&K | Wettbewerbe: sinnvolle Berechnungen?
41 FIRMEN
43 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Planen im Talkessel
Der Talkessel von Schwyz hat Nachhaltigkeitsdefi zite, wie sie für Agglomerationsgebiete typisch sind, und erwartet weitere Belastungen durch den Bau von A4 und Neat. Kanton und Gemeinden wollen dies als Chance für eine städtebauliche Transformation nutzen. Sie erarbeiten gemeinsam den Masterplan Rigi - Mythen. Ein Forschungsprojekt der ETH Zürich hat die Planung begleitet. Es untersucht die angewandten Methoden und entwickelt selber neue. Ziel ist, die Kommunikation zwischen den Fachleuten und mit der Bevölkerung zu verbessern.
Das Forschungsprojekt «Werkzeuge urbaner Morphogenese» unter der Leitung von Marc Angélil am Institut für Städtebau der ETH Zürich hat sich im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» mit der räumlichen Entwicklung von Agglomerationsgebieten beschäftigt (vgl. Kasten). Weil diese Gebiete grosse Nachhaltigkeitsdefi zite aufweisen, wurden die Mechanismen und Prozesse untersucht, die für die strukturelle und morphologische Entwicklung peripherer Regionen von Bedeutung sind. Das Forschungsprojekt richtete das Interesse auf das planerische und städtebauliche Handeln: Welche Werkzeuge stehen zur Verfügung, um die räumliche Entwicklung der gebauten Umwelt nachhaltiger zu gestalten? Im Rahmen einer Fallstudie ergab sich eine Zusammenarbeit mit dem Amt für Raumentwicklung des Kantons Schwyz. Am Beispiel eines konkreten Planungsprozesses im Talkessel von Schwyz konnten städtebauliche Werkzeuge entwickelt und getestet werden.
Kanton Schwyz sucht neue Wege
Der Kanton Schwyz möchte Transparenz, Information und Aufklärung zu einem festen Bestandteil der Planung machen. In der Richtplanergänzung für die Region Rigi - Mythen sollte die Sensibilisierung der Bevölkerung für Gründe, Herausforderungen und Möglichkeiten der räumlichen Entwicklung eine zentrale Rolle spielen. Ein öffentlicher Dialog über städtebauliche Entwicklung ist gerade in Gebieten am Rand der Metropolitanregion Zürich dringend nötig.
Die Region Rigi - Mythen umfasst das Gebiet zwischen Arth-Goldau am Zugersee und Brunnen am Urnersee mit dem Talkessel von Schwyz im Zentrum. Es kann als typisches Beispiel für die Probleme von Siedlungs- und Landschaftsräumen peripherer Regionen betrachtet werden: Zunahme der Wohnbevölkerung über die vergangenen Jahrzehnte, Zersiedelung der Landschaft, Infrastrukturengpässe im individuellen und öffentlichen Verkehr, weitgehend fehlende öffentliche Einrichtungen und zunehmende Bedrohung der Siedlungsgebiete durch Naturgefahren stellen Planung und Städtebau vor zahlreiche Herausforderungen.
Als Hauptprobleme werden in Schwyz der gegenwärtige Bau der Autobahn A4 durch das Knonauer Amt und die neue Eisenbahn-Alpentransversale (Neat) diskutiert. Die A4 wird vermutlich den Siedlungsdruck auf den Talkessel durch die verbesserte Anbindung an das Zentrum Zürich verstärken, was zu einer Intensivierung der geschilderten Probleme führen könnte. Nach der voraussichtlichen Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Jahr 2017 muss mit einer massiven Zunahme des Güterverkehrs durch den Talkessel gerechnet werden, was eine erhöhte Belastung für Umwelt und Bevölkerung und zahlreiche Nebeneffekte mit sich bringt. Die Kapazitätsansprüche der Transitachse könnten beispielsweise den regionalen Schienenverkehr verdrängen. Es muss auch damit gerechnet werden, dass durch den Ausbau der Neat-Zulaufstrecken verschiedene Grossbaustellen von teilweise jahrzehntelanger Dauer den Raum belasten werden. Es ist klar, dass solche auf nationaler und internationaler Ebene verankerte Infrastrukturvorhaben die planerischen Möglichkeiten der betroffenen Gemeinden übersteigen. Weil der kantonale Richtplan ein zu allgemeines und die Zonenpläne der Gemeinden zu spezifi sche Instrumente sind, um die genannten Herausforderungen anzugehen, wurde unter der Leitung des kantonalen Amts für Raumentwicklung und unter Einbezug aller betroffenen Gemeinden eine regionale Ergänzung des kantonalen Richtplanes für die Region Rigi - Mythen erarbeitet. Die Grundlage für diesen die Gemeindegrenzen überschreitenden Planungsprozess bildete ein sorgfältiges Aufklärungsund Informationskonzept. Es beschrieb die Entwicklung nicht primär als Bedrohung, sondern als Chance für eine städtebauliche Transformation des Talkessels.
Partizipation und eine öffentliche Ausstellung
Herzstück der Richtplanergänzung ist ein integratives städtebauliches Konzept für den Talkessel, in dem die Bereiche Siedlungsentwicklung, Infrastruktur, Landschaft und öffentlicher Raum in einen städtebaulichen «Masterplan Rigi - Mythen» integriert wurden. Im Unterschied zu anderen Richtplanungen wurde dabei bewusst die projekthafte Annäherung an den Raum gesucht. In regelmässigen Zusammenkünften zwischen dem Amt für Raumentwicklung, Gemeindevertretern und externen Fachplanern wurde ein räumlich flexibles und zeitlich offenes urbanes Richtprojekt erarbeitet. In mehreren Schritten gelang es, die Anliegen von zahlreichen Beteiligten und Betroffenen zu präzisieren und zu integrieren. In einer intensiven redaktionellen Begleitung wurden die Informationen und Gedanken laufend gesammelt, aufbereitet und visualisiert. Dadurch konnten unerwartete Synergien zwischen vermeintlich widersprüchlichen Anliegen erkannt und gefördert werden.
Nachdem diese regelmässigen Inputs konsolidiert worden waren, ging der Entwurf auf unkonventionelle Weise an die Öffentlichkeit. Unter dem Titel «Von der Talschaft zur attraktiven Voralpenstadt» eröffnete eine öffentliche Ausstellung im Forum für Schweizer Geschichte in Schwyz das Vernehmlassungsverfahren. Die Ausstellung vermittelte nicht nur Inhalte, sondern war als Plattform für den Austausch von Informationen und Ideen zwischen Politik, Behörden, Fachleuten und Bevölkerung angelegt. Ein Überblick über die historische Entwicklung der Region bildete die Grundlage für ein Verständnis der heutigen städtebaulichen Strukturen (Morphologie). Auf Video aufgezeichnete Stellungnahmen unterschiedlicher Akteure – vom Schulkind bis zum erfahrenen Raumplaner – dienten der Vermittlung der thematischen Vielfalt und der Komplexität planerischer und städtebaulicher Phänomene. Der «Raum» stand im Zentrum der Ausstellung: Auf weisse Modelle wurden unterschiedliche Entwicklungsszenarien, planerische Massnahmen und städtebauliche Eingriffe projiziert und so die Zusammenhänge von Siedlungs-, Infrastruktur- und Landschaftsentwicklung aufgezeigt. Mögliche Synergien, die heutige und künftige Dynamiken für die bewusste Transformation des Raums nutzen, wurden anschaulich dargestellt und erklärt. Vorträge, Diskussionsforen und Fragerunden mit den verantwortlichen Politikern und Planungsfachleuten rundeten das Angebot ab.
Die Ausstellung zog ein grosses Publikum an. Vielen wurde klar, dass die Entwicklungsdynamik ein Umdenken erfordert. Es wurde deutlich, dass sich die Schwyzerinnen und Schwyzer heute im regionalen Massstab bewegen, sei es auf dem Arbeitsweg oder in der Freizeit. So konnte vermittelt werden, dass Fragen der räumlichen Entwicklung jede und jeden etwas angehen und alle bewusst oder unbewusst Ansprüche an den Raum formulieren. Die Selbstwahrnehmung als Landregion muss einem neuen Leitbild weichen, das den Talkessel und seine spezifi schen Qualitäten in einem metropolitanen Gesamtzusammenhang begreift. Anstatt auf ein schnelles «Durchdrücken» des Richtplanentwurfs zu setzen und Einsprachefristen möglichst unbemerkt verstreichen zu lassen, wählte der Kanton damit ein auf Verständnis ausgerichtetes Vorgehen. Gerade weil langfristige und vernetzte Strategien meist nicht so einfach zu erklären sind wie kurzfristige und reaktive Massnahmen, mussten den Betroffenen auch die Hintergründe und Überlegungen zu den vorgeschlagenen Vorgehensweisen dargelegt werden.
Anschauliche Werkzeuge
Kantonale Richtpläne sind zwar darauf ausgelegt, überkommunale Planungsprozesse zu koordinieren und zu steuern. Doch bleiben die Massnahmen in Form und Inhalt oft sehr abstrakt. Die Erfahrungen in Schwyz haben gezeigt, dass als Ergänzung zu den institutionalisierten Verfahren Wege gefunden werden müssen, wie räumliche Entwicklungen und die Auswirkungen planerischer und städtebaulicher Strategien auch für Laien veranschaulicht werden können. Zu diesem Zweck hat die Forschungsgruppe Instrumente und Methoden entwickelt und im Lauf der Planung in Schwyz testen können (vgl. dazu den folgenden Artikel).TEC21, Do., 2009.01.15
15. Januar 2009 Lukas Kueng