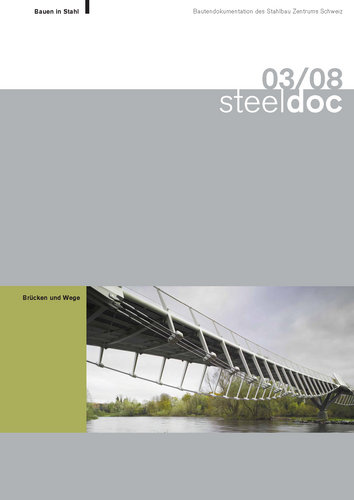Editorial
Die erste Eisenbrücke entstand 1779 in England. Es war eine einfache Bogenbrücke über den Severn River, die von ihrer Form her auch in Stein hätte gebaut sein können. Der grosse Unterschied: die Transparenz der Tragstruktur. Noch heute fasziniert diese „Iron-Bridge“ durch ihr filigranes Ornament, das nichts anderes ist, als eine elegante Ableitung der Kräfte. Als Inbegriff der Ingenieurbaukunst ist der Brückenbau in Stahl ein Experimentierfeld für mannigfache Tragwerkstypologien. Es gibt Bogenbrücken, Hängebrücken, Fachwerkbrücken, Balkenbrücken Schrägseilbrücken und so weiter. Jede ist ein Unikat, denn nebst der Typologie ist der Ort über den die Brücke führt, prägend für ihre Form und die Brücke wird ihrerseits prägend für den Ort.
Im vorliegenden Steeldoc haben wir eine Auswahl neuerer Fussgänger- und Strassebrücken getroffen, die etwas Besonderes sind - bei denen sich Ingenieure und Architekten der Eigenheit des Ortes gewidmet haben, um das Überqueren zum Ereignis werden zu lassen. Dabei sind die Fussgänger- und Radbrücken meistens expressiver, als die Strassen- und Bahnbrücken, bei denen die Verkehrsfunktionalität im Vordergrund steht. Spektakulär sind Brücken im Alpengebiet, wo sich Abgründe auftun und Felswände erheben. Aber auch in Flachgebieten kann eine Brücke zu einem skulpturalen Ornament für die Landschaft werden oder zu einem identitätsstiftenden Teil des Stadtbilds. Obwohl die Schweiz als Brückenland gilt, haben wir uns auch einen Blick ins übrige Europa erlaubt. Von insgesamt zehn Brückenportraits, stammen vier aus der Schweiz. Einen Überblick der neueren Schweizer Stahlbrücken bieten die letzten Seiten.
Eine Neuerung hat sich bei diesem Heft im Redaktionsteam ergeben. Recherchiert, getextet und gestaltet wurde diese Ausgabe von einer erfahrenen kleinen Agentur namens Circa Drei. Die Texte und Detailpläne gehen denn auch hauptsächlich auf die technischen Details des Brückenbaus ein, um der Frage nachzukommen: wie funktioniert das denn genau? Wir wünschen viel Vergnügen und Erkenntnis bei der Lektüre der nachfolgenden Seiten von Steeldoc.
Inhalt
03 Editorial
04 Fussgängerbrücke in Limerick, Irland
Living Bridge
06 Dreirosenbrücke in Basel
Zweistöckig über den Rhein
10 Fussgängerbrücke bei Bennau, Schweiz
Tor nach Einsiedeln
12 Eisenbahnbrücke über den Twentekanal, Niederlande
Black Beauty
14 Fussgängerbrücke in Evry, Frankreich
Doppelhelix
16 Dreiländerbrücke in Weil am Rhein
Drei Länder – eine Brücke
20 Fussgänger- und Radwegbrücke in Amsterdam
Land in Sicht
22 Fussgängerbrücke und Ausstellungspavillon in Zaragoza
Brücke, Pavillon und mehr
26 Fussgängerbrücke in Negrentino, Schweiz
Drahtseilakt
28 Weitere Beispiele von Stahlbrücken aus schweizerischer Planung und Herstellung
31 Impressum
Living Bridge
Die Fussgängerbrücke über den Shannon ist mehr als »nur« die Verbindung zwischen zwei Orten: Die kleinen Plätze oberhalb der Brückenpfeiler laden zum Ausruhen, Verweilen und Betrachten ein, bieten aber auch Raum für Begegnung und Kommunikation – eine «Living Bridge» im wahrsten Sinne des Wortes.
Die 350 Meter lange Brücke verbindet den Campus der Universität Limerick am Südufer des Shannon über die ökologisch sensible Auenlandschaft hinweg mit den auf der gegenüberliegenden Seite errichteten Erweiterungsbauten. In ihrem Verlauf orientiert sie sich an einer Reihe kleiner, bewaldeter Inseln im flachen Flussbett. Diese bestimmen die Lage der Pfeiler, die sich in ihrem oberen Bereich in eine ausladende, vierarmige Stahlkonstruktion verzweigen. Dazwischen sind sechs jeweils 44 Meter lange Brückenabschnitte angeordnet, von denen jeder als konstruktiv eigenständige Einheit ausgebildet ist. Ihre pulsierende Geometrie erhält die im Radius von 300 Meter gebogene Konstruktion durch die variable Breite der Lauffläche, die sich von sieben Meter Breite über den Pfleilern auf nur vier Meter im Mittelfeld verjüngt.
Die primäre Tragkonstruktion ist unterhalb der Lauffläche angeordnet, um den Blick in die umgebende Landschaft so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Beidseits des Decks verlaufende, mit Beton gefüllte Rundrohre aus Stahl bilden den Obergurt der unterspannten Konstruktion, als Untergurt dienen je drei parallel geführte, offene Spiralseile. Im Abstand von 2,20 Meter sind Druckstreben über Stahlsättel mit den Seilen verbunden. Die Streben sind bis zu drei Meter lang und in einem Winkel von circa 22 Grad nach aussen gespreizt. Schräg gestellte Geländerpfosten nehmen oberhalb des Decks diese optische Linie auf. Zwischen den Längsträgern aus Stahlrohren sind fischbauchförmige Querträger angeordnet, die das Deck der Brücke tragen. Neben einer Laufzone, gekennzeichnet durch einen Aluminiumbelag, entwickeln sich unterschiedlich breite Bereiche. Die Plattformen oberhalb der Brückenpfeiler laden mit ihren windgeschützten Sitzgelegenheiten nicht nur zum Verweilen ein, sondern bieten auch Platz für Musikaufführungen und andere studentische Veranstaltungen.Steeldoc, Do., 2008.12.18
18. Dezember 2008 Martina Helzel, Anne-Marie Ring
Zweistöckig über den Rhein
Das feingliedrige Stahlverbundfachwerk der Dreirosenbrücke lässt ihre Doppelfunktion – Lokalverkehr oben, Transitverkehr unten – gut erkennen. Mit dem zweistöckigen Konzept haben die Architekten nicht nur die Verkehrsader ansprechend ins Stadtbild integriert, sondern gleichzeitig einen Fussgängerboulevard und damit Raum für vielfältige städtische Aktivitäten geschaffen.
Die Basler Nordtangente verbindet das schweizerische Nationalstrassennetz mit der französischen Autobahn A35. Die 3,2 Kilometer lange Strecke ist als vierspurige Stadtautobahn ausgebildet und verläuft meist unterirdisch. Für den Rheinübergang zwischen Kleinbasel und Grossbasel wurde die bestehende Drei rosenbrücke von 1934 durch eine doppelstöckige Zwillingsbrücke ersetzt. Beide Verkehrsebenen sind gleich breit ausgebildet; die untere Fahrbahnebene dient dem Durchgangsverkehr, während die obere, asymmetrisch angeordete Ebene mit Stadtstrasse, Trambahn und Radweg sowie einem 8,5 Meter breiten Fussgängerboulevard auf der Südseite dem Lokalverkehr vorbehalten ist. Ein Brückenüberbau mit vier Trag werksebenen schien die sowohl wirtschaftlich als auch ästhetisch beste Lösung. Realisiert wurde er in Form zweier unabhängig voneinander erstellter und auch nutzbarer Stahlverbundkonstruktionen. Die nördliche Hälfte, neben der alten Brücke, wurde im November 2001 dem Verkehr übergeben. Danach wurde die alte Brücke abgebrochen und die südliche Hälfte errichtet. So konnte der Verkehr während der Bauzeit aufrecht erhalten werden. Als entscheidendes Kriterium für die rationelle Bauabwicklung galt es, zeitkritische Arbeiten auf der Baustelle zu minimieren. Das vorliegende Konzept erlaubte es, das Stahlfachwerk in vier grossen Teilen vorzufertigen.
Die beiden 266 Meter langen Brücken ruhen auf mächtigen Flusspfeilern von ca. 40 Meter Länge und vier Meter Breite. Die Fundation im Septarienton wurde mit Bohrpfählen ergänzt und die bestehenden Pfeiler und Caissonfundamente in die neue Konstruktion integriert. Dadurch betragen die Spannweiten der als Durchlaufträger wirkenden Brücken 77, 105 und 84 Meter. Die festen Auflager der neuen Brücken befinden sich auf dem Flusspfeiler der Kleinbasler Seite. Ihre Widerlager liegen hinter denen der alten Brücke, sie mussten deshalb als aufgelöste Konstruktion neu aufgebaut werden.
Das Schlüsselelement der Brückenkonstruktion sind die Fachwerkknoten, in denen sich Längsfachwerk und Querrahmen verbinden. Mit den später einbetonierten Montagegurtungen und den auswechselbaren Windverbänden entsteht das Raumfachwerk der Brücke. Der Kraftaustausch zwischen den Betongurtungen und den Diagonalen findet über Kopfbolzendübel statt, welche im Knotenbereich konzentriert sind. Die Fahrbahnplatten sind als vorgespannte Rippenplatten mit einem Rippenabstand von 7 Meter und einer Spannweite von 14,70 Meter ausgeführt. In verschiedenen Stahlbaubetrieben wurden transportfähige Stücke, bestehend aus einem Knoten und einer Diagonale, hergestellt. Diese Elemente wurden zu einer eigens dafür eingerichteten Feldwerkstatt am Rheinufer, vier Kilometer unterhalb des späteren Übergangs, transportiert und dort zu zweimal zwei räumlichen Stahlfachwerken von 133 Meter Länge, 16 Meter Breite und 7,8 Meter Höhe verbunden. Je zwei 470 Tonnen schwere Elemente wurden nacheinander auf Pontons zur Baustelle transportiert, mit hydraulischen Hebegeräten auf das Einbauniveau von elf Meter über dem Wasserspiegel gehoben und mit Seilwinden in Position gebracht. Danach befanden sich die beiden Hälften bei den Pfeilern in definitiver Höhe, bei den Widerlagern jedoch um 50 Zentimeter zu tief platziert, was den Einbau eines Passstücks in der Brückenmitte möglich machte. Durch das anschliessende Anheben bei den Widerlagern des nunmehr zusammmengeschweissten Stahlfachwerks werden Zwängungskräfte erzeugt, die in etwa dem effektiven Dreifeldzustand entsprechen.Steeldoc, Do., 2008.12.18
18. Dezember 2008 Martina Helzel, Anne-Marie Ring
Tor nach Einsiedeln
Wanderer und Pilger überqueren auf dem Bennauer Steg Strasse und Bahngleis im langgezogenen Flusstal der Alp auf ihrem Weg zum Wallfahrtsort Einsiedeln. Die berühmte Benediktinerabtei ist eine bedeutende Station auf dem Jakobsweg.
Mit ihrem weithin sichtbaren Pylon, der signalrot beschichteten Stahlkonstruktion und der in den Handlauf integrierten Beleuchtung ist die einhüftige Schrägseilbrücke bei Tag und bei Nacht gut zu erkennen. Dennoch nimmt der Steg Rücksicht auf die naturnahe Auenlandschaft entlang der Alp, die im Rahmen des Strassenausbaus ökologisch aufgewertet und für die Bevölkerung besser zugänglich gemacht wurde. Die beiden Widerlager der Brücke sind kaum wahrnehmbar in das Gelände eingepasst.
Die schlanke Stahlkonstruktion überbrückt die Kantonsstrasse mit einer Spannweite von rund 20 Meter sowie den Fluss, das Gleis der Südostbahn und die angrenzende Böschung stützenfrei über gut 60 Meter. Als Abstellbasis für den 22 Meter hohen, nach vorn geneigten Pylon dient eine Betonscheibe, die in die Stützmauer der Kantonsstrasse am südlichen Flussufer integriert ist. Diese ist mit zwei Bohrpfählen von 120 Zentimeter Durchmesser und 10 Meter Länge kolksicher fundiert.
Der Brückenträger besteht in Längsrichtung aus zwei parallel zueinander verlaufenden Stahlrohren, die im Abstand von zwei Metern durch geringer dimensionierte Rohre verbunden sind. Zwölf ausserhalb des Geländers angeordnete Zugstäbe durchdringen zur Verankerung die Längsträger.
Als Belag wurden 2,10 Meter breite Granitplatten verlegt. Ein 10 Millimeter Fugenspalt zwischen den Platten sorgt dafür, dass das Regenwasser abfliessen kann. Mit ihrer grauen Farbe stellen sie optisch die Verbindung zum bekiesten Wanderweg her. Die Brüstung aus Verbundsicherheitsglas, die von Pfosten auf den Querträgern gehalten wird, ermöglicht den freien Blick auf die umgebende Landschaft.Steeldoc, Do., 2008.12.18
18. Dezember 2008 Martina Helzel, Anne-Marie Ring