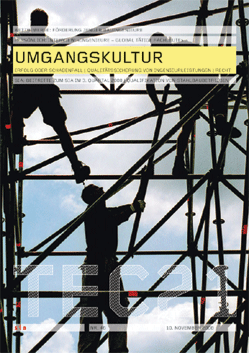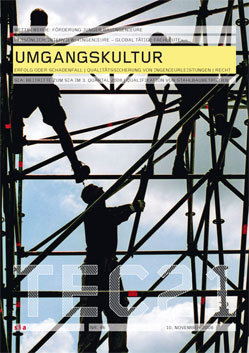Editorial
Am Anfang war die Katastrophe. Am 27. November 2004 stürzte im solothurnischen Gretzenbach die Decke einer Tiefgarage infolge eines Brandes ein und tötete sieben Feuerwehrleute. Untersuchungen zeigten, dass der Einsturz nicht auf den Brand allein, sondern auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen war: Sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung und bei der Nutzung sind Fehler begangen worden - grobe Fehler, wie sie eigentlich nicht passieren dürften. Durch diese Feststellung alarmiert, setzte sich die SIA-Fachgruppe für Brückenbau und Hochbau (FBH) verstärkt mit der Frage auseinander, wie die Qualität von Ingenieurleistungen sichergestellt werden könne.
Die FBH kam zum Schluss, dass das Beiziehen von externen Kontrollingenieuren in manchen Fällen zwar hilfreich, aber keine Universallösung sein kann. Vielmehr gilt es, eine gute Umgangskultur zwischen allen an einem Bauwerk Beteiligten herzustellen:Vertrauen, Wertschätzung und Kommunikation erhöhen die Leistungsbereitschaft der Fachleute, während eine Arbeitsweise, die auf standardisierte Abläufe und die Erfüllung von Normen beschränkt ist, ihre Motivation dämpft und letztlich auch nur mittelmässige Ergebnisse hervorbringt. Diese Erkenntnis mag eine Binsenwahrheit sein, allgemein anerkannt ist sie noch lange nicht. Im Gegenteil: Die Tendenz zur Normierung und Standardisierung von Dienstleistungen hält an; an die Stelle engagierter Bauherrschaften treten Gremien mit unklaren Verantwortlichkeiten, die das Risiko unkonventioneller Lösungen naturgemäss scheuen; wegen sinkender Honorare können es sich immer weniger Ingenieurbüros leisten, Zeit und Geld in eine gute Umgangskultur innerhalb des Betriebs zu investieren. Eine Wende ist nicht in Sicht.
Aus diesem Grund hat die FBH entschieden, ihre diesjährige Herbsttagung, die am 12. November in Zürich stattfindet, dem Thema «Umgangskultur im Bauwesen» zu widmen. Wir hoffen, viele unserer Leserinnen und Leser dort begrüssen zu dürfen - und mit diesem Heft zu einer breiten Diskussion unter all denen beizutragen, die nicht an der Veranstaltung selbst anwesend sein können.
Judit Solt
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Förderung junger Bauingenieure
12 PERSÖNLICH
Interview: «Ingenieure: global tätige Fachleute»
14 MAGAZIN
Angenehmes Wohnklima dank Holz
18 ERFOLG ODER SCHADENFALL – VIER SZENARIEN
Andreas Galmarini
Beispiele aus einem fiktiven Ingenieurbüro zeigen, wie eine gut funktionierende Kommunikation zur Vermeidung von Pannen beitragen kann.
22 QUALITÄTSSICHERUNG VON INGENIEURLEISTUNGEN
Michael Havbro Faber, Carlo Galmarini
Die Zahl der Schadenfälle steigt. Ein Grund ist das Fehlen einer guten Umgangskultur zwischen den am Bau Beteiligten.
27 GESETZE UND NORMEN SIND NICHT GENUG
Walter Fellmann
Nicht alle Aspekte des Bauens lassen sich abschliessend juristisch regeln – ein Kommentar zur Rolle der Umgangskultur im Rechtswesen.
33 SIA
Beitritte zum SIA im 3. Quartal 2008 | Qualifikation für Stahlbaubetriebe
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Erfolg oder Schadenfall - Vier Szenarien
Eine gute Umgangskultur innerhalb eines Ingenieurbüros kostet Zeit und setzt eine hohe gegenseitige Wertschätzung unter den Mitarbeitenden voraus. Doch der Aufwand lohnt sich. Eine funktionierende, nicht auf formalisierte Abläufe beschränkte Kommunikation trägt dazu bei, Fehler zu vermeiden. Vier fiktive Szenarien zeigen beispielhaft, wie sich eine einfache Alltagssituation zur Katastrophe oder zum Erfolg entwickeln kann. So haarsträubend manche Geschichte tönen mag – nicht selten übertrifft die Realität die Fiktion.
«Sollte ein Planfehler passieren, wirkt die Kopfwaschung durch den Polier oder den Eisenleger eindringlicher auf den Schuldigen als durch den Vorgesetzten. Irren ist menschlich. Doch Aufrichtigkeit im Eingestehen des Fehlers und Energie bei dessen Korrektur zeugen von Haltung und Charakter. Das Urteil über einen Menschen kann sogar gestärkt aus einem passierten Irrtum hervorgehen», sagte der Schweizer Ingenieur Emil Schubiger 1964 zu Fachhochschulabsolventen in seinem Vortrag «Kompetenz und Verantwortung» und gab ihnen so einen Einblick in seine Auffassung von Umgangskultur.
Formalisierte und informelle Vorgehensweisen
«Umgang» wird in unserem Zusammenhang als «Beziehung mit jemandem» und «Hantieren oder Beschäftigen mit etwas» definiert. «Kultur» kann als «gängige Praxis» oder «Tradition» verstanden werden. Die Umgangskultur im Ingenieurbüro beschreibt demnach die Beziehungen der Mitarbeiter untereinander und mit Drittpersonen, aber auch die Art und Weise, wie sie sich mit ihren Aufgaben beschäftigen.
Ein formeller Grundstein der Umgangskultur eines Büros findet sich häufig im Firmenleitbild. Prozessdefinitionen, Businessintegritätsmanagement und QS-System gehören ebenfalls zu den Dokumenten, die Beziehungen, Kommunikation und Arbeitsabläufe oder Teilbereiche davon regeln. Häufig beinhalten auch Verträge mit Kunden, Subunternehmen oder Arge- Partnern Teile, die Abläufe und Kommunikation beeinflussen. Die Organisation einer Firma – und die damit festgelegten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten – strukturieren die Beziehungen und Abläufe und beeinflussen damit die Umgangskultur.
Ein informeller Umgang findet in den Netzwerken der Mitarbeitenden statt. Diese Netzwerke bestehen sowohl aus internen als auch aus externen persönlichen Kontakten; ihre Ausrichtung, Tiefe und Nutzung ist Teil der Umgangskultur in einem Büro.
Gute Vorbilder sind unerlässlich
Die International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) skizziert in ihrem Code of Ethics Wertvorstellungen, die auf Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Berufsstand, auf Kompetenz, Integrität, Unparteilichkeit, Fairness und Unbestechlichkeit basieren. Ob zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Qualität der Arbeit höher gewichtet wird, verändert die Arbeitseinstellung grundlegend. Doch auch das hehrste Leitbild bewirkt wenig, wenn es nicht gelebt wird.
Dazu gehört erstens das Vorleben dieser Werte durch die leitenden Mitarbeiter, zweitens das Schaffen von Rahmenbedingungen, die es den anderen ermöglichen, diesen Werten nachzuleben, und drittens Ausbildung und Kontrolle, damit sie dies auch tun. Gleiches gilt für Qualitätssicherungssysteme und ähnliche Dokumente: Wenn der Chef die Kosten der Qualitätssicherungsmassnahmen in der Offertstellung nicht berücksichtigt, fehlen dem Projektleiter die Mittel, diese umzusetzen; und wenn der Projektleiter seine Berichte nie kritisch überprüfen lässt, wird es der Praktikant mit seinen Berechnungen wahrscheinlich auch nicht tun.
Qualitätssicherung und Kommunikation - Vier Szenarien
Wie sehr Qualitätssicherung und nichtformelle Komponenten der Umgangskultur zusammenhängen, soll folgendes Beispiel illustrieren: Ein frisch ausgebildeter Ingenieur wird von seinem Projektleiter aufgefordert, eine Stützenstatik zu erstellen, diese von einem zweiten Ingenieur prüfen und die Prüfung auf dem entsprechenden Formular quittieren zu lassen – wie dies im QS-Handbuch verlangt sei.
Szenario 1: Der junge Ingenieur legt spätabends seine Querschnittsnachweise zusammen mit dem ausgedruckten QS-Formular auf das Pult seines Kollegen, den er von der gemeinsamen Studienzeit kennt und der schon nach Hause gegangen ist. Zwei Tage später liegen die Berechnungen wieder auf dem Pult des jungen Ingenieurs mit der Bemerkung, dass ein Rundungsfehler passiert sei und es 53 statt 52 Armierungseisen brauche. Die Ausführung mündet in einen grossen Schadensfall.
Szenario 2: Nachdem der junge Ingenieur seine Berechnungen fertig gemacht hat, fragt er seinen Projektleiter, welchem älteren Kollegen er seine Berechnung zur Prüfung geben dürfe. Der Projektleiter antwortet, dass ein erfahrener Ingenieur im oberen Stock nicht gut ausgelastet sei und daher Zeit für die Prüfung hätte.
Dieser Ingenieur, der sich in seiner langjährigen Karriere vor allem mit Geotechnik und Baugrubenabschlüssen beschäftigt hat, nimmt sich der Prüfaufgabe an und verlangt als Erstes die relevanten Pläne. Er stellt fest, dass die in der Berechnung angenommene Stützenhöhe nicht mit derjenigen in den Plänen übereinstimmt, und bestellt den Verfasser zu einer Bereinigungsbesprechung. Im Gespräch stellt sich zudem heraus, dass die Berechnungen auf einem überholten Planungsstand basieren und dass sich in der Zwischenzeit auch die Lasteinzugsfläche vergrössert hat, sodass eine Verdoppelung der Anzahl Armierungseisen nötig ist. Während der Ausführung wird die Weichheit des Tragwerks bemerkt.
Dass nachträglich noch ein Windverband ergänzt werden muss, sorgt für eine gewisse Irritation der am Bau Beteiligten.Szenario 3: Der junge Ingenieur stellt ein Berechnungsmodell der Stütze auf. Da er sich etwas unsicher fühlt, bittet er seinen «Götti» – einen erfahrenen Hochbauer, der ihm beim ersten Arbeitstag zugewiesen wurde – um einen Termin. Dabei wird klar, dass zur Sicherung der Gesamtstabilität ein Windverband nötig ist. Zurück im Büro, passt der junge Ingenieur seine Berechnungen dem neuen Konzept an und gelangt an den Projektleiter, um die Windverbände in die Pläne einfliessen zu lassen. Im Gespräch stellt sich heraus, dass sich das Projekt auch sonst weiterentwickelt hat und die Berechnungen nochmals anzupassen sind. Die abschliessende Prüfung durch den «Götti» führt zu kleineren Anpassungen der konstruktiven Durchbildung der Stützenanschlüsse an die Berechnungsannahmen. Die Ausführung und die Inbetriebnahme des Bauwerks verlaufen problemlos.
Szenario 4: Nachdem der junge Ingenieur ein Berechnungsmodell für die Stütze aufgestellt hat, gelangt er damit zum älteren leitenden Ingenieur, mit dem er am Firmensporttag im Team war und dabei zufällig erfahren hat, dass dieser während des Wettbewerbs für die Konzeptentwicklung mit dem Architekten verantwortlich war. Der ältere Ingenieur sieht sich die Modellbildung an, weist ihn als Erstes auf das Fehlen eines Windverbandes im Modell hin und erläutert das Wettbewerbskonzept. Im anschliessenden Gespräch wird die Möglichkeit erörtert, Stützen als Rahmenstiele auszubilden, um die Gesamtstabilität zu gewährleisten und auf Windverbände verzichten zu können. Der ältere Ingenieur meint, dass der Fokus im Wettbewerb nicht auf diesem Aspekt gelegen habe, aber dass sich eine solche Lösung hier anbieten würde. Nach einer kurzen Diskussion über die Vor- und Nachteile kommt das Gespräch auf die Unterschiede in der konstruktiven Durchbildung, und der ältere Ingenieur erwähnt, dass der Konstrukteur im unteren Stock besonders stark bei der Detaillierung solcher Anschlüsse sei. Der junge Ingenieur fragt beim Projektleiter nach, mit welcher Lösung er weiterfahren soll, was zu einer gemeinsamen Sitzung beim Architekten führt. Dieser freut sich, trotz den etwas höheren Baukosten den Windverband loswerden zu können, weil dieser einen Durchgang verunmöglicht und die Nutzung beeinträchtigt hätte. Nach dem Anpassen der Statik, sensibilisiert durch das Gespräch, überprüft der junge Ingenieur die Pläne der Stützenanschlüsse. Mithilfe des empfohlenen Konstrukteurs können Details, die schwierig auszuführen scheinen, schnell optimiert werden. Die abschliessende Prüfung durch den Projektleiter fördert einen Flüchtigkeitsfehler in den Berechnungen zutage, was eine geringfügige Anpassung der Anzahl Armierungseisen zur Folge hat. Die Ausführung verläuft plangemäss, und im täglichen Betrieb freut man sich über den nützlichen Durchgang.J
Jeder Einzelne trägt Verantwortung
Diese etwas überspitzten Szenarien sollen aufzeigen, dass formelle Regelungen nicht ausreichen, um Qualität zu garantieren, und dass gute Umgangskultur einer Firma auch etwas kostet – indem zum Beispiel den teuersten, erfahrenen Mitarbeitern die Zeit zur Verfügung gestellt wird, sich junger Mitarbeiter anzunehmen, und indem der Aufbau von Netzwerken gezielt gefördert wird. Dem könnte man entgegnen, dass Regelungen und Prozesse nur präzise genug definiert werden müssten, um Fehler zu vermeiden. Doch Handbücher sollten schlank und einfach gehalten sein, um gebrauchstauglich zu bleiben; und ein guter, angenehmer, nicht ins letzte Detail geregelter Umgang trägt wesentlich zur Arbeitsfreude und damit zum Leistungswillen bei. Mit diesen Szenarien soll auch gezeigt werden, dass jeder einzelne Mitarbeiter die Verantwortung trägt, sich bei Unsicherheiten Hilfe zu holen und seine Aufgabe nicht nur dem Buchstaben getreu, sondern möglichst auch sinngemäss zu erfüllen. Dies kann gefördert werden durch gute Vorbilder, durch eine Informationspolitik, die nicht auf einem reinen «need to know»-Konzept basiert, und durch das Bilden von Projektteams mit entsprechendem Teamgeist. Wichtig ist aber auch, dass die erwähnte Verantwortung durch die leitenden Mitarbeiter tatsächlich übertragen wird; «Bauchweh-Meldungen» von Mitarbeitern ist mit fachlicher Unterstützung zu begegnen. Auch die Wichtigkeit der mündlichen Kommunikation kommt in diesen Szenarien zutage: Das alleinige Absenden schriftlicher Information ist meist nicht genug, nur in einem Gespräch können der Kontext und der Sinn «zwischen den Zeilen» diskutiert, gemeinsame Ziele vereinbart und die korrekte Interpretation der Information kontrolliert werden. Um mit Bernard Shaw zu schliessen: «The danger of communication is assuming that it has taken place.»TEC21, Mo., 2008.11.10
10. November 2008 Andreas Galmarini
Qualitätssicherung von Ingenieurleistungen
Ingenieurinnen und Ingenieure sind heute besser ausgebildet denn je, sie können auf mehr Wissen und eine bessere Technik zurückgreifen als ihre Vorgänger – und dennoch steigt die Zahl der Schadenfälle. Die Autoren führen dieses beunruhigende Phänomen auf das Fehlen einer guten Umgangskultur zurück: Fachleute haben kaum noch die Möglichkeit, aktiv in Projekt abläufe einzugreifen, weil die Qualität ihrer Leistungen zunehmend nur an technischen Aspekten gemessen wird. Auf eine undankbare Rolle als Problemlöser reduziert, können sie ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht mehr wahrnehmen. Bessere Arbeitsbedingungen tun not.
Die Qualität von Ingenieurleistungen spielt eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle. Entwurf, Bemessung, Ausführung, Instandhaltung und Rückbau von Anlagen – sei es in den Sektoren Industrie, Infrastruktur oder Wohnen – bestimmen die gebaute Umwelt und bilden gleichsam das Rückgrat der Gesellschaft. Hinzu kommt, dass Ingenieurleistungen oft mit beträchtlichen Risiken verbunden sind: Sie beeinflussen nicht nur die Wirtschaftlichkeit des einzelnen Bauwerks und die Qualität der gebauten Umwelt, sondern ganz direkt auch die Sicherheit von Personen.
Wie viel die Gesellschaft in die Sicherheit von Bauwerken zu investieren bereit ist, bestimmt sie selbst. Weil ein höheres Sicherheitsniveau mit höheren Kosten einhergeht, ist die Sicherheit der gebauten Umwelt unmittelbar mit der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Ingenieurleistungen verbunden. Diese haben somit einen massgebenden Einfluss auf die Lebensqualität einer Gesellschaft.
Mehr Schäden trotz höherem Wissensstand
Sowohl in der Schweiz als auch in vielen anderen Ländern, mit denen wir uns gerne vergleichen, wurde in den letzten Jahren intensiv über die Sicherstellung der Qualität von Ingenieurleistungen debattiert. Der Grund für diese Diskussion ist eine auf den ersten Blick erstaunliche Beobachtung: Obwohl die «best practice» dank einer Zunahme des technischen Wissens, der Fähigkeit und der Erfahrung der Beteiligten sowie dank der Einführung von umfassenden und standardisierten Prozessen zur Qualitätssicherung (etwa ISO 9000) verbessert werden konnte, steigt die Zahl der Schadenfälle – und damit auch die Kosten. Konkret bedeutet das: Trotz höheren Investitionen ist es nicht gelungen, die Sicherheit der Bauwerke zu steigern. Die Präferenz der Gesellschaft, in die Sicherheit zu investieren, konnte nicht gebührend berücksichtigt werden.
Eine nachhaltige, positive Entwicklung unserer Gesellschaft hängt weiterhin in erheblichem Masse von unserer Fähigkeit ab, beschränkte Ressourcen gezielt einzusetzen. Dies gilt nicht zuletzt auch für Investitionen in die Erstellung und den Betrieb von Bauten beziehungsweise in die Instandhaltung der gebauten Umwelt. Eine solche Zuteilung ist auf der Basis von Risikobewertungen – oder allgemein von Kosten-Nutzen-Analysen – möglich; die tatsächlich erreichte Effizienz hängt jedoch von der Qualität der Ingenieurleistungen ab, in die wir investieren.
Die grosse und drängende Frage ist deshalb: Wie können wir die Qualität von Ingenieurleistungen verbessern? Um eine Antwort zu finden, müssen wir uns mit dem Begriff der «besten Praxis» im Ingenieurwesen auseinandersetzen.
Der Begriff „Best Practice“ im Ingenieurwesen
Traditionell werden Ingenieurleistungen als technische Leistungen verstanden. Aus diesem Grund sind die Bemühungen, die die Berufsgruppe der Ingenieure zur Sicherstellung und Erhöhung der Qualität unternimmt, auf technische Aspekte fokussiert. «Best practice» ist in Normen, Standards und anderen Regelwerken – zum Beispiel Swisscodes und Eurocodes – festgelegt und dokumentiert. Diese Normenwerke wurden in der Regel auf der Basis langjähriger Erfahrung und fundierten technischen Wissens von Ingenieurvereinen und technischen Ausschüssen entwickelt, und sie haben sich in der Praxis auch gut etabliert. Dennoch darf nicht vergessen gehen, dass Ingenieurleistungen von Menschen erbracht werden und dass die Qualität dieser Leistungen daher nicht nur technische Aspekte beinhaltet. Dies ist ein wesentlicher Punkt, den es unbedingt zu berücksichtigen gilt, um die Qualität sicherzustellen. Wir müssen nicht nur die technischen Lösungen selbst, sondern auch ihre Entwicklung und Implementierung untersuchen. Mit anderen Worten: Nicht nur das Ergebnis einer Aktivität, sondern auch die Prozesse, die zu diesem Ergebnis geführt haben, müssen betrachtet werden. In diesem Sinne muss auch der Begriff «best practice» erweitert werden.
Die Qualität von Ingenieurleistungen kann als Produkt der Faktoren Mittel, Möglichkeiten und Motive angesehen werden. Die Mittel sind qualifizierte menschliche Ressourcen – Ingenieurinnen und Ingenieure, die die bestehenden technischen Möglichkeiten beherrschen, Kenntnisse haben und auf Wissen zurückgreifen können. Die Möglichkeiten werden durch adäquate organisatorische Massnahmen gewährleistet, indem den einzelnen Ingenieurinnen und Ingenieuren die Möglichkeit gegeben wird, gute Leistungen zu erbringen. Das Motiv für das Erbringen qualitativ hochstehender Dienstleistungen schliesslich ist in vielen Studien untersucht worden. Alle nennen als wichtigste Voraussetzung, dass den Ingenieurinnen und Ingenieuren die Möglichkeit zugestanden wird, Qualität zu erarbeiten und sie zu beeinflussen, Wissen anzuhäufen und zu teilen, Verantwortung zu übernehmen.
Respekt, Kollegialität und Offenheit als Voraussetzung
Gehen wir von der Annahme aus, dass das Potenzial organisatorischer Massnahmen und einer optimalen, von Qualitätssicherungsprozessen wie ISO-unterstützten Führung bereits ausgeschöpft ist. Nehmen wir weiter an, dass die Fragestellungen bezüglich der Mittel inklusive der Rekrutierung, der Wissensansammlung, der Schulung, der Ausbildung und der Wissensteilung im selben standardisierten Rahmen abgesichert sind. Dann repräsentiert das Motiv die komplexe Interaktion zwischen allen anderen Faktoren, welche die Qualität beeinflussen. Diese Interaktion können wir auch als Umgangskultur bezeichnen – und es versteht sich von selbst, dass sie äusserst schwer zu standardisieren ist.
Viele Aspekte, die die Umgangskultur beeinflussen, hängen mit den beiden oben erwähnten Faktoren Möglichkeiten und Mittel zusammen. Sie betreffen das Zusammenwirken von Auftraggebern, Architekten, Ingenieuren und Unternehmern. Unbestritten ist, dass eine gute Umgangskultur nur dann nachhaltig gewährleistet werden kann, wenn es eine respektvolle, kollegiale und offene Arbeitskultur unter allen am Projekt Beteiligten gibt: Die Verantwortung der Ingenieure und das Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten beeinflussen die Qualität der Arbeit massgebend. In dieser Hinsicht können Ingenieurleistungen mit den Dienstleistungen von Ärzten und Rechtsanwälten verglichen werden. So gesehen leuchtet es ein, dass die Verantwortung der einzelnen Ingenieurin, des einzelnen Ingenieurs sehr gross ist. Daher ist es folgerichtig, das Problem der Qualitätssicherung aus ihrer Perspektive zu betrachten. Auch für die nichttechnischen Aspekte der Ingenieurleistungen muss «best practice» umfassend definiert, dokumentiert und umgesetzt werden, um das Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein zu schärfen.
Theoretische Erkenntinsse in der Praxis berücksichtigen
Die Ingenieure müssen also Arbeitsbedingungen definieren und durchsetzen, die es ihnen ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen und sich in die Prozesse aktiv einzubringen. Dies kann mittels einer expliziten Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Ingenieurgeschehen, die eine vollständige und logische Definition der Leistungen festlegt und auch Fragestellungen enthält, die die Sicherstellung der Qualität der Leistung betreffen – zum Beispiel, wie eine effiziente Nutzung von Erfahrung und bestem Wissen sichergestellt wird, inwiefern externe und interne Erfahrungen genutzt werden, wie mit Problemen im Prozessablauf umgegangen wird und wie diese zu bewältigen sind.
Diese Verhaltensregeln mögen vielleicht banal erscheinen, betrachten die Ingenieure solche Regeln doch bereits als Teil der bestehenden «best practice». Die Frage aber bleibt: Wenn alle Beteiligten sich über solche Regeln einigen können, warum fällt es uns immer noch derart schwer, eine gute Umgangskultur sicherzustellen?
Das Problem liegt wohl darin, dass die am Projekt Beteiligten sich oft nur in der Theorie einigen – doch der Berufsalltag ist vom Ideal leider weit entfernt. Ingenieurinnen und Ingenieure kämpfen mit veränderlichen Projektdefinitionen, mit knappen Abgabeterminen, mit Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit und mit vielen weiteren, teilweise widersprüchlichen Randbedingungen. Obwohl die Leitung der Projekte Qualität fordert, wird dies nicht eindeutig kommuniziert: Allzu oft wird der Erfolg am Zeitbedarf und am kurzfristigen wirtschaftlichen Ertrag gemessen. Die Qualitätssicherung ist zu wenig in die Struktur der Geschäftsführung integriert und wird anderen – externen und internen – Personen überlassen, die nicht direkt in das tägliche Geschäft involviert sind. Unter diesen Bedingungen fallen Ingenieurinnen und Ingenieure zu oft in die Rolle des «Feuerlöschers» zurück. Dieser Umstand ist äusserst problematisch, denn er belastet die Umgangskultur – und damit einen der Haupteinflüsse auf die Qualität der Ingenieurleistung.
Fachleute, Schulen und Verbände müssen aktiv werden
Hier besteht also Verbesserungsbedarf. Ingenieurinnen und Ingenieure müssen auf Arbeitsbedingungen beharren, die mit ihrer Rolle in der Gesellschaft und mit ihrer Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen in Übereinstimmung stehen. Die Qualität von Ingenieurleistungen muss im Vordergrund stehen und durch Wissen, Innovation und Sorgfalt gewährleistet sein. Selbstverständlich müssen auch Kosten und Termine optimiert werden, aber immer mit dem klaren Ziel, die Qualität zu fördern. Das ist sowohl für die Auftraggeber als auch für die Ingenieure wichtig; der wirtschaftliche Gewinn darf nicht das einzige Motiv der Ingenieurleistung sein.
Die Auseinandersetzung mit der Umgangskultur bei Ingenieurleistungen und die Verbesserung dieser Umgangskultur ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auftraggeber, Fachvereine, Hochschulen und Universitäten sind in die Debatte einzubeziehen. Insbesondere Fachvereine wie der SIA müssen vernünftige, fachgerechte Arbeitsbedingungen definieren, die jeden einzelnen Teil der Ingenieurleistungen umfassen – die Ausschreibung, die Projektierung, die Kriterien für die Projektauswahl und die Ausführung. Nach dem Abschluss des Projektes ist eine Wissens- und Erfahrungssammlung zu erstellen, damit der notwendige Wissenstransfer erfolgen kann. Bereits in der Ingenieurausbildung müssen Themen wie Verantwortung, fachlich korrektes Verhalten und alle Aspekte der «best practice» prominent vertreten sein.
Und nicht zuletzt muss betont werden: Der Ruf des Ingenieurberufs steht und fällt mit der Selbstachtung der Ingenieure. Diese wiederum widerspiegelt die Verantwortung, die wir bei der Festlegung, der Umsetzung und der Sicherung unserer Arbeitsbedingungen übernehmen. «Best practice» und Umgangskultur zu definieren und zu kommunizieren, dient in diesem Sinne nicht lediglich dazu, die Qualität von Ingenieurleistungen zu verbessern; es ist auch eine unabdingbare Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung unseres Berufes. Denn wenn wir die besten guten Leute für unseren Beruf gewinnen möchten, dürfen wir das Schlüsselkriterium – den guten Ruf des Ingenieurstands – nicht vernachlässigen.TEC21, Mo., 2008.11.10
10. November 2008 Carlo Galmarini, Michael Havbro Faber