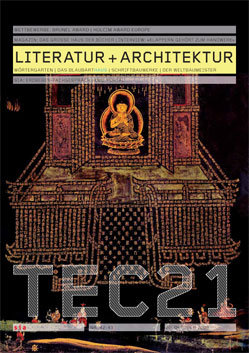Editorial
Der Raumtheoretiker und -künstler František Lesák, Professor für Plastische Gestaltung an der TU Wien, sammelte während Jahren das Wort «Raum» – Definitionen, lyrische Wendungen, spontane Äusserungen –, fasste alles unter dem Begriff «Raumdeutsch» zusammen und stellte sie 2001 im Künstlerhaus in Wien aus. Über 800 Wendungen gestaltete er – grafisch wie eine Buchseite – zu einem monumentalen Wandschriftbild (18 × 7 Meter). Als der Zettelkasten auf 1300 Einträge angeschwollen war, sistierte Lesák die Sammlung. Umgekehrt versuchte er unter dem Titel «Texttreue» die Villa, die in Alain Robbe-Grillets Roman «La jalousie» als Hauptschauplatz figuriert, in Zeichnungen zu rekonstruieren.
Mark Z. Danielewskis Roman «Das Haus» ist die Verkörperung eines solchen Zettelkastens.nUnd er ermutigt dazu, das Haus zu zeichnen: «Es wäre fabelhaft, wenn irgendjemand [...] in der Lage wäre, einen Bauplan zu rekonstruieren.»1 Der Architekt der in diesem Heft abgebildeten Pläne hat sich darauf eingelassen, die atmosphärisch dichten, faktisch aber dünnen Beschreibungen umzusetzen.
Angesichts dieses Hauses könnte man versucht sein, zu denken, Victor Hugos Prophezeihung «Ceci tuera cela» (ceci = das Buch; cela = das Bauwerk) habe sich erfüllt, das Buch als Blätterhaus habe die Baukunst in ihrer Rolle als «chronique de pierre»2 abgelöst. Aber im Grunde ist die Architektur das Medium, das andere Medien orchestriert («Der Weltbaumeister»), das es erst ermöglicht, «ein unermesslich kosmisches Haus» zu ersinnen, das es «dem Dichter [gestattet], das All zu bewohnen»3 («Blaubarthaus»). Sie ist das Vehikel, das eine heilige Schrift «transportiert» («Schriftbauwerke») oder einen Garten erschliesst («Wörtergarten»).
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Brunel Award | Holcim Award Europe
14 MAGAZIN
Das Grosse Haus der Bücher | Interview: «Klappern gehört zum Handwerk» | Vorschnell beseitigt | MAH Genf sucht Geld
24 WÖRTERGARTEN
Hansjörg Gadient
Texte von Schriftstellern haben den Garten im europäischen Raum als Kulturgut etabliert. Eines der poetischsten Beispiele unserer Zeit ist das Buch Derek Jarmans über seinen Garten in Dungeness.
28 DAS BLAUBARTHAUS
Rahel Hartmann Schweizer
Mark Z. Danielewskis «Das Haus» ist ein Labyrinth von Sprachräumen, ein Spiegelkabinett der Psyche, ein enzyklopädisches Panoptikum, eine architektonische Kakofonie.
34 SCHRIFTBAUWERKE
Helmut Brinker
Heilige Schriften des Buddhismus als Bauelemente der Sakralarchitektur zu verwenden, liess während des Mittelalters in Japan Schrift-Bild-Werke entstehen, die Text, Bild und Architektur verschmelzen.
40 DER WELTBAUMEISTER
Rahel Hartmann Schweizer
Ewan Forster & Christopher Heighes wählten Bruno Tauts Hufeisensiedlung in Berlin als Schauplatz der Anverwandlung von Tauts «Weltbaumeister » von 1919 an das zeitgenössische Berlin.
44 SIA
Erdbeben-Fachgespräch | KMU-Portal
51 PRODUKTE
61 IMPRESSUM
62 VERANSTALTUNGEN
Wörtergarten
Schriftsteller wie Plinius der Ältere und der Jüngere, Johann Wolfgang von Goethe oder Vita Sackville-West haben ihrer Liebe zu den Pflanzen und zum Artefakt Garten mit Worten Denkmäler gesetzt. Diese Texte haben den Garten im europäischen Raum[1] als Kulturgut etabliert. Eines der poetischsten Beispiele unserer Zeit für das Sprechen über den Garten ist das Buch des Filmemachers Derek Jarman[2] über seinen eigenen Garten[3] in Dungeness. Jarman hat in den acht Jahren vor seinem Tod in Dungeness, einer wüstenhaften Gegend an der Südküste von Kent, einen Garten geschaffen, der heute jedes Jahr von einer Viertelmillion Menschen besucht und bewundert wird. Sein Buch hat den Ruf der kleinen Anlage in der ganzen Welt verbreitet.
Die Form des Buches ist banal: ein Gartentagebuch. Sein Inhalt ist weit mehr, nicht nur eine Sammlung von Beobachtungen und Reflexionen über den Garten und seine Kultur, sondern auch ein Buch über Sterben, Vergänglichkeit und Transzendenz. Jarman hat die Fischerkate namens «Prospect Cottage» 1987 am Strand von Dungeness in Kent entdeckt und gekauft. Noch im selben Jahr lässt er sich auf HIV testen und erfährt, dass er positiv ist, ein Todesurteil ohne Datum. Trotzdem renoviert er das Häuschen und beginnt, einen Garten anzulegen. Seine Diagnose treibt ihn zuerst in eine Depression, nach einer Phase von Rückzug, Wut und Trauer beginnt er wieder zu arbeiten. In schneller Folge nutzt er die verbleibende Zeit, um die eindringlichsten und besten seiner Filme fertigzustellen: «Eduard II», «Wittgenstein», «Blue» und «The Garden».
Und er beginnt sein Gartentagebuch. Es fängt an mit Erinnerungen. Schon als Kind konnte er sich einfach eine Pflanze ansehen. Gegen Ende seines Gartentagebuchs beschreibt er sich selbst: «Ich kann eine Stunde lang eine Pflanze anschauen, das gibt mir Frieden. Ich stehe bewegungslos und starre.»[4]
Erinnerungen lassen ihn bestimmte Pflanzen im Garten ansiedeln: Die Farbe Rot hat einen Geruch, den des rot blühenden Storchenschnabels. Baldrian ist eine sexy Pflanze, weil sie ihn an seinen ersten Liebhaber erinnert, den Flieger Johnny, der ihn auf seinem Motorrad in den verwilderten Garten am Stadtrand mit seinem blühenden Baldrian entführt hatte. Zu Beginn spielen Pflanzen nur Nebenrollen. Das Grundstück liegt zwischen dem Strand und dem ausgedehnten Naturschutzgebiet der Halbinsel Dungeness, der grössten Kiesfläche der Welt. «Diese Landschaft ist wie das Gesicht, das man übersieht, das Gesicht eines Engels mit einem Grinsen.»[5] Der karge Untergrund und die mit Salzgischt geladenen Ostwinde unterdrücken jedes Höhenwachstum. Bäume gibt es keine, Büsche werden nur hüfthoch: Stech- und Besenginster.
Das Fischerhäuschen steht in einer Fläche von rosa-ockerfarbenem und grauem Kies. Jarman beginnt seine langen Spaziergänge am Strand und bringt jedes Mal aussergewöhnliche Steine zum Haus. Sie sind grösser oder farbiger als die gewöhnlichen, oder sie sind aus besonderem Material wie Feuerstein. Damit formt er in der Kiesfläche Beete, Rechtecke und Kreise. Er stellt die Steine vom Strand aufrecht. So beginnt sein Garten. «Die Steine, vor allem die Kreise, erinnern mich an Dolmen, stehende Steine. Sie haben dieselbe rätselhafte Anziehungskraft. – Ich habe alle geheimnisvollen Bücher über Erdlinien und Kreise gelesen. Ich habe die Kreise mit diesem Wissen im Hinterkopf gebaut.»[6] In einer Landschaft ohne Vertikalen ist schon ein aufgestellter Stein ein Zeichen für Menschenwerk. Jarman ist sich dessen bewusst. Später legt er auch Kreise aus dem gelb blühenden Stechginster an, in deren Mitte er Treibgutpfähle aufrichtet wie Totems.
Gethsemane und Eden Dem Rechteck und dem Steinkreis folgen weitere geometrische Figuren auf der Eingangsseite und auf der Westseite des Hauses. Die Frontseite sei «formal», also geometrisch, die Rückseite dagegen zufällig. Jarman kennt die englische Gartengeschichte gut und bezieht sich mit den beiden unterschiedlichen Gartenteilen darauf. Er will keinen «manikürten» Garten, er will einen struppigen, in dem die Pflanzen üppig ineinander übergehen. «Wenn ein Garten nicht struppig ist, kann man ihn vergessen.»[7] Struppig ist in seinem eigenen Garten vor allem die Rückseite, wo der Zufall herrscht. Hier sammelt er Strandgut und stellt es auf: Holzpfähle, verrostete Schiffsteile, Bojen und viele andere Objekte, die er reizvoll findet. Begonnen hat diese Sammlung mit einem rostigen Stab, den er als Stütze für eine Hundrose einsteckte. Zwischen diese malerischen Objekte setzt er seine Lieblingspflanzen.
Im Buch reiht er ihre Namen zu Gedichten: «Thyme and oregano, hyssop, lavender, rue, fennel and rosemary, caraway, artemisia, pinks, a few sweet peas, night-scented stock, rows of lamb’s tongue, purslane, peas, radish, onion, lettuce, spinach and purple rock.»[8] Immer wieder nennt und beschreibt er einzelne davon wie Kostbarkeiten, den Meerkohl (crambe maritima) zum Beispiel. Er schildert, wie im März die ersten Sprossen von tintenlila Farbe aus dem ockerfarbenen Kies hervorstossen, wie die Blätter sich ausbreiten und alle Tönungen von Graugrün annehmen, wie im Juni über der Blattrosette ein Schleier feiner weisser Blüten schwebt und wie daraus im Herbst der Samenstand mit seinen sandfarbenen Kügelchen wird. Im Spätherbst endlich faulen und verfallen die Blätter; die Pflanze hat sich zum Überwintern in die Erde zurückgezogen. Zum Zeitpunkt, als Jarman diesen Lebenszyklus beschreibt, ist er bereits krank. Viele seiner Freunde sind an Aids gestorben, und er weiss, dass es auch für ihn keine Heilung geben wird. Sein Schreiben wird zunehmend düster, und die Realität des Sterbens nimmt immer mehr Raum ein. Die Sprache wird reduzierter und poetischer, bis die Prosa ganz von langen Gedichten verdrängt wird – Verse, in denen Jarman verschiedenste Reflexionen collagiert: Beobachtungen im Garten, Erinnerungen an Erlebnisse, Philosophisches zu Zeit und Endlichkeit, Klagen über seine Krankheit und Liebeserklärungen an seine Muse Tilda Swinton und seinen Freund Keith. In alles mischt sich die Kälte als Metapher für Sterben und Tod. Der Refrain eines der Gedichte ist: «Kalt, kalt, kalt. Sie sterben so still.»[9]
Während er schwächer wird, wird der Garten immer schöner, karg und üppig zugleich. «Die Stürme haben salzige Tränen hergeweht, meinen Garten verbrannt, Gethsemane und Eden.»[10] Jarman erblindet langsam, und die Infektion schwächt ihn immer mehr. Mit dem Gedanken an Sterben und Tod wird alles wichtig, was dieses Sterben transzendiert. Es ist nicht der Nachruhm, an den Jarman nicht glaubt und den er nicht will. Er glaubt an die Liebe. Ein Freund hilft ihm, auf der Westfassade des Hauses das Gedicht «The Sunne Rising» von John Donne11 anzubringen. In schwarzen, aus Sperrholz ausgeschnittenen Buchstaben stehen dort die Zeilen, in denen unbekannte Liebende die aufgehende Sonne beschimpfen, weil sie sie im Bett aufscheucht. Die Liebe aber kenne keine Stunden, Tage oder Monate, diese Fetzen von Zeit.[12]
Jarmans verbleibender Fetzen dieser Zeit ist kurz. Noch kann er Filme realisieren. Einer davon ist «The Garden»[13], von dem er viele Teile im Garten und am Strand dreht. Auch hier verwebt er Themen des Gartens mit anderen Aspekten seines Lebens und seiner Überzeugungen, mit religiösen Anspielungen, dem Kampf gegen Aids und und immer wieder seine Muse, Tilda Swinton. Vieles mutet an wie ein Traum, anderes hat den Charakter von Super-8- Heimkino. Heute wirkt «The Garden» fast historisch, ein Dokument für die Experimentierlust der 1980er- und 1990er-Jahre des unabhängigen Kinos in England.
Ganz anders dagegen das Buch über den Garten. Hier hat Jarman eine Sprache gefunden, die noch immer gegenwärtig wirkt, dank ihrer poetischen Kraft und ihrer Direktheit. Das Buch wird noch lange von der Schönheit des Gartens sprechen, wenn es ihn selbst längst nicht mehr geben wird.
Anmerkungen
[1] Eine weit reichere Kultur der literarischen Beschäftigung mit dem Garten hat China. Gelehrte und Dichter beschäftigten sich gleichermassen mit Poesie, Kalligrafie, Gärten und Steinen
[2] Derek Jarman, 1942–1994. Die Kunsthalle Zürich zeigt bis 2.11. eine Ausstellung: Derek Jarman. Brutal Beauty. Kuratiert von Isaac Julien
[3] Derek Jarmans Garden. London 1995, ISBN 0-500-01656-9. Die deutsche Ausgabe, «Derek Jarmans Garten», gibt es nur noch antiquarisch
[4] «I can look at one plant for an hour, this brings me great peace. I stand motionless and stare.» In: Derek Jarmans Garden, S. 57
[5] «This landscape is like the face you overlook, the face of an angel with a naughty smile.» Ibid. S. 118
[6] «The stones, especially the circles, remind me of dolmens, standing stones. They have the same mysterious power to attract.» S. 24. «I have read all the mystical books about ley lines and circles – I built the circles with this behind my mind.» Ibid. S. 47
[7] «If a garden is not shaggy, forget it.» Ibid. S. 41
[8] Ibid. S. 57
[9] «Cold cold cold, they die so silently.» Ibid. S. 81
[10] «The storms have blown salt tears, burning my garden, Gethsemane and Eden.» Ibid. S. 82
[11] John Donne, 1572–1631. Bedeutendster der «Metaphysical Poets»
[12] «Love, all alike, no season knowes, nor clyme, nor houres, dayes, moneths, which are the rags of time... » Jarman, S. 117 13 Der Film ist als DVD erhältlich: «Derek Jarman. The Garden»TEC21, Mo., 2008.10.20
20. Oktober 2008 Hansjörg Gadient
Das Blaubarthaus
«Hier wirkt sich die Phantasie nicht nur auf die geometrischen Masse aus, sondern auch auf die Kräfte und Geschwindigkeiten; sie erweitert nicht mehr nur den Raum, sie beschleunigt sogar die Zeit.»[2] Was Gaston Bachelard in «Poetik des Raumes» 50 Jahre vor Erscheinen von Mark Z. Danielewskis Roman «Das Haus»[3] niederschrieb, eignet sich als Wegweiser durch ein Werk, das als Labyrinth von Sprachräumen, als enzyklopädisches Panoptikum und architektonische Kakofonie angelegt ist. Doch einen Schlüssel zu diesem Blaubart-Haus gibt es nicht.[4]
«Das Haus» gliedert sich in verschiedene Erzählstränge, die jeweils mit unterschiedlichen Typografien gekennzeichnet sind. Der Kern der Geschichte ist der Dokumentarfilm, der sogenannte Navidson Record, der das Abenteuer des Dokumentarfotografen und Pulitzer- Preis-Trägers Will Navidson[5] und seiner Familie aufzeichnet. Um die Beziehung zu seiner Frau Karen zu kitten, bezieht die Familie ein Haus in der Ash Tree Lane irgendwo in Virginia. Um sich dieses Neuanfangs zu vergewissern, zeichnet «Navy» das Leben in dem Haus mit mehreren Kameras auf. Doch die Idylle gerät schon nach kurzer Zeit im wahrsten Sinn des Wortes aus den Fugen. Denn das Haus entwickelt ein Eigenleben. Zunächst bildet sich ein Zimmer, wo vorher keines war und das sich in den äusseren Abmessungen des Hauses kaum bemerkbar macht[6], später ein Korridor, der vom Garten aus gesehen nicht existiert, im Inneren aber zunehmend – mit jedem Mal, da Navy und seine alsbald aufgebotenen «Gefährten» (Robert Holloway, Billy Reston, Jed Leeder, Wax Hook und Tom, Navidsons Bruder) es auszukundschaften versuchen – bedrohlichere Ausmasse von labyrinthischer Struktur annimmt. Flure vervielfältigen sich, eine Halle erweitert sich zu einem grenzenlosen Raum, eine Wendeltreppe, die an Gabriels Horn erinnert,[7] schraubt sich in unendliche Tiefen, sackt wie eine Ziehharmonika wieder in sich zusammen...
Beschrieben wird der «Navidson Record», der sich in mehrere bruchstückhafte Filmsequenzen gliedert (5½-Minuten-Flur, Erkundung A, Erkundung 1 bis 5, Rettung, Zerstörung des Hauses), von Zampanò, einem blinden alten Mann, der in einem völlig verdunkelten Raum sein Dasein fristet. Die Aufzeichnungen, die er bei seinem Tod in einer Truhe hinterlässt, sind durchsetzt von Interpretationen, Abhandlungen und Analysen, die das Geschehen in dem Haus und das Verhalten der Protagonisten ausloten – untermauert von über 400 Fussnoten. Zampanò zerlegt die Zeit- ebenso wie die Architekturgeschichte, die er in einer nicht enden wollenden Liste von Bauwerken abspult, die dem Vergleich mit dem Haus nicht standhalten können. Er leuchtet philosophische und psychologische Hintergründe aus. Er spielt naturwissenschaftliche Theorien gegen literarische und filmische Quellen aus (neben Emir Kusturicas hervorgehobenem «Underground» wieder eine Aufzählung beinahe ad infinitum). Er ruft die griechische Mythologie als Zeugen auf, konterkariert mit Motiven der jüdisch-christlichen Kultur oder verortet in der islamischen Tradition.
Johnny Truant, ein Herumtreiber, der sich mit einem Job in einem Tätowierstudio über Wasser hält, nimmt sich des Manuskripts an. Zampanòs Truhe wird ihm zur Büchse der Pandora. Zwischen sexuellen Ausschweifungen und Drogenrausch quält er sich durch die losen Seiten, um sie zu edieren – eine Beschäftigung, die ihn zunehmend strapaziert. Er verliert sich in der Lektüre, und je zerstörerischer sie auf ihn wirkt, desto besessener steigert er sich in sie hinein – ungeachtet dessen, dass er darob verwahrlost und vereinsamt.
Er halluziniert, verbarrikadiert sich in seinen vier Wänden, verdunkelt die Fenster. Diesen Handlungsstrang lässt Danielewski parallel zu Zampanòs Aufzeichnungen laufen – formal als ausgedehnten Fussnotentext abgesetzt. Eine weitere – wenn auch marginale – Stimmeist die der Herausgeber, die Unklarheiten kommentieren und Informationen vervollständigen. Und schliesslich gibt es einen über 150 Seiten umfassenden Anhang mit Gedichten, Zeichnungen, Collagen, Briefen (vor allem von Truants Mutter), Zitaten und einem Nachruf auf Johnnys Vater. Der Kern des Romans kreist zwar um den fiktiven, als «Navidson Record» bezeichneten Film, der die Erkundungen der labyrinthischen Wucherung des Hauses dokumentiert, doch tritt das Schicksal Navys und seiner Familie zunehmend in den Hintergrund – überlagert von Johnnys Story, durchsetzt mit Einsprengseln über Zampanò und Johnnys Eltern und gespiegelt, gebrochen, konterkariert in den wissenschaftlichen und literarischen Referenzen. Navy kommt am Ende mit einem blauen Auge davon (bzw. er verliert ein Augenlicht), doch die Beziehung zu seiner Frau hängt noch immer in der Schwebe. Zunächst sucht Danielewski die Analogie formal zu bewältigen. Das Labyrinthische der Hausexpansion zeichnet er nach, indem er – in Anlehnung an die konkrete Poesie – die Typografie als Abbild des Inhalts einsetzt: Er stellt den Text auf den Kopf, legt ihn in die Diagonale oder spiegelt ihn. Mal verengt er das Schriftbild zusehends, bis nur noch abgehackte Silben auf einer Zeile stehen, mal weitet er es so aus, dass sich der Raum einer ganzen Seite zwischen zwei Halbsätzen aufspannt; mal muss man den Text von rechts nach links lesen, mal von unten nach oben, mal in einem Zickzackkurs. Dabei expandiert und komprimiert das Schriftbild nicht nur, es beschleunigt und verlangsamt sich auch. Diese formale Analogie wirkt allerdings wie der Wink mit dem Zaunpfahl, und es scheint, als hätte Danielewski sich oder den Lesenden zu wenig zugetraut. Denn das Labyrinth, das er im Kopf der Lesenden mit seinen Hunderten von Verweisen – auf teilweise inexistente Werke[8] – anrichtet, ist weit spannender als der Plot der Geschichte. Und Danielewski beherrscht die Kunst, uns zu verführen, immer wieder zumindest einen Seitenblick auf die Anmerkungen zu riskieren. Selbst wer nur einem Bruchteil der Verweise folgt, verirrt sich heillos in dem Gebäude des Wissens, der Gefühle, der Assoziationen, der Träumereien, das der Autor auftürmt.
Insofern spiegelt sich das Haus im Kopf des Lesenden: Das Gebäude, das wir aus den Verweisen entwickeln, lässt sich ebenso wenig geometrisch, konstruktiv nachvollziehen wie Navys Haus. Es lässt sich in keine Form pressen, nicht in einen Plan bannen, nicht skizzieren, hat nicht Anfang noch Ende.Von axis mundi bis Paralleluniversum Danielewskis Haus steckt Dimensionen ab, die von archaischen Weltbildern der Axis mundi, wie der Weltenesche (Yggdrasil) der nordischen Überlieferung, dem griechischen Omphalos (Nabel) in Delphi oder der Ka’aba als islamischem Zentrum der Welt, bis zu neuesten naturwissenschaftlichen Theorien – von Einsteins Raumzeit bis zur Stringtheorie – reichen. Er evoziert Assoziationen mit mythologischen Gemäuern wie dem Urbild des Labyrinth-Topos, dem Kerker des Minotaurus. Das Monster, von dem sich Holloway, einer der Gefährten, verfolgt fühlt und das ihn schliesslich zu verschlingen scheint, lässt einen unweigerlich an den Minotaurus denken. Dass aber nicht nur menschliche Körper, sondern auch Gegenstände – Taschenlampen, ein Fahrrad, Merkzeichen, Proviant etc. – verschluckt werden, beschwört ein schwarzes Loch herauf.
Das Universum, das Danielewski aufspannt, bewegt sich zwischen christlicher Jenseitsvision wie Dante Alighieris Höllenkreisen in der «Göttlichen Komödie» und wissenschaftlicher Anschauung der Relativitätstheorie. Masse – Menschen und Gegenstände – und Licht – Taschenlampen, Fackeln oder Signalraketen – wirken sowohl auf den Raum als auch auf die Zeit ein. Die Raumzeit des Hauses ihrerseits beeinflusst wiederum die Bewegung der sich in ihr befindlichen Objekte.
M. C. Eschers seltsame Schleifen treffen auf Piranesis Gefängnisse; gekrümmte Räume auf fantastische Schlösser wie Harry Potters Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Das Haus oszilliert zwischen der fünften Dimension der Kaluza-Klein-Theorie, die das Graviton mit der vierten Raumdimension auflädt, und der amerikanischen TV-Serie «Twilight Zone»: «Es gibt eine fünfte Dimension jenseits der menschlichen Erfahrung – eine Dimension, so gewaltig wie der Weltraum und so zeitlos wie die Ewigkeit. Es ist das Zwischenreich, wo Licht in Schatten übergeht, Wissenschaft auf Aberglaube trifft. Sie liegt zwischen den Fallgruben unserer Furcht und den lichten Gipfeln unseres Wissens. Dies ist die Dimension der Fantasie, das Reich der Dämmerung – die Twilight Zone.»[9] Das Haus ist Wurmloch und Paralleluniversum.[10] Es spiegelt die Klosterbibliothek in Umberto Ecos «Der Name der Rose» und die «Bibliothek von Babel» von Jorge Luis Borges.
In «Babel» entwickelte Borges die Vision einer Welt als Bibliothek aller möglichen Bücher mit so unermesslichen Dimensionen, dass das sichtbare Universum darin auf Nanomasse schrumpfen würde. Bei Danielewski nimmt das Haus Dimensionen an, die das Mehrfache des Erdumfanges ausmachen, die geologischen Schichten, die Navy später im Labor analysieren lassen wird, gehen Jahrmillionen zurück, einzelne Proben sind älter als unser Sonnensystem.
Analog zu dem Irrgarten in der Erzählung «Der Garten der Pfade, die sich verzweigen», der sich beim Durchschreiten ständig ausdehnt und immer neue Wege schafft, vervielfachen die ständig neu sich öffnenden Flure im Haus die Möglichkeiten, das Haus auszukundschaften. Mit Borges «Aleph» – obwohl kaum grösser als eine Murmel, beinhaltete das Aleph den Kosmos, ohne «Schmälerung seines Umfangs»[11] – hat das Haus gemein, dass seine äusseren Abmessungen bestehen bleiben, obwohl es ein Universum an Räumen aufnimmt.[12] Im «Sandbuch» zerrinnt dem Ich-Erzähler das «heilige Buch», das er von einem Durchreisenden erwirbt, buchstäblich zwischen den Fingern, ohne sich allerdings in Nichts aufzulösen – im Gegenteil. Das Buch hat weder Anfang noch Ende, ist unendlich. Die Paginierung ist chaotisch, eine einmal aufgeschlagene Seite lässt sich kein zweites Mal finden. Ähnlich besteht im Haus jeder Raum nur für einen kurzen Moment. Setzen die Abenteurer ihren Weg fort, können sie nicht mehr zurück, bzw. der Ort, wo sie eben noch waren, ist ein anderer geworden. Auch Danielewskis typografische Kapriolen erinnern an das «Sandbuch». Ausserdem lässt er Navy bei dessen letzter Erkundigung das «House of Leaves» im Schein des Feuers lesen, das dieser jeweils mit jeder gelesenen Seite entzündet.
Was Borges fantasiert, versucht Danielewski zu kreieren. Ist das «Sandbuch» eine Allegorie des Allwissens und ein Tropus für Hugh Everetts 1955 –1957 formulierte Viele-Welten- Theorie[13], so ist das «House of Leaves» deren «Inkarnation». Und ebenso wie sich die Räume im Haus zu einem irren Raumgeflecht auswachsen, verästeln sich Text- und Autorenverweise zu einem enzyklopädischen Dschungel, der weniger mit einem traditionellen Labyrinth zu beschreiben ist als mit der Rhizom-Struktur des Internets. Die Merkzeichen, die Navy und seine Gefährten anbringen, um die Orientierung nicht zu verlieren, sind auf dem «Rückweg» zerfetzt, nur noch in Bruchstücken vorhanden, bis sie ganz verschwinden wie die Brotkrümel, die Hänsel und Gretel auf ihrem Weg in den Wald ausstreuen. Navy & Co. navigieren durch das Haus wie der Leser durch das Buch oder wie man durch das Internet surft. Die Fussnoten im Buch funktionieren wie Breadcrumbs[14] im Internet. Sie führen einen immer tiefer in das Geflecht des Hypertexts. Man wird – wenn überhaupt – nie auf demselben Weg zurückkehren, auf dem man hineingekommen ist.
Die Warnung, die Danielewski seinem Protagonisten in den Mund legt, ist berechtigt: «Und falls Sie irgendwann einmal zufällig an diesem Haus vorbeikommen sollten, bleiben sie nicht stehen, gehen Sie auch nicht langsamer, sondern laufen Sie einfach weiter. Da ist nichts. Seien Sie vorsichtig.»[15] Wer das Blaubart-Haus aber öffnet und der Verführung nicht widerstehen kann, es immer weiter zu erkunden, nehme sich Gaston Bachelards «Poetik des Raumes» als Vergil an die Seite.TEC21, Mo., 2008.10.20
20. Oktober 2008 Rahel Hartmann Schweizer