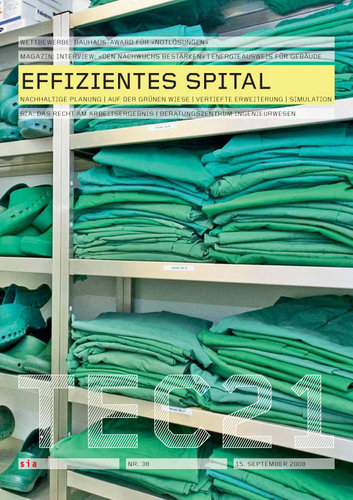Editorial
Die Formgebung für Spitalbauten passt sich den technischen und gesellschaftlichen Anforderungen an: Frühere Vorgaben und Ansichten sind jeweils in eingefrorener Form an und in ihnen wahrnehmbar. Um auf Veränderungen rasch und frühzeitig reagieren zu können, brauchen Planer nebst Kreativität und innovativen Ideen auch effi ziente Planungsansätze. Effizienz ist formalisiert dargelegt Nutzen geteilt durch Aufwand. Für hohe Effizienz muss der Nenner klein bzw. der Zähler gross gehalten werden – unterschiedliche Faktoren bewirken dies. In Bezug auf bauliche Planung von Spitälern greift TEC21 einzelne auf: Frühe strategische Schritte verhindern planerische Sackgassen mit Folgen für den baulichen, betrieblichen und fi nanziellen Aufwand («Nachhaltige Planung», S. 20 ff.). Planer erreichen eine langfristig erhöhte Effizienz, wenn sie für Aufwand sorgende Altlasten abwerfen und so einen Befreiungsschlag erwirken («Auf der grünen Wiese», S. 22 ff.). Bei gleich bleibendem Aufwand wird eine Effizienzerhöhung ermöglicht, wenn bestehende Ressourcen besser genutzt werden und echte (d.h. keine nachträglich rechtfertigte) und enge Zusammenarbeit zwischen Projektbeteiligten stattfindet («Vertiefte Erweiterung», S. 25 ff.). Ein höherer Wirkungsgrad wird erzielt, wenn zweckmässige technische Hilfsmittel überkommene Verfahren ersetzen und diese den aufwendigen Entscheidungsprozess rationell unterstützen («Planungsfreiheit durch Simulation», S. 28 ff.).
Effizienzsteigerung im Hinblick auf Rationalisierung ist ein kreativer und produktiver Prozess – nicht nur in der vielschichtigen und komplexen Spitalplanung. Meist nur negativ als Lohnkostensenkung wahrgenommen, kann sie durchaus positiv gewertet und als Fortschritt im Sinne einer Neugestaltung von Technik und Arbeitsabläufen unter ändernden Bedingungen gesehen werden – wenn nebst betrieblichen Kriterien auch soziale Aspekte berücksichtigt werden. Im Vorwort zu Sten Nadolnys Roman «Entdeckung der Langsamkeit» steht: «Von Kindheit an träumt John Franklin1 davon, zur See zu fahren, obwohl er dafür denkbar ungeeignet ist: Langsam im Sprechen und Denken, langsam in seinen Reaktionen misst er die Zeit nach eigenen Massstäben. Zunächst erkennt nur sein Lehrer, dass Johns eigenartige Behinderung auch Vorzüge hat – was er einmal erfasst hat, das behält er, das Einzigartige, das Detail begreift er besser als andere. Innerhalb des von John Franklin kaum begriffenen, chaotisch schnellen Geschehens sieht er einzelne Vorgänge wie in Zeitlupe ablaufen.» Er prägt sie sich langsam, aber beharrlich, konzentriert und bedächtig ein. Eine Gabe, die Geduld fordert und abverlangt, aber in der heute oft hektisch und oberflächlich funktionierenden Gesellschaft eine aussergewöhnliche Qualität hat und auch zu Effizienzsteigerung beitragen kann – es fragt sich nur, wie die Ziele gesetzt sind und mit welchem Aufwand sie erreicht werden dürfen.
Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Bauhaus-Award für «Notlösungen»
10 MAGAZIN
Interview: «Den Nachwuchs bestärken» | Energieausweis für Gebäude | UIA-Seminar zum Gesundheitswesen | Holzwerkstoffe in Innenräumen
20 NACHHALTIGE PLANUNG
Hans Eggen
Planung: Die Krankenhausnutzung ist einer ständigen Veränderung unterworfen. Um langfristig eine nachhaltige Planung zu gewährleisten, bedarf es eines Masterplans.
22 AUF DER GRÜNEN WIESE
Hans Haueter, Felix Hegetschweiler
Architektur: Das neue Zuger Kantonsspital konnte in Baar auf der grünen Wiese erstellt werden – eine seltene Situation in der Krankenhausplanung.
25 VERTIEFTE ERWEITERUNG
Jacqueline Geser, René Schütz
Ingenieurwesen: Die Erweiterung des St. Claraspitals in Basel musste wegen Platzmangels in der Vertikalen erfolgen. Angewandt wurde die Deckelbauweise.
28 PLANUNGSFREIHEIT DURCH SIMULATION
Markus Erb, Caroline Hoffmann
Ingenieurwesen: Das Energiekonzept der neuen Pathologie des Kantonsspitals St. Gallen wurde an verschiedenen Aspekten simuliert. Dies unterstützte den Entscheidungsprozess in der Planung.
32 SIA
Das Recht am Arbeitsergebnis | Hagel – die unterschätzte Gefahr | Beratung bei der Rechtsform | Beratungszentrum Ingenieurwesen
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Auf der grünen Wiese
Selten wird heute ein Spital auf der grünen Wiese gebaut. Beim Zuger Kantonsspital in Baar war dies der Fall: Mit der Wahl des Standorts schaffte der Kanton räumliche Freiheiten, um Funktionen zu konzentrieren und rationelle Strukturen zu erstellen. Das Ergebnis ist eine campusartige, erweiterbare Anlage mit einem kompakten Zentralspital; die Typologie des Bettenhochhauses wurde zugunsten kurzer Erschliessungswege und effizienter Betriebsabläufe verworfen. Nach siebenjähriger Planungs- und Ausführungszeit wurde das Gebäude am 30. August 2008 in Betrieb genommen.
Beim Neubau des Kantonsspitals in Baar strebte die Bauherrschaft – der Kanton Zug – eine kostenbewusste, zweckmässige und zurückhaltende Architektur an. Für die Projektfindung wählte sie das Verfahren des Gesamtleistungswettbewerbs. Damit war von Anfang an gesetzt, dass die teilnehmenden Teams als Totalunternehmen auftreten; eine Herausforderung bestand also darin, eine umfassende Kommunikation auf allen Ebenen zu generieren. Dank klarem Aufbau, kompaktem Volumen, guter Orientierung und kurzen Wegen wurde das Projekt «Vitale» zum Sieger erkoren – es war jedoch teuer. Daher galt es, nach der Vergabe die vom Kanton aufgetragene Einsparung von 20 % (rund 30 Mio. Fr.) umzusetzen. Der Betreiber, die Fachingenieure und die Spezialisten revidierten das Projekt in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Für den Betrieb wurden sinnvolle Standards festgelegt, im Gebäudevolumen und an den Nutzungsverteilungen Optimierungen durchgeführt. Ziel war es, die Technik so zu dimensionieren, dass möglichst viel ertragswirksame Fläche geschaffen werden konnte; dafür mussten auch ursprüngliche Annahmen im Interesse des Betriebs und der Funktionsfähigkeit modifiziert werden. Trotzdem konnte die Grundidee des Entwurfs beibehalten werden. Bei den Materialien achtete man nicht nur auf einen qualitativ zweckmässigen, einfachen und kostenbewussten Einsatz, sondern auch auf Natürlichkeit; so wurden zeitlose und langlebige Baustoffe gewählt, vielerorts Holzoberflächen und Natursteinböden eingesetzt.
Kompaktes Gebäude in campusartiger Anlage
Zentralspital, Pflegezentrum und Parkhaus bilden die Bausteine des campusartigen Kompetenzzentrums. Mit seiner klaren Setzung und seiner moderaten Höhe von rund 16 m fügt sich das Spital selbstverständlich in das Ensemble ein. Es erscheint als kompakter Baukörper mit verglasten Fassaden. Die Ausrichtung der Gebäude im Campus generiert eine zentrale Ost-West-Achse, die auf die künftige Entwicklungsrichtung ausgelegt ist, und schafft klare Aussenräume (Bilder 1 und 2). Das landschaftsarchitektonische Konzept unterscheidet drei Bereiche: innen liegende Gartenhöfe, platzartige Erschliessungsbereiche und eine parkartige Spitalumgebung. Der Grundriss des Kantonsspitals ist als Kammsystem organisiert. Damit erreichte das Planungsteam eine klare betriebliche Organisation mit kurzen Wegen und einer Entflechtung der Logistikwege. Die Nutzungsbereiche liegen zwischen der Eingangshalle im Norden – die den ambulanten Patientinnen und Patienten, den Besucherinnen und Besuchern sowie dem Personal zur Verfügung steht – und dem Erschliessungssystem im Süden, das für Bettentransporte und die gesamte Ver- und Entsorgung genutzt wird (Bild 3). Vertikal ist das viergeschossige Gebäude in zwei Hauptbereiche gegliedert: Ein zweigeschossiger Sockel nimmt alle Untersuchungs- und Behandlungsbereiche auf, während die Pflegestationen und die Frauenklinik in zwei darüber liegenden Stockwerken untergebracht sind (Bild 4). Zentrales verbindendes Element ist die in Teilbereichen zweigeschossige Eingangshalle.
Betriebs- und Nutzungskonzept
Die Eingangshalle bildet das Rückgrat des Gebäudes, von ihr aus werden alle Ebenen durch Aufzüge und Treppenhäuser erschlossen. Sie bietet Ausblick in die dahinter liegenden Untersuchungs- und Behandlungsbereiche und ermöglicht eine direkte Orientierung auf die Leitstellen, Aufnahmebereiche und Warteplätze; sie fungiert aber auch als Begegnungsraum mit Cafeteria, Kiosk, Sitzgelegenheiten und Personalrestaurant (Bilder 5 und 6). Der gesonderte Zugang zur Notfallaufnahme ist von der Zufahrt direkt zu erkennen und einfach zu erreichen. Notaufnahme und Radiologie sind eng miteinander verknüpft, sodass Letztere mit allen bildgebenden Verfahren (MRI, CT, Universalröntgen und Ultraschall) auf kurzen Wegen erreicht werden kann (Bild 3). Chirurgie, Anästhesie und Medizin einschliesslich der Funktionsdiagnostik sind im Erdgeschoss untergebracht. Das ambulante Zentrum, das ein hohes Patientenaufkommen aufweist, kann ebenerdig von der Halle aus erreicht werden; einzig die Zonen für länger dauernde oder wiederkehrende Behandlungen – wie Dialyse und physikalische Therapie – sind im ersten Obergeschoss untergebracht. Hier sind die Arztpraxen als eigener Bereich abgetrennt und auch von aussen erschlossen. Ebenfalls im ersten Obergeschoss befinden sich die OP-Abteilung mit den dazugehörenden Aufwachräumen, die Tagesklinik und die Intensivpflegestation. Die Pflegestationen im zweiten und dritten Obergeschoss sind in zwei doppelgeschossigen, dreibündigen Riegeln untergebracht (Bild 4). Diese werden durch offene Innenhöfe aufgelockert, die die Arbeitsräume und Stationsflure natürlich belichten, und sind über die zentrale Erschliessung der Eingangshalle zu erreichen. In jedem Riegel sind zwei Stationen hintereinander geschaltet, so dass Wege mit maximal 20 m von den Stationsbereichen in die Pflegezimmer gewährleistet sind. Auch hier erfolgt eine klare Trennung zwischen den Ver- und Entsorgungs- beziehungsweise den Liegendkrankenwegen, die über die Aufzüge im Süden abgewickelt werden. Im östlichen Teil des dritten Obergeschosses ist die Frauenklinik mit Maternité, Gebärabteilung und Gynäkologie angeordnet.
Haustechnik und Fassaden
Die Haustechnikzentralen befinden sich im ersten und zweiten Untergeschoss. Die Elektro- und Sanitärbereiche sind mittig (rechts vom «Ostkamm») angeordnet. Die Lüftungszentralen befinden sich jeweils an den Steigzonen, die zusammen mit den Liftschächten und Treppenhäusern am Rand der Nutzflächen positioniert sind (Bild 3). Zur Entflechtung der Hauptverteilungen trägt ein Installationskriechkeller unter dem ersten Untergeschoss bei. Ein durchgängiges System von Unterverteilräumen für Elektro- und EDV-Installationen ist geschossweise beziehungsweise bereichs- und brandabschnittsweise angeordnet. Die technische Erschliessung der Nutzflächen erfolgt ausschliesslich horizontal über die Decken nach unten. Damit kann die Flexibilität der Grundrissgestaltung gesteigert werden. Zur Flexibilität trägt auch die konsequente Trennung der Gebäudesysteme in Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur bei. Die Glasfassade bringt Tageslicht in die Innenräume. Die Fassaden der Pflegestationen sind mit aussen liegenden Lamellenstoren versehen und heben sich von der aussen bündigen, gebäudehohen Hallenverglasung und der Zweischichtfassade der Sockelgeschosse ab. Im Bereich der Innenhöfe erfolgt die Verschattung mittels aussen liegender Raffstoren. Die Steuerung des Sonnenschutzes erfolgt über ein Leitsystem aufgrund der Globalstrahlung, gemessen pro Fassadenorientierung. Bei den Zweischichtfassaden wird zudem die äussere Verglasung je nach der im Zwischenraum gemessenen Temperatur und Feuchte fassadenweise geöffnet und geschlossen. Lüftungsflügel ermöglichen eine individuelle natürliche Belüftung in Kombination mit der notwendigen mechanischen Hygiene- und Komfortlüftung.
Installationsfreundliches Tragwerk
Das konstruktive Primärsystem – die Tragstruktur – ist durchgehend als Stahlbetonskelett mit Schleuderbetonstützen im Raster von 8 × 8 m ausgebildet. Dank einbetonierten Stahlpilzen lassen die unterzugslosen Flachdecken eine problemlose vertikale Verteilung der technischen Installationen im Stützenbereich zu. Diese Art der Durchstanzsicherung ermöglicht eine Leitungsdurchführung bis zu einem Durchmesser von 150 mm an jeder Stützenseite. Für spätere Aufrüstungen können diese Durchdringungen nachträglich gebohrt werden: Die Lage der oberen Tragbewehrung wurde dafür exakt positioniert. Die Kernzonen aus Beton gewährleisten die Erdbebensicherheit des Gebäudes. Im Bereich der Steigzonen musste die Kernsteifigkeit stark abgemindert werden, da grosse Wandöffnungen für die Einführung der technischen Installationen notwendig waren. Die Breite der Deckendilatationsfugen in den oberen Geschossen beträgt bis zu 40 mm, um ein Aufeinandertreffen der einzelnen Deckenabschnitte bei unterschiedlicher Schwingrichtung zu verhindern.TEC21, Mo., 2008.09.22
22. September 2008 Hans Haueter, Felix Hegetschweiler