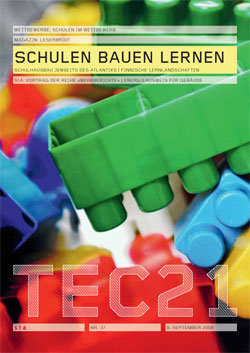Editorial
Ganz neu sind sie nicht, die pädagogischen Erkenntnisse, die es im heutigen Schulhausbau architektonisch umzusetzen gilt. Die Durchmischung der Jahrgänge im Unterricht beispielsweise hatte bereits Maria Montessori (1870–1952) gefordert; Rudolf Steiners 1907 erschienene Schrift «Die Erziehung des Menschen vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft» postulierte eine ausgewogene Förderung der intellektuell-kognitiven, künstlerisch-kreativen und handwerklich-praktischen Fähigkeiten der Kinder; und als die Erlebnispädagogik um 1930 ihren ersten Höhepunkt erreichte, gehörte selbstständige Projektarbeit zu ihren wichtigsten Komponenten.
Auch die Beschäftigung von Architektinnen und Architekten mit pädagogischen Konzepten wie ganzheitliche Förderung, individuelle Entfaltung oder Erziehung zur Sozialkompetenz hat eine längere Geschichte. Alfred Roth hat in seinem Buch «Das neue Schulhaus»[1] eine Reihe von beispielhaften Bauten versammelt, von denen viele bis heute nichts von ihrem Vorbildcharakter eingebüsst haben: Hans Scharouns 1958–1961 erbautes Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lünen etwa weist neben fliessenden Erschliessungs- und Kommunikationsräumen auch «Klassenwohnungen» – heute würde man sagen: Cluster – auf, die jeweils aus Garderobe, Hauptraum, Gruppenraum und Gartenhof zusammengesetzt sind. Den Gedanken, dass das Schulhaus als zweites Zuhause fungieren und die Kinder zu mündigen, demokratisch denkenden Bürgerinnen und Bürgern erziehen solle, hatte Scharoun bereits in seinem 1951 publizierten Entwurf «Volksschule Darmstadt» zum Ausdruck gebracht.
Dennoch haben die Schulhäuser, die in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz gebaut wurden, solche reformerischen Konzepte in der Regel kaum berücksichtigt. Trotz teilweise bemerkenswerten Leistungen auf gestalterischem oder technischem Gebiet weisen die meisten eine konventionelle Raumgliederung auf. Gebäude wie das Schulhaus im Birch von Peter Märkli in Zürich Oerlikon (2004) oder das im Bau befindliche Schulhaus Leutschenbach von Christian Kerez stellen noch Ausnahmen dar. In Finnland dagegen hat man mit der Umsetzung neuer, sich wandelnder Schulkonzepte breitere Erfahrung, und auch in den USA finden sich innovative Beispiele. Daher widmet sich dieses Heft einer Auswahl jüngerer Bauten aus diesen beiden Ländern – denn entgegen dem Sprichwort sollten wir nicht nur für das Leben, sondern eben auch für die Schule lernen.
Judit Solt
Anmerkungen
[1] Alfred Roth: The New Schoolhouse. Das Neue Schulhaus. La Nouvelle Ecole. 4. Auflage, Verlag für Architektur (Artemis), Zürich 1966
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schulen im Wettbewerb
13 MAGAZIN
Leserbrief
18 SCHULHAUSBAU JENSEITS DES ATLANTIKS
Markus Ziegler
Öffentliche Schulen in den USA spüren den Druck der privaten Konkurrenz und daher auch die Notwendigkeit, neue Raumkonzepte zu erproben – ein erfolgreiches Beispiel aus Minneapolis.
24 FINNISCHE LERNLANDSCHAFTEN
Ulrike Altenmüller
Finnland steht Innovationen im Bildungswesen offen gegenüber. Dank dem Fehlen starrer Baugesetze können neue Erkenntnisse rasch in architektonische Form gebracht werden.
34 SIA
Vortrag der Reihe «Werkberichte» | Nachruf Prof. Dr. Bruno Thürlimann | Energieausweis | Marketing, Werbung, PR
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Finnische Lernlandschaften
Finnland steht Innovationen im Bildungswesen aufgeschlossen gegenüber. Dank dem Fehlen starrer Baugesetze und einer gut eingespielten Diskussionskultur zwischen den Entscheidungsträgern können neue Entwicklungen – klassenübergreifende Gruppenarbeit, individuelle Förderung, kooperative Unterrichtsmethoden oder exploratives Lernen – rasch in architektonische Form gebracht werden. Meist sind die Gebäude nicht nur vom Schulbetrieb flexibel nutzbar, sondern stehen auch der Bevölkerung zur Verfügung.
Das finnische Bildungswesen gilt als eines der besten und leistungsstärksten der Welt und steht im Ruf, landesweit in allen sozialen Schichten ein hohes Bildungsniveau zu erzielen. Die Transparenz und die Flexibilität einer dezentral organisierten Verwaltung erlauben es, schnell und unkompliziert auf neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen oder auf spezifische lokale Bedürfnisse zu reagieren. Dies gilt sowohl für das gesamte Schulwesen als auch für den Schulhausbau. Anhand zweier gebauter Beispiele werden im Folgenden einige der wichtigsten Funktions-, Raum- und Gestaltungskonzepte erläutert, durch die sich zeitgenössische Schulen in Finnland auszeichnen und die sich in den vergangenen Jahren bewährt haben.
Aurinkolahti-Schule, Helsinki
Die 2002 erbaute Aurinkolahti-Schule in Helsinki ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, aus dem der Entwurf von Jeskanen-Repo-Teränne & Leena Yli-Lonttinen als Sieger hervorging. Erklärtes Ziel der Auslobung war es, ein Lernumfeld zu schaffen, in dem die Schulkinder – gemäss dem vorgesehenen neuen pädagogischen Konzept – aktiv und eigenverantwortlich im Selbststudium, aber auch in der Gruppe lernen können. Daher sollte eine Atmosphäre geschaffen werden, die sowohl die Interaktion innerhalb der Gruppe als auch den Austausch mit der Umgebung fördert.
Wie viele andere Schulen in Finnland steht auch diese in unmittelbarer Nähe eines Parks und öffentlicher Sportanlagen, die den Schülerinnen und Schülern offen stehen. Das Gebäude selbst dient nicht nur als Ausbildungsstätte und Arbeitsplatz, sondern auch als kulturelles Begegnungszentrum für den umgebenden Stadtteil; ausserhalb der Unterrichtszeiten steht es der Nachbarschaft zur Verfügung. Für die meisten Kommunen ist eine derart erweiterte Nutzung von Schulgebäuden und deren Ausstattung auch wirtschaftlich sinnvoll, da die hochwertigen Investitionen deutlich besser ausgelastet sind.
Um die erweiterte Nutzung zu ermöglichen, sind viele finnische Schulbauten in kleinere Gebäudeteile oder Einheiten aufgegliedert, die sich um einen grosszügigen, zentralen Gemeinschaftsbereich gruppieren. Dieser bildet mit Bibliothek, Bühne, Aula und Cafeteria häufig den kommunikativen Mittelpunkt des Gebäudes und das multifunktionale Herz der Schule. Als offener Raum verknüpft er die verschiedenen Teilbereiche der Anlage funktional und optisch – und schafft dabei auch räumliche Grosszügigkeit. Die einzelnen Gebäudeteile sind durch eine dezentrale Erschliessung kontrolliert zugänglich. Zum einen ergibt sich dadurch die Möglichkeit, sie auch abends oder an den Wochenenden voneinander unabhängig zu nutzen. Zum anderen werden die Verkehrsflächen insgesamt deutlich seltener frequentiert. Die daraus resultierende Ruhe innerhalb des Bauwerkes und die Grosszügigkeit der Korridorflächen lassen es zu, die Verkehrsflächen als Aufenthalts- oder zusätzliche Unterrichtsbereiche zu nutzen. Damit erhöht sich der Anteil der Nutzfläche gegenüber dem der Nebenflächen. Dank dieser geschickten Raumorganisation werden Funktionserweiterungen und Mehrfachnutzungen erreicht, ohne dass die Baukosten in die Höhe getrieben würden. Transparenz und ein hohes Mass an räumlich-visueller Kommunikation vermitteln ein Gefühl der Sicherheit.
Flexible nutzbare Cluster und Klassenzimmer
Durch neue Unterrichtsmethoden und Lerninhalte hat der Schulbetrieb in Finnland umfassende Veränderungen erfahren, die besonders grossen Einfluss auf die Arbeit im Klassenzimmer hatten. Die Aneignung von Wissen entwickelt sich zunehmend zu einem aktiven Prozess, in dem die Lernenden mit explorativen, experimentellen und kooperativen Unterrichtsmethoden arbeiten: Die Schülerinnen und Schüler sollen unterschiedliche Lernstrategien als mögliche Methoden kennen lernen, um auch ohne Anleitung am Prozess des lebenslangen Lernens teilnehmen zu können.[1]
Die vermehrte Wissensvermittlung in Gruppen- und Projektarbeit, die eigenständige Recherche am Computer, erweiterte Aktivitätsprogramme der Schule im Ganztagesbetrieb und die zunehmende Individualisierung des Lernprozesses wirkten sich besonders stark auf die Raumprogramme und die innere Struktur der Schulen aus. In der Aurinkolahti-Schule findet der Unterricht in Klassenclustern statt: Die Räume sind um einen gemeinschaftlichen Aufenthalts- und Lernbereich gruppiert, der über grosszügige Glasflächen mit den Klassenzimmern verbunden ist. Dass die Schulkinder zunehmend in Kleingruppen oder in Einzelbetreuung gefördert werden, erhöht wiederum den Bedarf an unterschiedlich grossen und verschieden ausgestatten Unterrichtsräumen beziehungsweise Werkstätten.
Hiidenkivi-Schule, Helsinki
Die 2005 fertiggestellte Hiidenkivi-Schule in Helsinki von Seppo Häkli veranschaulicht, wie das Lernen und Lehren in Klassengruppen stattfinden kann. Klassenzimmer unterschiedlicher Grösse sind zu räumlichen Einheiten zusammengefasst, die mit einem zu den Unterrichtsräumen verglasten Gemeinschaftsbereich, eigenen Nebenräumen sowie einem Zugang zu den Aussenanlagen ausgestattet sind. Auch die Arbeitsräume der Lehrpersonen gehören häufig zum Raumangebot der Klassen-Cluster; Verbindungstüren zwischen den Klassenzimmern laden zum gruppenübergreifenden Unterricht ein. Viele Pädagoginnen und Pädagogen haben festgestellt, dass diese räumliche Organisation schülerzentrierte Unterrichtsmethoden unterstützt und zu einem höheren Grad an Identifikation mit der Bildungsanstalt führt: Schulkinder und Lehrpersonen fühlen sich zu Hause, Vandalismus ist nahezu unbekannt.Die Differenzierung des Unterrichtsraumes in verschiedene Zonen – das heisst: die Abweichung vom klassischen rechteckigen Klassenzimmer mittels Ecken, Nischen, in manchen Schulen auch Emporen – lädt zu wechselnden Bespielungsarten und variierenden Lehrmethoden ein. Die aus leichten, flexiblen Tischen und Stühlen sowie aus rollbaren Regalen und Containern bestehende Möblierung erlaubt es, die Klassenzimmer für verschiedene Lernszenarien schnell neu zu arrangieren; insbesondere in Primarschulen werden den Kindern oft Sofas und Nischen als zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten angeboten. Einbaumöbel mit ausreichend Stauraum vervollständigen in der Regel die Ausstattung der Klassenzimmer. In allen Unterrichtsräumen steht technisches Gerät auf dem jeweils aktuellen Stand zur Verfügung.
Diskussionskultur statt baugesetzlicher Vorlagen
In den vergangenen Jahren sind in Finnland immer wieder Funktions-, Raum- und Gestaltungskonzepte[2] entstanden, die das Erlernen von sozialen Kompetenzen, Teamfähigkeit und Gruppenarbeit fördern. Viele Neubauten bilden heute einen geeigneten Rahmen für soziale Interaktion und stetiges Lernen. Dennoch müssen sie adaptierbar sein, um zukünftige pädagogische Innovationen zuzulassen und im besten Fall zu unterstützen. Gleichzeitig – und im Widerspruch zu diesem Flexibilitätsanspruch – wird auch eine hohe Funktionalität gefordert, die lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse berücksichtigt.
Der Umstand, dass es in Finnland kaum restriktive gesetztliche Vorgaben im Schulhausbau gibt, hat die neuen architektonischen Konzepte sehr gefördert. In den Rahmenlehrplänen und Bildungsstandards haben die Empfehlungen für die Gestaltung der Lernumgebung3 den Charakter einer generellen architektonischen Qualitätsbeschreibung, die genügend Raum für spezifische, auf die funktionalen und pädagogischen Konzepte der jeweiligen Schule abgestimmte Lösungen lässt. Bei der Ausarbeitung und der Umsetzung von Schulbauvorhaben stehen heute Behörden, Lehrpersonen und Architekturbüros in einem engen Dialog, der auf nationaler Ebene vom Zentralamt für Unterrichtswesen, auf lokaler Ebene von Schulbeziehungsweise Bauämtern moderiert wird. In intensiver Kooperation werden innovative Ansätze diskutiert, um angemessen auf die veränderte Erziehungswirklichkeit in den Schulen reagieren zu können.
Die Frage, inwiefern die architektonische Gestaltung der Lernumgebung zum Erfolg der finnischen Schulkinder bei internationalen Vergleichsstudien beiträgt, kann nicht abschliessend beantwortet werden: Der konkrete Einfluss des Bauwerkes auf die schulischen Leistungen kann weder absolut noch relativ mit wissenschaftlicher Aussagekraft gemessen werden. Dennoch bleibt festzustellen, dass die erwähnten architektonischen Parameter – vor allem in ihrer Kombination – die Vermutung nahe legen, dass eine angenehme, ästhetisch hoch stehende und funktionale Lernumgebung positive Effekte auf das Lernverhalten der Schulkinder und auf das Wohlbefinden aller Nutzerinnen und Nutzer hat. Die architektonische Qualität von Schulbauten, die Ausstattung und die Gestaltung von Unterrichtsräumen sind ein Spiegelbild der Wertschätzung, die eine Gesellschaft der Bildung entgegenbringt. Das Beispiel Finnland zeigt, dass Investitionen in die Ausbildung der Bevölkerung und insbesondere der Kinder sich trotz einem gewissen fi nanziellen Aufwand letztlich immer auszahlen – als Investitionen einer Gesellschaft in ihre eigene Zukunft.
Anmerkungen
[1] Kaisa Nuikkinen: En sund och trygg skolbyggnad. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen, Helsinki 2005, S. 12 ff .
[2] Vgl. Ulrike Altenmüller: Koulu – Schule auf Finnisch. Funktions-, Raum- und Gestaltungskonzepte für zeitgenössische Schulen in Finnland. Dissertation, Fakultät Architektur, Bauhaus- Universität Weimar 2008. In der Arbeit werden zahlreiche zeitgenössische finnische Schulgebäude analysiert. Aus diesen Betrachtungen ergaben sich oben genannte, wiederkehrende Parameter, die als allgemeine Tendenzen im Schulbau des nordischen Landes gewertet werden können
[3] Vgl. Zentralamt für Unterrichtswesen (Hrsg.): Rahmenlehrpläne und Standards für den grundbildenden Unterricht an finnischen Schulen. Edita Prima Oy, Helsinki 2004, S. 19 ff .: «Unter ‹Lernumgebung› [verstehen wir] die mit dem Lernen verbundene physische Umgebung sowie die Gesamtheit der physischen Faktoren und sozialen Beziehungen, in denen der Wissenserwerb und das Lernen erfolgt. Zum physischen Lernumfeld zählen insbesondere das Schulgebäude, die Schulräume, die Unterrichtsmittel und Lernmaterialien. Dazu gehören auch die sonstige bebaute Umgebung der Schule und ihre natürliche Umwelt.» In den Rahmenlehrplänen und Standards für den grundbildenden Unterricht des Zentralamtes für Unterrichtswesen wird der Durchführung des Unterrichts ein eigenes Kapitel gewidmet. In diesem werden unterschiedliche Bereiche betrachtet, die über die Grundlagen des Rahmenlehrplanes hinausgehen. Die Vermittlung von Lernstrategien, Arbeits- und Motivationsmethoden, der Handlungskultur mit ihren Verhaltensmustern, Werten und Prinzipien wird dort ebenso beschrieben wie die Grundlagen der Lernumgebung, also der Räume, in denen Lehren und Lernen stattfindetTEC21, Mo., 2008.09.08
08. September 2008 Ulrike Altenmüller