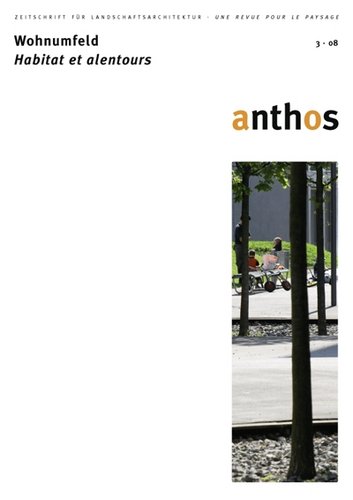Editorial
In der Schweiz gibt es heute 3,8 Millionen Wohnungen für 7,6 Millionen Menschen. Jährlich werden rund 40 000 zusätzliche erstellt, eine Sättigung ist nicht in Sicht. Mit existenzieller Notwendigkeit hat dieser Neubau nichts zu tun. Wir bauen heute für den Wohlstand, für einen immer höheren Wohnungsstandard.
Die Qualität der Wohnungen spiegelt sich jedoch wenig in der Architektur und – von Ausnahmen abgesehen – schon gar nicht im Städtebau wider. Bauliches Chaos und Beliebigkeit dominieren das Siedlungsbild landauf, landab. Einzelne architektonische Perlen können da nichts retten. Im städtischen Kontext entstehen seit den 90er-Jahren meist Grossformen mit hoher – oft unbewältigter – Ausnutzung, einfache Kuben mit viel Glas, grossen Balkonen oder Loggien. Bauliche Dichte ist das Kredo. Soziale Dichte und Nutzungsvielfalt – elementare Bedingungen für Urbanität – bleiben auf der Strecke. Das Denken hört in der Regel an der Parzellengrenze auf.
Natürlich versuchen die Städte, in ihren Entwicklungsgebieten mit kooperativen Planungs- und Projektierungsverfahren bessere Lösungen zu erarbeiten, bei denen auch freiraumplanerische Überlegungen eine Rolle spielen, wie wir in anthos 4/07 («Entwicklungsgebiete») gezeigt haben. Doch zur Rendite gibt es scheinbar keine Alternative.
Zum Wohnen gehört auch das Wohnumfeld, der Freiraum – seine soziale, ästhetische und ökologische Qualität, seine Nutzbarkeit. anthos 3/08 setzt hier einen Schwerpunkt. Vorgestellt werden landschaftsarchitektonische Lösungen in verschiedenen neueren Siedlungen. Thema ist aber auch die Erneuerung von Siedlungen früherer Jahrzehnte mit ihrem Wohnumfeld, wie die der Genossenschaftssiedlungen in Schwamendingen oder der Cité Radieuse von Le Corbusier.
Einen Kontrapunkt zu den aktuellen Grossformen wie auch zu den üblichen freistehenden Einfamilienhäusern der Peripherie setzt das niederländische Vinex-Konzept. Ebenfalls dicht gebaut – Grundtyp ist das Reiheneinfamilienhaus –, sind die Siedlungen familienfreundlich, haben grosse Wohnungen und einen eigenen Garten, die Quartiere sind gesamthaft attraktiv gestaltet.
Landschaftsarchitektur darf sich nicht in der Gestaltung des einzelnen Objektes erschöpfen. Diese ist wichtig, aber allein nicht genügend. Sie muss sich massgebend in die Entwicklung eines übergeordneten städtebaulichen Konzeptes einbringen, neuen Siedlungen eine robuste Struktur geben, die im Idealfall der baulichen Entwicklung vorauseilt, wie der Beitrag «Weitblick» zeigt.
Bernd Schubert
Inhalt
- Editorial
Hansjörg Gadient
- Weitblick
André Schmid
- Randlage wird zur Stadt –Wohnsiedlung Werdwies, Zürich
Catherina Bauer
- Zwischen Stadt und Land – Aspholz Nord Zürich
Roland Raderschall
- Stadtsiedlung Talwiesen
Han van de Wetering
- Das Vinex-Konzept
Raymond Vogel
- Wohnräume sind Lebensräume
Pascal Heyraud und Stéphane Collet
- Interview: Edouard François, die Kunst lebendiger Architektur
Nathalie Mongé
- Das dem Aussenraum gewidmete Gebäude
Cristina Woods und Craig Verzone
- «La Cité Radieuse» und ihr Garten
Daniel Keller
- Freiraumqualität und bauliche Verdichtung in Schwamendingen
Bettina Tschander
- Ökologischer Ausgleich und Dachbegrünung
- Porträt
- Schlaglichter
- Mitteilungen der VSSG
- Wettbewerbe und Preise
- Mitteilungen des BSLA
- Agenda
- Literatur
- Bezugsquellen Schweizer Natursteine
- Bezugsquellen Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Impressum
Stadtsiedlung Talwiesen
Das in sich geschlossene vormalige Gewerbeareal in der Binz, Zürich Wiedikon, hat sich in den letzten vier Jahren zu einem lebendigen, offenen Stadtquartier entwickelt.
Das ehemalige Werkhof- und Gewerbeareal der Baufirma Hatt-Haller war jahrzehntelang eine unpassierbare Insel im Wohnquartier, die wichtige Stadtbezüge innerhalb von Wiedikon voneinander abschnitt. Heute sind zwei Bauetappen der neuen Stadtsiedlung Talwiesen Binz ausgeführt und zum Teil seit Jahren bewohnt, die dritte befindet sich im Bau, die vierte und letzte ist in Planung.
Ein neuer Stadtteil entsteht
Aus dem ehemaligen «Sperrgebiet» ist ein neuer Stadtteil gewachsen, der die Quartiere der Binz untereinander verbindet. 1999 bestimmte ein Studienverfahren die zukünftige Stadtstruktur in diesem sich stark verändernden Quartier. Vor rund zehn Jahren begann die heutige Implenia das Areal zu entwickeln.
Vier lange von Nordwest nach Südost verlaufende Gebäudezeilen bilden breite, gassenartige Räume. Die vier- bis sechsgeschossigen Gebäude mit an den Enden höheren Kopfbauten springen in der Breite leicht vor und zurück und formen damit trotz ihrer Länge abwechslungsreiche Räume. In der Mitte rahmen die Baukörper den grossen zentralen Platz, an dem Ateliers, Läden und Bistros in Zukunft öffentliches Leben entfalten sollen. Zwei Wasserinstallationen untermalen die Situation. Tiefgaragen sammeln an den Kopfenden den Fahrzeugverkehr, sodass oberirdisch nur wenige Besucherparkplätze am Rande angeordnet sind. Damit ist die Siedlung frei von Autos. Querende Verbindungen komplettieren das lineare Wegsystem. Sie bilden eine feine Vernetzung und eine Abfolge von unterschiedlichen Platz- und Grünflächen. Die Gassen werden grundsätzlich in urbane und in gartenartige Räume unterschieden, die sich abwechseln. Da alle Wohnungen nach zwei Seiten orientiert sind, hat jede Ausblick auf die beiden unterschiedlichen Freiraumstimmungen.
Pocketparks
Die jeweils aussen liegenden, an die gewachsene Stadt angrenzenden Zonen mit ihren gegebenen Formen und Flächen sind als kleine Parkanlagen ausgebildet. Der spärlich vorhandene Baumbestand wurde integriert und vermittelt so von Beginn an einen reifen Eindruck der Anlage. Sitzplätze, eine Pergola und Spielflächen für Kleinkinder bestücken die nördliche der beiden Flächen. Wilder Wein berankt den mehrere Meter hohen Geländesprung zu den bestehenden Gärten entlang der Haldenstrasse. Kleine intime Sitzplätze formulieren die konstruktiv notwendigen Nischen im Mauerwerk aus. Eine extensive Grünfläche, Kräuterwiese ohne Möblierung, bildet im Süden einen kleinen Park. Bereits vorhandene Nuss- und Obstbäume wurden ergänzt, eine blühende Wildhecke verdichtet, sie schirmt so eine bestehende Trafostation ab.
Boulevard und Stadtgarten
Die drei innen liegenden Freiräume erhielten eine gänzlich neue Gestaltung. Der obere nördliche Stadtraum ist als breiter Boulevard ausgeführt. Eine Abfolge kleiner Kiesplätze, deren Baumbestand gesamthaft eine lange Allee bildet, liegt zwischen zwei Wegverbindungen. Ein übergeordneter städtischer Fahrradweg nutzt den Boulevard zur Durchquerung der Talwiesen-Siedlung. Vierer-Baumsetzungen formulieren die Köpfe der Allee am Siedlungsrand aus. Fest installierte Spielthemen gestalten den südlichsten und kürzesten der drei Gassenfreiräume als eigentliche Spielzone mit Torwand, Wasserschlange, Spielsand. Weitere Installationen bestücken kleine baumbestandene Platzfolgen und begleiten den Strassenraum, der am Ende in einen dreieckigen Spielgarten mit seinen Heckenräumen einmündet. Der in der Mitte liegende Freiraum ist als Stadtgarten – ganz im Unterschied zu den eben beschriebenen Zonen – angelegt. Ein langes Rasenband, von Bäumen gesäumt, durchzieht den Siedlungsraum. In die Rasenstücke wurden Heckenzimmer als in sich geschlossene, intime Gartenräume eingeschrieben, in denen kleine überrankte Folies stehen, die von blühenden Hortensien oder grossen Ziergräsern eingefasst werden. Im Unterschied zu den offenen, städtischen Gassen entstehen hier ruhige Rückzugsräume, die bei Nacht entsprechend zurückhaltender beleuchtet sind als die urbanen Räume.
Wohnungsfreiräume
Fast alle 370 Wohnungen verfügen über einen privaten Freiraum. Die oberen Wohnungen haben grosszügige Dachterrassen mit gedeckten Bereichen. Während die mittleren Geschosse markante auskragende Balkone aufweisen, haben die Erdgeschosswohnungen beidseitig Terrassen oder Sitzplätze, die auf die Strassenzüge orientiert sind. Die Entlüftungen der Tiefgaragen wurden als räumliche Elemente ausgebildet, die den Terrassen Rückhalt und Schutz bieten. Davor liegende Gehölzstreifen gewähren weiteren Sichtschutz und Privatsphäre.
Vegetation und Stadtraum
Ein differenziertes Vegetationskonzept unterstützt die rigide Gliederung und Typisierung der Siedlungsräume. Jeder Gassenraum erhält einen eigenen «Leitbaum». Spitzahorne (Sorte Cleveland) bilden im Boulevard die Baumreihen, die begleitenden Sträucher vor den privaten Terrassen sind japanische Ahorne. Zuckerahorne prägen die Spielgasse, während es im Stadtgarten Kirschbäume und -sträucher sind, die mit ihren Blüten die Atmosphäre unterstützen.anthos, Fr., 2008.09.12
12. September 2008 Roland Raderschall