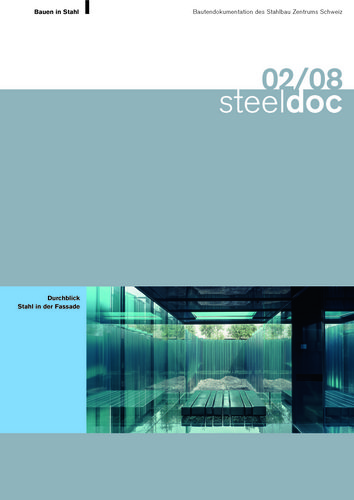Editorial
Stahl in der Fassade ist meistens Nebensache. Er soll möglichst nicht in Erscheinung treten, denn er dient ja bloss als Träger anderer, meist lichtdurchlässiger Materialien. Doch es kann auch ganz anders sein. Wenn Stahl in der Fassade sichtbar trägt und nicht nur hintergründig stützt, wird er zum Ornament. Natürlich ist Stahl an und für sich nicht lichtdurchlässig, aber er ist doch so form- und faltbar, dass das Licht ihn zu einem skulpturalen Element erhebt. Weil Stahl so eine elementare Kraft besitzt, wäre es geradezu unsinnig, eine solche Fassadenskulptur nicht gleich als Tragelement zu nutzen und dabei seine charaktervolle Materialpräsenz zu inszenieren. Wenn es dabei noch gelingt, mit Licht- und Schattenspiel dem Stahl jegliche Schwere zu nehmen, ist die Kunst vollendet.
Im vorliegenden Steeldoc zeigen wir, wie man das macht – und zwar detailgenau. Dass die Japaner Meister der ruhenden Leichtigkeit sind, anerkennen wir Europäer vorbehaltlos. So hat der Architekt Jun Aoki ein luftig leichtes und doch in sich ruhendes Raumvolumen für eine Hochzeitskapelle geschaffen. Dort trägt eine aus Stahlringen gewobene Struktur das Dach. Den Raum in Licht und Schatten taucht auch die Dachlaterne der Synagoge in München. Die Konstruktion ist eine Art Zelt mit einer ornamentalen Fachwerkkonstruktion als Tragstruktur und einem transparenten Metallgewebe als Hülle – ein Gedenken an das Zelt Jakobs. Beim Sammlungszentrum des Schweizer Landesmuseums in Affoltern am Albis tritt Stahl als Schutzschild gegen die Spuren der Zeit in Erscheinung.
Unbehandelte Stahlplatten, durchbrochen von einer zarten Linie, welche die Topographie der Alpenkette symbolisiert, trotzen Wind und Wetter. Stahl wird hier greifbar und in einer rohen, archaischen Weise zu einem natürlichen Schmuck der Fassade. Schliesslich folgt die fast vollständige Auflösung der Hülle in einem Hotel in Nordspanien. Hier verschwimmt die Grenze zwischen Aussen und Innen durch ein Verweben transparenter und metallischer Strukturen. Die Elemente Wasser, Erde, Licht und Metall sind zu einer verwirrenden,betörenden Komposition gefügt, der man sich am Ende widerstandslos ergibt. Es gibt hier nichts zu verstehen, sondern nur zu empfinden.
Allen Projekten ist gemein, dass sie Stahl als sichtbares Tragelement sinnlich erfahrbar machen. Und es ist wie mit allen Dingen: ein Element alleine genügt nicht. Stahl wird dann wirklich schön, wenn er in einem harmonischen Gefüge von harten und weichen Elementen seinen Ausdruck findet. Deshalb gilt hier die Hommage weniger dem Material, als dem Genie seiner «Schmiede». Wir wünschen viel sinnliches Vergnügen beim Studium und der Lektüre nachfolgender Seiten.
Inhalt
03 Editorial
04 Hochzeitskapelle White Chapel, Osaka
Herr der Ringe
10 Synagoge Ohel Jakob, München
Ein Zelt aus Stahl
16 Sammlungszentrum Landesmuseum, Affoltern a. A.
Schutzschild gegen die Spuren der Zeit
22 Restaurant und Hotel Les Cols, Olot, Spanien
Im Reich der Elemente
27 Impressum
Schutzschild gegen die Spuren der Zeit
Fast 5000 Quadratmeter unbehandelter Stahl umhüllen das Sammlungszentrum des Schweizer Landesmuseums wie eine Rüstung. Das archaisch anmutende Material beginnt, die Spuren der Zeit zu tragen – so wie die gelagerten Exponate ihre Spuren in der Zeit hinterlassen haben. Das Gebäude versinnbildlicht das Verhältnis der Schutzhülle zum Inhalt, die Grenze zwischen Vergänglichkeit und Beständigkeit.
Am Anfang war ein ungenutzter, ehemaliger Militärkomplex in Affoltern am Albis und die auf sieben Depots verteilten Sammlungsbestände der Schweizer Landesmuseen mit rund 800'000 Objekten. Heute ist daraus ein Ort von starker Identität geworden – zum Sammeln, Erhalten und Forschen. Das neue Sammlungszentrum der Musée Suisse Gruppe (MSG) kann nun sämtliche Bestände aufnehmen, die seit der Gründung des Schweizer Landesmuseums vor über 100 Jahren an verschiedenen Orten gelagert werden mussten. Erstmals erhält auch das interessierte Publikum Zugang zu den Depots, Ateliers und dem Labor.
Die ehemalige Zeughausanlage der Landesverteidigung von 1937 wurde bereits1980 saniert und zu einem Komplex aus drei rechteckigen Gebäudekörpern erweitert. Ziel der jüngsten Intervention war es, für die neue Nutzung als Sammlungszentrum des Landesmuseums so viel vorhandene Bausubstanz wie möglich zu nutzen und gleichzeitig einen funktionalen Gebäudekomplex mit zeitgemässem Energiekonzept zu schaffen. Die Hülle des Gebäudes aus massiven, rohen Stahlplatten symbolisiert Kraft und Beständigkeit – paradoxerweise gerade durch den sichtbaren, aber schadlosen Alterungsprozess des Stahls.
Interdisziplinäre Nutzung
Die Anlage fasst die drei bestehenden Gebäudekörper durch Korridore zusammen. Dazwischen liegen zwei Innenhöfe. Der Gebäudekomplex bildet damit ein flexibles System, das an einen Strichcode als moderne Metapher für präzise Zuordnung und Individualität erinnert. Tatsächlich garantiert er für eine Vielzahl hoch spezialisierter Experten optimale Arbeitsabläufe und fördert den interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaftlern, Historikern und Restauratoren. Der grösste monolithische Baukörper ist das eigentliche Objektzentrum, bezeichnet als Gebäude 1. Es gewährleistet auf rund 10'000 Quadratmetern und drei Geschossen optimale klimatische und sicherheitstechnische Bedingungen für die Aufbewahrung der Sammlungsbestände. Im zweigeschossigen Gebäude 2 sind die Ateliers der Konservatoren und Restauratoren sowie das Labor der Konservierungsforschung und Materialanalytik untergebracht. Im Gebäude 3 befindet sich das Dienstleistungszentrum mit zentralem Empfang und den Räumen für die Registrierung, den Leihverkehr und die fotografische Dokumentation. Neben einer Fachbibliothek mit kleinem Lesesaal stehen ein Seminar- und Schulungsraum sowie Arbeitsplätze für Gäste, Mitarbeiter des Landesmuseums sowie für externe Wissenschafter zur Verfügung.
Unbehandelter Stahl in nuancierter Anwendung Identitätsstiftendes Element der ganzen Anlage ist die monolithische Fassade aus unbehandeltem Stahlblech, das bereits nach kurzer Zeit eine rostrote Färbung annimmt. Die 12 Meter hohen und 2,80 Meter breiten Stahlplatten des Objektzentrums sind getrennt durch eine horizontal verlaufende gezackte Linie. Sie repräsentiert die «Höhenabwicklung entlang der Schweizer Grenze», vom südlichsten Grenzpunkt bei Chiasso (232 m ü. M.) bis zum höchsten am Monte Rosa (4633 m ü. M.). Diese Fuge ist nicht nur bautechnisch notwendig, sondern verweist symbolisch auf den Inhalt des Gebäudes: Schweizerisches Kulturgut. Der bestehende Massivbau des Objektzentrums wurde mit einer 30 cm dicken Isolationsschicht verkleidet. Der begehbare Luftraum zwischen dieser Isolationsschicht und der Stahlfassade beträgt 1,30 Meter. Bei der Fassade der Gebäude 2 und 3 handelt es sich um eine Pfosten-Riegel-Konstruktion, bei der die vorhandenen Stahlträger der Tragstruktur als Unterkonstruktion genutzt werden konnten. Hier dient das Stahlblech lediglich als Brüstung.
Bewusst wurde auf die Verwendung von sogenannt «wetterfestem Stahl» verzichtet, jedoch eine entsprechende Schichtstärke für die zu erwartende Korrosionsabtragung berücksichtigt. Bei der konstruktiven Ausbildung der Stahlplattenhalterung wurde darauf geachtet, dass sich kein stehendes Wasser bilden kann. Die Stahlplatten weisen an der Rückseite vertikal ausgerichtete, rundum angeschweisste Einhängelaschen auf, welche bei der Montage in U-förmige Konsolen eingeführt werden, so dass dem abfliessenden Wasser kaum Widerstand geboten wird. Die horizontale Justierung erfolgte mittels Schiften der Konsolen. Der mögliche Ausfall einzelner Aufhängungen im Laufe der Lebensdauer wurde bei der Dimensionierung berücksichtigt. Eine Vielzahl von horizontalen Halterungen übernehmen die vertikalen Lasten.
Ökologische Verantwortung
Ein zentrales Anliegen der Bauherrschaft war die Nachhaltigkeit der Konstruktion und der Nutzung. Das Projekt belegt ausschliesslich bereits bebautes Land. Das Energiekonzept erfüllt den Minergie-P-Standard. Passive, krisenresistente Systeme und die nachhaltige Nutzung von Erdwärme durch Erdsonden sind nicht nur ökologisch vorbildlich, sondern erfüllen auch die hohen Anforderungen der Lagerung musealer Objekte. Der rostende Stahl führt zwar während seiner langen Lebensdauer zu einem gewissen Materialverlust, doch sind diese Korrosionsprodukte von Baustahl im Gegensatz zu denjenigen von höher legiertem wetterfesten Stahl für das Erdreich unbedenklich. Dem massiven Kostendruck wurde mit der Zentralisierung der Ressourcen und einem objektorientierten Entwurfsprozess begegnet, so dass das Projekt schliesslich unter dem Budget der Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde.
In diesem Projekt sind die Bedeutungen von Bewahren und Vergehen sinnbildlich umgesetzt. Der schützenden Hülle und der Einbindung des Objektes in seine Umgebung fallen besondere Bedeutung zu. Der Stahl als sinnliche und lebendige Haut, als Geschichtsträger und als «Werkzeug des Menschen» hat hier seine Bestimmung als Zeitzeuge gefunden.Steeldoc, Mo., 2008.09.01
01. September 2008 Evelyn C. Frisch, Elisabeth Schabus
verknüpfte Bauwerke
Sammlungszentrum Schweizerische Landesmuseen
Herr der Ringe
1517 Ringe aus Stahl formen die tragende Fassade der Hochzeitskapelle des Hyatt Regency Hotels in Osaka. Dem japanischen Architekten Jun Aoki ist es gelungen, der Tragstruktur jegliche Schwere zu nehmen und den zeremoniellen Raum in ein Spiel aus Licht und Schatten zu tauchen.
Viele Japaner lieben es, zusätzlich zu einer traditionellen japanischen Trauung im Kimono, auch noch nach westlicher Art in einer Kapelle ihre Hochzeit zu feiern – natürlich in weiss. Jedes grössere Hotel hält deshalb mindestens eine «weltliche» Kapelle für seine Gäste bereit. Das Hyatt Regency Hotel in Japans zweitgrösster Geschäftsmetropole, Osaka, hat gleich zwei davon – einen Gartenpavillon namens «Pristine Chapel» (die Unberührte) und die hier vorgestellte «White Chapel», die schlicht «Eternity» (Ewigkeit) genannt wird. Ein hoffentlich gutes Omen für die Verbindungen, die dort entstehen.
Wenn der japanische Architekt Jun Aoki seine ephemere, strahlend weisse Hochzeitskapelle beschreibt, wird es physikalisch: Damit Volumen entsteht, müsse es ein Gefäss geben, in dem sich das Volumen wie ein Gas ausbreiten könne. Die Konstruktion solle so luftig und rein sein, als verwende man nur flüchtiges Gas, um das Raumvolumen zu bilden. Schon mehrfach hat der Architekt das Thema untersucht und es offenbar hier erstmals umgesetzt: nämlich dem Stahl jegliche Schwere zu nehmen und die Tragstruktur zu immaterialisieren. Die Bildhauerin Noe Aoki hat diese ornamentale Struktur entworfen, und gemeinsam mit den Ingenieuren wurde daraus eine Tragstruktur entwickelt.
Tragende Leichtigkeit
Als luftig kann man diese Konstruktion allemal bezeichnen. Dass das Fassadenornament trägt, ist kaum vorstellbar. Eher wirkt der durchschimmernde Vorhang aus weissen Stahlringen wie ein von der Decke hängendes, dreidimensionales Mobile. Doch tragende Stützen sind nur in der offenen Vorhalle auf der Nordostseite zu sehen. Tatsächlich besteht die tragende Struktur dieser Fassade aus einem Geflecht aus aneinander geschweissten Stahlringen. Auf einem gemeinsamen Ring als Grundfläche sind jeweils gegen unten und oben drei Ringe pyramidal angeordnet. So entsteht ein sich wiederholendes Element aus sieben Ringen. Oben und unten sind diese sechs Meter hohen Elemente an kurze Stahlzylinder geschweisst, welche in der Decke bzw. im Bodenfundament eingespannt sind. In diesen Zylindern ist auch jeweils ein Halogen-Stahler als Beleuchtung integriert. Die Ringfassade wurde in insgesamt neun Teilstücken im Werk vorgefertigt und vor Ort mit der Stahlkonstruktion des Daches verknüpft.
Das Dach aus einem Stahlträgerrost ist zum Rand hin bis auf eine Linie verjüngt und liegt auf drei Tragelementen auf: einmal auf einem Massivkern, dann auf einer Stahlstützenreihe in der Vorhalle und der Nordseite sowie schliesslich auf dem Stahlringgeflecht in der Südfassade. Die vertikalen Lasten sowie der Winddruck und die Erdbebenkräfte werden komplett von diesem Tragwerk übernommen.
Spiel mit dem Licht
Die Klimahülle bilden fugenlose, transparente Glasscheiben – gegen Windkräfte durch Horizontalstäbe von der Ringstruktur abgefangen. Im Innenraum ist eine durchscheinende Haut aus feuerhemmendem Baumwollstoff gespannt, welche völlig entmaterialisiert wirkt. Auf diesen weissen Flächen zeichnet sich am Tage als schemenhaftes Schattenspiel die Ringkonstruktion ab. Nachts strahlt die Kapelle durch fluoreszierende Lichtbänder am unteren und oberen Ende der Fassade und durch die Beleuchtung der Ringstruktur stimmungsvoll von innen. Das Lichtspektakel wird durch die Spiegelung der beleuchteten Kapelle auf der Wasserfläche vor dem Hotel noch unterstrichen. Dieser sinnliche Umgang mit dem Licht und vielleicht auch die symbolhafte Anlehnung der Ringstruktur an Verlobungsringe dürfte für den überwältigenden Erfolg der Kapelle verantwortlich sein: Bereits im ersten Jahr wurden in der «White Chapel» mehr als 200 Trauungen vollzogen.Steeldoc, Mo., 2008.09.01
01. September 2008 Evelyn C. Frisch, Elisabeth Schabus
verknüpfte Bauwerke
Hochzeitskapelle White Chapel