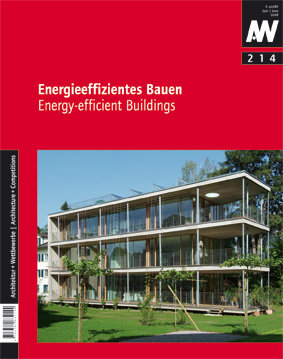Editorial
Der Konzernchef des Mineralölunternehmens total, Christophe de Margerie, konstatierte vor wenigen Tagen in einer französischen Wirtschaftszeitung, was unabhängige Experten schon seit längerem vorhergesagt hatten: Die weltweite Ölförderung werde schon bald ihr Maximum erreichen. Bisherige Schätzungen seien zu optimistisch, da die Unternehmen nicht genug neue Vorkommen fänden. Aufgrund dieser erstmals von einem Vorstand eines mächtigen Ölkonzerns geäußerten Warnung werden all jene, die bislang angenommen haben, Erdöl stehe noch für Jahrzehnte in ausreichender Menge zur Verfügung, nun spätestens umdenken und andere Verhaltensweisen entwickeln müssen. Leider muss man zu dieser Gruppe auch viele Architekten zählen, denn bei der überwiegenden Mehrzahl von Neubauten und Umnutzungen der letzten Jahre spielen Aspekte wie Energieeffizienz oder Ressourcenschonung – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle. Von einem Niedrigenergie- geschweige denn einem Passivhausstandard sind die meisten dieser Bauten noch weit entfernt; für viele Architekten ist der Energieverbrauch ihrer Gebäude eine unbekannte Größe. Durch die Einführung des Energieausweises in Deutschland, mit dem künftig schon bei Kauf, Bau oder Anmietung der Energiebedarf und die damit verbundenen Kosten einer Immobilie abgeschätzt werden können, wird sich das aber hierzulande sicherlich grundlegend ändern. In dieser Ausgabe der AW Architektur Wettbewerbe stellen wir eine Reihe von Bauten, Projekten und Wettbewerben vor, die von Architekten bereits energieeffizient entworfen wurden.
Inhalt
Zum Thema
Energieeffiziente Architektur | Martin Haas
Bauten
Schulgebäude in Brixlegg | Raimund Rainer
Firmenzentrale in Nazareth | Ysenbrandt & Partners
Bürogebäude in Givisiez | Conrad Lutz Architecte
Büro- und Wohnhaus in Darmstadt | opus Architekten
Wohnhaus und Bürohaus in Klagenfurt | Klaura Kaden Architekten
Wohnanlage in Salzburg | sps-architekten
Wohnanlage in Wien | Dietrich|Untertrifaller Architekten
Wohnhaus in Liebefeld | Halle 58 Architekten
Wohnhaus in Stuttgart | Simon Freie Architekten
Einfamilienhaus in Watford | Sheppard Robson
Einfamilienhaus in Neumarkt im Mühlkreis | Schneider & Lengauer Architekten
Einfamilienhaus in Ulm | Mühlich, Fink & Partner
Projekte
Wohnturm in Hamburg | Behnisch Architekten
Wohnhäuser in Stuttgart | Braun Associates Architekten
Wettbewerbe
CO2-neutrale Grundschule in Hamburg
Turnhallen-Baukasten für Frankfurter Schulen in Passivhausstandard
Agrarisches Schulzentrum Salzkammergut in Altmünster
Wohnsiedlung und Gewerbezentrum Sihlbogen in Zürich
Bürogebäude in Givisiez
Bei den »Green Offices« handelt es sich um ein Bürogebäude, das Raum für 35 Arbeitsplätze bietet. Es ist das erste Bürogebäude in der Schweiz, das nach dem Minergie-P Eco-Standard errichtet wurde, bei dem ein kleinstmöglicher Energieverbrauch mit dem Streben nach vollständiger Harmonie mit der Umwelt verbunden ist. Mindestens so interessant wie das architektonische Vorgehen sind also die soziokulturellen Herausforderungen. Die Grundidee war, Flächen an Unternehmen oder Personen zu vermieten, deren Aktivitäten direkt oder indirekt mit Ökologie zu tun haben. Die Herausforderung bestand darin, einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem Architekten, Landschaftsarchitekten, Bauingenieure, Grafiker et cetera sich versammeln und austauschen können, statt isoliert zu bleiben. Umgesetzt wurde dies mit drei völlig offen gehaltenen Geschossen, die im Gebäudekern über ein durchgehend offenes Atrium belichtet werden, in dem sich eine Treppe befindet. Außer der Eingangstür zum Gebäude gibt es keine Türen. Einzelne Bereiche können durch 1,60 Meter hohe Stellwände abgetrennt werden. Was die technischen Installationen anbelangt, ist jedes Quadrat des Gebäudes individuell an die kontrollierte Lüftung angeschlossen, wogegen an den Decken ein Kabelsystem angebracht ist, was eine flexible Nutzung der Arbeitsplätze ermöglicht. Um alles zu dynamisieren, was mit Bauen und nachhaltiger Entwicklung zusammenhängt, dient eine geräumige Cafeteria im Erdgeschoss auch als Konferenzraum. Außerdem verfügt jedes Stockwerk über einen fest abgetrennten Besprechungsraum.
Außer der Bodenplatte und den Mauern des Untergeschosses, die aus Beton sind, bestehen Stützen, Bedachung, Platten (einschließlich jener über der Tiefgarage), Türen und Fenster und sogar der Fahrstuhlschacht zu 100 Prozent aus Holz. Wie die Fassaden sind auch die Böden und das Dach 50 Zentimeter dick. Sie ruhen auf 24 Zentimeter breiten Stützen aus Brettschichtholz, die über das ganze Gebäude in einem Raster von sechs mal sechs Meter angeordnet sind. Das belüftete Flachdach, das mit einem Bitumenkarton überzogen ist, wurde nicht begrünt, damit später eine Fotovoltaikanlage (mit bis zu 300 Quadratmetern) darauf installiert werden kann. Ein Vorteil dieser Bauweise liegt in der Planung der Bauarbeiten: Nachdem die Fundamente zwischen Mitte November und Ende 2006 fertig gestellt worden waren, wurde das 5300 Kubikmeter umfassende Gebäude im Januar 2007 in fünf Werktagen aufgebaut. Die Fenster waren bereits in den vorgefertigten Wandelementen enthalten.
Die technischen Dienste – Eingang, Konferenzraum, WC, Sanitärräume, Küche, Fluchttreppe – befinden sich nördlich im rückwärtigen Teil des Gebäudes, wohingegen die Büroräumlichkeiten auf die anderen Seiten ausgerichtet sind. Im Untergeschoss wurden ein großes Archiv, technische Räume sowie die Verlängerung des 33 Stellplätze umfassenden Außenparkplatzes eingerichtet. Zur Optimierung des Klimas innerhalb des Gebäudes – insbesondere im Sommer – wurden schmale Fenster gewählt, die sich aber bis zum Boden erstrecken. Innen wurden entlang der Wände keine Möbel aufgestellt, was einen Durchgang ergibt, der den luftigen Stil der »Open Spaces« verstärkt und den Rhythmus der Öffnungen spürbar macht. Die Fassadenverkleidung besteht aus natürlich grau eingefärbtem Holz.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2008.06.30
30. Juni 2008
verknüpfte Bauwerke
Green-Offices
Wohnhaus in Stuttgart
Der Neubau wurde in bevorzugter Aussichtslage an einem Südhang realisiert. Das Baugrundstück befindet sich in einem Wohngebiet, dessen bauliche Struktur mit freistehenden Einfamilienhäusern aus den frühen 1960er-Jahren stammt. Der Bauherr hatte das 1250 Quadratmeter große Grundstück mit einem bestehenden kleinen Einfamilienhaus geerbt und beabsichtigte, es selbst zu bebauen und die entstehenden Flächen zu vermieten. Die privilegierte Lage, der hohe Wert und die durch den bestehenden Bebauungsplan schlechte Ausnutzungsmöglichkeit des Grundstücks schlossen eine dichte Bebauung mit verhältnismäßig kleinen Wohnungen aus. Um die Möglichkeiten und Chancen für die Planung auf dem Wohnungsmarkt im Vorfeld zu klären, wurde gemeinsam mit dem Bauherrn das Profil einer künftigen Nutzung erarbeitet, dem die Gebäudestruktur des Neubaus Rechnung tragen sollte. Als Zielgruppe wurden gestaltungs- und qualitätsbewusste, eher leistungs- als preisorientierte Mieter definiert. Um möglichst vielen familiären Strukturen und Wohnformen auch in 30 Jahren noch gerecht zu werden, sollten die Wohnungen auch zu einem späteren Zeitpunkt durch nicht tragende, demontierbare Trennwände veränderbar sein. Um die Flexibilität der Flächen nicht einzuschränken wurden die vertikalen Erschließungselemente hangseitig aus der rechteckigen Grundrissfläche ausgerückt. Im Untergeschoss befindet sich die Tiefgarage mit insgesamt 10 Stellplätzen, das Erdgeschoss beinhaltet die wohnungsnahen Keller-, Wasch-, und Technikräume. Abgetrennt durch einen Flur schließt sich nach Süden ein verglastes Band mit etwa 160 Quadratmeter Wohnfläche an. In den beiden Obergeschossen sind in jeder Ebene zwei Wohneinheiten mit je 140 Quadratmeter, alternativ jeweils eine Einheit über 280 Quadratmeter Wohnfläche möglich. Vom Lofttyp bis zur Wohnung mit fünf Räumen sind alle Grundrisstypen herstellbar. Innerhalb der offenen Grundrissfläche wurden im nördlichen Bereich zwei kubische »Servicezellen« angeordnet, die alle notwendigen Installationen beinhalten. Das Untergeschoss und der erdüberdeckte Teil des Erdgeschosses wurden in Beton-Massivbauweise errichtet. Die Obergeschosse wurden als Mischkonstruktion teilweise mit tragenden, horizontal aussteifenden Außenwänden und -wandscheiben, teilweise als Skelettkonstruktion erstellt.
Die Südfassade ist vollständig verglast und besteht in den Obergeschossen aus raumhohen Hebe-Schiebeelementen im Wechsel mit Festverglasungen. Die Schiebeflügel wurden außen vor den Festverglasungen verlaufend montiert, so dass die Möglichkeit besteht, im Abstand von jeweils 1,97 Metern Trennwände an die Fassade anschließen zu können. Die 1,50 Meter auskragende Balkonzone sorgt für eine ausreichende Verschattung, so dass auf einen außenliegenden Sonnenschutz verzichtet werden konnte. Für die gesamten Verglasungen auf der Südseite wurden wärmedämmende Dreifach-Verglasungen mit einem Ug-Wert von 0,7 W/m2K verwendet. Durch die Wahl der Verglasungsart können durch diese Flächen vor allem im Winter und in den Übergangszeiten solare Wärmegewinne erzielt werden. Die Ost-, West- und Nordfassaden wurden bis auf wenige Fensteröffnungen geschlossen ausgebildet. Sämtliche Außenwände wurden mit 24 Zentimeter starkem Wärmedämmverbundsystem gedämmt. Die Dachfläche erhielt eine Gefälledämmung mit einer im Mittel 30 Zentimeter dicken Foamglasdämmung. Das Gebäude wird durch eine Gas-Brennwerttherme beheizt und mit warmem Brauchwasser versorgt. Über die Servicezellen wurden Luftleitungen über das Dach geführt, die der kontrollierten Be- und Entlüftung dienen. Zur Wärmerückgewinnung entziehen Wärmetauscher der Abluft die thermische Energie, die dann der Frischluft wieder zugeführt wird.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2008.06.30
30. Juni 2008
verknüpfte Bauwerke
Lofthaus
Einfamilienhaus in Watford
Das so genannte »Lighthouse« (Leuchturm) ist das erste »Nullemissionshaus« Großbritanniens, das gleichzeitig der höchsten Energieeffizienzklasse des neuen »Codes for Sustainable Homes« entspricht, nach der ab 2016 alle britischen Neubauten errichtet werden müssen. Der Entwurf und die Bauweise des freistehenden Wohnhauses zeigen, dass ein emissionsfreies Gebäude möglich ist, doch dass dies nicht nur über eine moderne Haustechnik sondern auch ein verantwortliches Verhalten der Nutzer erreicht werden kann. Im Mittelpunkt des Entwurfskonzepts für den zweieinhalbgeschossigen Prototypen, der eine Nutzfläche von rund 90 Quadratmeter aufweist und über zwei Schlafräume verfügt, stand das Ziel, ein Haus zu entwickeln, bei dem die Technik und die Konstruktionsweise die Wohnqualität der Nutzer nicht einschränken sondern sogar vergrößern.
Das »Lighthouse« hat eine einfache, stark an eine Scheune erinnernde Form mit einem um 40 Grad geneigten Pultdach. Das nach Süden orientierte Dach geht nahtlos in die Fassade über und kann Solarkollektoren und Fotovoltaikelemente aufnehmen. Direkt unter dem geschwungenen Dach befindet sich der zentrale Wohnraum des Hauses – ein großzügiger, durchgehender, von oben belichteter, zweigeschossiger Raum – während die Schlafräume und das Bad im Erdgeschoss untergebracht wurden. Die vorgefertigte Holzrahmenbauweise ermöglicht eine offene Grundrissgestaltung.
Ein zentral über dem Luftraum des Treppenraumes platzierter »Windfang« auf dem Dach garantiert einen regelmäßigen Luftaustausch innerhalb des Gebäudes. Seine Konstruktion aus Stahl und Glas hebt sich signifikant von der homogenen unprätentiösen Holzlamellenfassade aus Kastanienholz ab. Aus Gründen des Wärmeschutzes entschieden sich die Architekten dafür, vergleichsweise kleine Fensterflächen vorzusehen. Ihr Anteil wurde auf 18 Prozent begrenzt (im Vergleich dazu liegt der Anteil bei einem Standardhaus bei 25 bis 30 Prozent), was jedoch keine gravierenden Auswirkungen auf den Tageslichteinfall des Gebäudes hat.
Das Innenraumklima ist jederzeit moderat und behaglich. Mit so genannten »phase change materials« (pcm) befüllte, passive Bauteile tragen dazu bei, den Wärmehaushalt des Gebäudes zu regulieren. Die Material besteht aus mikroskopisch kleinen Kapseln, die bei Erwärmung flüssig werden und dadurch tagsüber Wärme absorbieren können. Sobald es nachts kühler wird, kristallisieren die Kapseln und geben die dadurch entstehende Energie in Form von Wärme wieder an die Umgebung ab.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2008.06.30
30. Juni 2008
verknüpfte Bauwerke
Einfamilienhaus in Watford