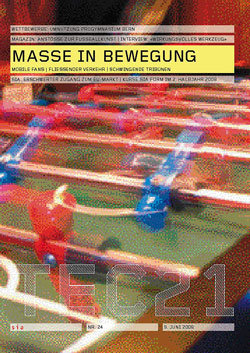Editorial
«Gesichter, die vor Zorn, Verzweiflung oder Frustration verzerrt waren. Sich zu amüsieren, indem man leidet, war für mich ein vollkommen neuer Gedanke», schreibt der elfjährige Nick über die Fans nach seinem ersten Besuch im Heimstadion von Arsenal London. In «Fever Pitch» von Nick Hornby geht es um den Fussballkonsum, Wechsel von Niederlage und Sieg, Trauer und Triumph, Freude und Frust. Das Motto der Euro 08 nimmt diesen Zwiespalt auf: «Expect Emotions».
Die erwartete Menschenmasse in den Stadien, rhythmisches Klatschen und Hüpfen beschwört auch ungute Gefühle herauf. Im Herbst 2007 berichteten die Zeitungen über den Einsturz einer Tribüne in Salvador (Brasilien): Die Fans feierten den Aufstieg ihres Vereins, als die Tribünenkonstruktion unter der Last der hüpfenden Menschen nachgab. Droht den Schweizer Stadien eine ähnliche Gefahr? Wir haben die verantwortlichen Ingenieure nach der Sicherheit der Tribünen gefragt. Die Schwingungen infolge Personenanregung sind für sie kein Grund zur Besorgnis. Warum nicht, beantworten sie im Beitrag «Schwingende Tribünen».
Doch die Masse bewegt sich auch ausserhalb der Stadien. Während einer spannenden Entscheidung ist es in den Innenstädten zwar ruhig. Nach Spielende gibt es dafür kein Durchkommen mehr. «Zeit, dass sich was dreht ...» sang Herbert Grönemeyer zur WM 2006. Der Refrain des Titels gilt Fussballfans und Nichtfussballbegeisterten gleichermassen. Denn Experten gehen davon aus, dass sich Staus während der Euro 08 nicht ausschliessen lassen. Treffen bei einer Grossveranstaltung Millionen Menschen zusammen, stellt sich die Frage, was mit den eingespielten Verkehrssystemen passiert. Die Autorin von «Fliessender Verkehr» nahm diese Frage zum Anlass, das Management des Verkehrs auf der Strasse vorzustellen. Wenn alle Gäste mit dem Auto kämen, gäbe es Probleme, warnen Experten. Doch wie viele sind «alle»? Die Autoren des Artikels «Mobile Fans» initiierten und leiteten mehrere Lehr- und Forschungsprojekte zur Untersuchung verkehrsspezifischer Fragen bei internationalen Sportevents. Während der Fussball-WM 2006 in Deutschland analysierten sie das Verhalten europäischer Fangruppen. Die Ergebnisse dienten unter anderem als Grundlage für die Schätzungen der Besucherströme in der Schweiz.
Seien wir gespannt auf die Emotionen, die – je nach Temperament der siegreichen Nationen und der Masse der Anhänger – die Städte lahmlegen werden.
Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Umnutzung Progymnasium Bern
08 MAGAZIN
Anstösse zur Fussballkunst | Interview: «Wirkungsvolles Werkzeug» | Jean Nouvel, Pritzkerpreisträger 2008 | Die schönsten Bücher | Das reiche Erbe von Amadeo Cassina | Risiken und Chancen wahrnehmen – Jahresbericht 2007 der Verlags-AG | Euro 08 steht auf Holz | Liste der historischen Gärten Bern | Visionen für Europas Stromzukunft
22 MOOBILE FANS
Christian Canis, Markus Engemann
Verkehr: Erkenntnisse zum Mobilitätsverhalten europäischer Fangruppen bei der Fussballweltmeisterschaft 2006 werden vorgestellt.
26 FLIESSENDER VERKEHR
Alexandra Diewald
Verkehr: Eine intelligente Nutzung des Strassennetzes im Allgemeinen und im Speziellen bei der Euro 08 ist nötig, um ein Verkehrschaos zu verhindern.
31 SCHWINGENDE TRIBÜNEN
Daniela Dietsche, Clementine van Rooden
Ingenieurbau: Laut den Ingenieuren ist eine hüpfende Menschenmenge als dynamische Anregung von Tribünenelementen bei den vier EM-Stadien eine «normale» Lasteinwirkung.
39 SIA
Erschwerter Zugang zum EU-Markt | Kurse SIA Form im 2. Halbjahr 2008
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Mobile Fans
Die Fans der 16 europäischen Teilnehmerländer werden ihre Mannschaften zur Fussball-Europameisterschaft in die Schweiz und nach Österreich begleiten. Die erwartete Menschenmasse wird die Verkehrssysteme stark belasten. Bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Deutschland untersuchten die Autoren dieses Artikels das Mobilitätsverhalten der europäischen Fans. Die hier präsentierten Erkenntnisse wurden bei der Planung der Verkehrsabwicklung während der Euro 08 in der Schweiz und in Österreich berücksichtigt.
«Die Welt zu Gast bei Freunden» hiess das Motto der Fussballweltmeisterschaft 2006. Aber wie bewegt man die Welt ausserhalb der Stadien – werden die Zuschauer aus aller Welt die verschiedenen Verkehrsangebote nutzen? Kann man Fussballfans so lenken, dass Verkehrssysteme effizient genutzt werden? Kommen die vielfältigen Informationen bei ihnen an? Diese und viele andere Fragen stellte man sich im Vorfeld der WM 2006 in Deutschland. Aufbauend auf den Befragungen zum Fifa-Confederations-Cup 2005 konnte im Rahmen des Projektes «Verkehrs- und Eventmanagementmassnahmen zur Fifa-WM 2006» die Mobilitätsforschung fortgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden europäische WM-Zuschauer befragt. Ziel des Projekts war es, die Wirkungsweise und die Akzeptanz der umfangreichen verkehrlichen Massnahmen zur WM 2006 zu untersuchen. Das Projekt wurde vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert. Kooperationspartner waren die Technischen Universitäten aus Berlin und Kaiserslautern.
Die WM-Besucher
Rund 40 % der Karten der «public sales» wurden ins Ausland verkauft, die meisten davon in die Teilnehmerländer. Besucher aus Grossbritannien, den Niederlanden oder aus Schweden verwandelten die zwölf Spielorte in bunte Fahnenmeere. Die vielen mexikanischen Fans in den Zügen oder die feiernden Südkoreaner auf Leipzigs Strassen zeigten, dass die Fuss - ballanhänger nicht nur aus dem europäischen Ausland nach Deutschland reisten. Nach der Auswertung der 6300 Interviews stand fest: Der durchschnittliche ausländische WMZuschauer war männlich, zwischen 25 und 35 Jahre jung und hatte meist einen höheren Bildungsabschluss. Dies vermutlich, da die Kosten für Anreise, Übernachtung und Ticket nicht gerade günstig waren. Die Besucher der Fussballweltmeisterschaft waren nicht mit den Zuschauern vergleichbar, die regelmässig Bundesligaspiele besuchen. An den Fanfesten traf man zudem viele ausländische Fans, die keine Eintrittskarte besassen, aber trotzdem das WM-Gefühl geniessen wollten.
Zum Spielort reisen
Wie sah das Mobilitätsverhalten der Zuschauer aus? Bei der Wahl des Verkehrsmittels für den Weg zum Spielort unterschieden sich die einzelnen Nationalitäten: Franzosen fuhren am liebsten mit dem Auto. Schweden und Schweizer nutzten die Bahn häufiger als andere Nationen, das Auto war jedoch auch bei diesen Nationen das meistbenutzte Verkehrsmittel. Die Niederländer stellten die meisten Reisebusnutzer. Zwei Drittel der Portugiesen und Spanier flogen zum Spielort. Bei den europäischen Gästen aus den Nachbarländern Deutschlands dominierte der motorisierte Individualverkehr, Zweidrittel fuhren mit dem Auto zum Spielort. Die Eisenbahn wurde von etwa einem Fünftel der Reisenden genutzt, was über den im Freizeitverkehr bekannten Werten liegt. Zuschauer, die aus anderen europäischen Ländern zur Weltmeisterschaft anreisten, taten dies in erster Linie mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Etwas verfälscht wurde das Bild durch die dauerhaft in Deutschland lebenden ausländischen Fans und durch Besucher, die nicht am jeweiligen Spielort übernachteten, sondern aus anderen Städten anreisten.
Der Weg zum Stadion
Auf dem Weg innerhalb des Spielortes zum Stadion wurde der Erfolg der verschiedenen lokalen Nahverkehrskonzepte deutlich. Ziel der Verkehrskonzeptionen in den zwölf Spielorten und dem gemeinsamen Vier-Farben-Wegeleitsystem war, dass entsprechend den Vorgaben aus dem Umweltkonzept mehr als die Hälfte aller Zuschauer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion fahren. Die vorhandenen Infrastrukturen der öffentlichen Verkehrssysteme sollten gleichmässig und effizient ausgelastet werden, da durch die vielfältigen räumlichen Anforderungen der Fifa nicht immer die im Bundesligabetrieb üblichen Parkplätze nutzbar waren. Zudem wurde die räumliche Trennung von Fangruppen bei High-Risk-Matches mit Hilfe der unterschiedlichen Wegeführung zum Stadion vorbereitet. Auf dem Ticket wurde der jeweilige Sitzplatz einer Farbe zugeordnet, die ausserhalb des Stadions dem Zuschauer den entsprechenden Weg zuwies.
Teure Infrastrukturerweiterungen, die nur für den Zeitraum der Weltmeisterschaft genutzt worden wären, sollten vermieden werden. Deshalb wurde mit Hilfe von gezielten Verkehrsmanagementmassnahmen die vorhandene Kapazität der einzelnen Verkehrssysteme intelligent genutzt (vgl. Artikel «Fliessender Verkehr»).Vergleicht man die Anteile des motorisierten Individualverkehrs bei der Stadion- und bei der Spielortanreise, fällt auf, dass der Anteil bei der Stadionanreise deutlich niedriger ist. Vor allem die Übernachtungsgäste liessen ihr Auto stehen und fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion. Wegen der unterschiedlichen Verkehrskonzepte in den einzelnen Spielorten variierte der Modal Split auf dem Weg zum Stadion. (Mit Modal Split ist die prozentuale Aufteilung der Benutzer auf die verschiedenen Verkehrsmittel gemeint.) Das Olympiastadion in Berlin ist zum Beispiel sehr gut mit U- und S-Bahn erreichbar. Parkplätze waren am Stadion nicht vorhanden, sondern erst am weiter entfernten Messegelände. Der PW-Anteil war dementsprechend mit 7 % der ausländischen Zuschauer sehr gering. Frankfurt verfügt neben der guten Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn und Tram) über viele Parkplätze im Umfeld des Stadions. 33 % der ausländischen Gäste reisten mit dem Auto an.
Insgesamt fiel bei den ausländischen Gästen auf, dass sie auch längere Wege zu Fuss zurücklegten, beispielsweise aus der Leipziger Innenstadt oder vom Hauptbahnhof zum Zentralstadion (ungefähr 20 min Fussweg). Im Vergleich zu den deutschen Zuschauern nutzten die ausländischen Gäste wesentlich häufiger das Taxi. Im Umfeld der Stadien führte dies zu Problemen, da Taxistandplätze fehlten.
Die sehr frühe Anreise der Fans zu den Stadien überraschte die Planungsakteure. Deutlich früher als «normale» Bundesligabesucher erreichten die ausländischen Zuschauer die Arenen. Demzufolge mussten die Zusatzangebote im Nahverkehr früher als geplant anrollen. Je später das Spiel angepfiffen wurde, desto mehr Zuschauer kamen früher zum Stadion. Rund 20 % der Befragten waren schon fünf Stunden vor dem Anpfiff um 21 Uhr am Stadion. Der gleiche Effekt war während der Gruppen- und Finalphase erkennbar – je wichtiger die Spiele wurden, umso früher kamen die Fans.
Informationsquellen
Bei internationalen Sportgrossveranstaltungen ist es wichtig, die Zuschauer vor und während des Aufenthalts mit den notwendigen Informationen zum ÖV-Angebot zu versorgen. Nur durch die offensive Information über die Angebote lässt sich das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel fördern. Im Vorfeld informierten sich die ausländischen Gäste hauptsächlich über das Internet. Die Anreiseinformationen, die jeder Zuschauer mit seinem Ticket erhielt, waren ebenfalls hilfreich.
Mehr ausländische als deutsche Fans haben sich während der Reise informiert. Dabei nutzten sie vorrangig Stadtpläne und Hinweisschilder zu den Stadien. Moderne Hilfsmittel wie Navigationsgeräte unterstützten die Fans, aber auch Passanten und freiwillige Helfer wurden häufig angesprochen. Gerade die Fangruppen, die orts- und sprachunkundig sind, müssen mit Hilfe von verschiedenen Informationskanälen geleitet werden. Damit ist ein Lenken von Verkehrsströmen mit dem Ziel der effizienten staufreien Nutzung von Verkehrssystemen möglich.
Neben dem sportlichen Erfolg, den friedlichen Fans und dem guten Wetter konnte der Verkehr seinen wichtigen Beitrag zum guten Gelingen der Fussball-WM in Deutschland beitragen. Diesen Erfolg wünschen wir der Euro 08 auch.
[Christian Canis, TU Berlin, FG Schienenfahrwege und Bahnbetrieb, ccanis@railways.tu-berlin.de
Markus Engemann, Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, markus.engemann@dvwg.de]TEC21, Mo., 2008.06.09
09. Juni 2008 Christian Canis, Markus Engemann
Fliessender Verkehr
Der Verkehr einer Grossveranstaltung belastet die ohnehin häufig überfüllten Strassen zusätzlich. Um trotzdem für einen weitestgehend reibungslosen Verkehrsablauf während der Euro 08 zu sorgen, werden das Verkehrsmanagement auf der Strasse angepasst sowie spezielle Massnahmen geplant und umgesetzt.
Das erwartete Verkehrsaufkommen der Euro 08 ist mit dem täglichen Pendler- und dem jährlichen Ferienverkehr nicht vergleichbar. Um zielgerecht Massnahmen treffen zu können, wurden die zu erwartenden Besuchermengen für die Schweiz geschätzt. Infras[1] legte Erfahrungswerte der Fussballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, der Europameisterschaften 2004 in Portugal sowie 2000 in Belgien und den Niederlanden zugrunde. Ferner wurden Informationen der Uefa zum Ticketverkauf mit der regionalen Verteilung der Ticketbesteller herangezogen. Durch Auskünfte der SBB bezüglich Besuchermengen und Modal Split, durch Kontakte zu wissenschaftlichen Partnern und aus eigenen Erfahrungswerten wurden weitere Daten evaluiert. Schliesslich spielte auch die Grösse der ethnischen Gruppen in der Schweiz eine Rolle, um das teilweise vom «Durchschnittsschweizer» abweichende Verhalten abzubilden. Um ein Gesamtbild zu erhalten, wurden die Stadionund die Public-Viewing-Besucher berücksichtigt.
Der Faktor Public-Viewing-Besucher wurde auf 1 bis 3 pro Einwohner der Host City wie bei der WM 2006 in Deutschland festgelegt. Diese Zahl wirkt auf den ersten Blick recht vage, doch sie ist von Faktoren abhängig, die nicht vorausgesagt werden können, wie dem Wetter oder dem Weiterkommen der Nationalmannschaften. In den Stadien hingegen richtet sich der Faktor zur Berechnung der Besucherzahl nach den verkauften Tickets. Insgesamt werden voraussichtlich 61 % der Besucher und Besucherinnen an den Spieltagen mit Bahn und ÖV, 21 % mit dem PW, 7 % mit dem Flugzeug, 9 % mit dem Bus und 2 % zu Fuss oder mit dem Fahrrad zum Stadion reisen. Im Verkehrskonzept der Schweiz wird an Spieltagen ein Anteil Öffentlicher Verkehr/Langsamverkehr (LV) von 60 % angestrebt, das Modal-Split- Ziel des Stadionnahverkehrs liegt bei 80 % ÖV mit LV. Die Untersuchungen von Infras1 lassen vermuten, dass dieses Ziel erreicht wird. Für das Management des ruhenden Verkehrs und das Verkehrsmanagement auf der Strasse sind die Bus- und PW-Mengen relevant.
Verkehrsmanagement: Ein Überblick
Das Verkehrsmanagement auf der Strasse hat das Ziel, nach Mitteln und Wegen zu suchen, das vorhandene Netz noch intelligenter zu nutzen. In seinem jüngsten Bericht zur Verkehrsentwicklung und der Verfügbarkeit der Nationalstrassen2 stellt das Bundesamt für Strassen (Astra) fest, dass der Verkehr 2006 auf den Nationalstrassen gegenüber dem Vorjahr weniger stark zunahm. Trotzdem wurden 4.7 % mehr Staustunden verzeichnet. Die Staustunden infolge Verkehrsüberlastung stiegen sogar um 17 %. An Netzerweiterungen und Neubauten ist aus ökologischen und finanziellen Gründen häufig nicht zu denken. Tatsächlich bietet das vorhandene Netz vielerorts und zu bestimmten Zeiten Kapazitätsreserven.
Durch Verkehrsmanagementmassnahmen sollen Staus und deren negative Auswirkungen wie volkswirtschaftliche Kosten und Umweltbelastung reduziert werden. Als Teil des allgemeinen Verkehrsmanagements werden unter dem Begriff «Verkehrsmanagement auf der Strasse» alle Massnahmen zusammengefasst, die darauf abzielen, den Verkehrsablauf gross- und kleinräumig optimal zu gestalten. Die Zielsetzungen und Definitionen werden im Glossar Verkehrsmanagement Schweiz3 und in der Schweizer Norm SN 6407814 präzisiert.
Verkehr steuern
Die netzweite Signalsteuerung gehört heute zum Standard in jeder grösseren Stadt. Während die Steuerungstechnik weit fortgeschritten ist und jede ausgeklügelte Steuerungslogik einprogrammiert werden kann, herrscht oft eine grosse Unsicherheit über die Steuerungsphilosophie. Welche Verkehrsarten sollen priorisiert werden? Nach welcher Gesamtzielfunktion sollen die Verkehrsingenieure die Steuerung optimieren? Hier zeigt sich die Grenze der Anwendung von Verkehrsmanagementmassnahmen: Ohne einen Konsens bezüglich Zielsetzungen und Prioritäten sind intelligente Systeme wertlos.
Eine der neueren Massnahmen der Verkehrssteuerung in der Schweiz ist die Rampenbewirtschaftung zur Autobahn. Der Zufluss wird so dosiert, dass sich einfahrende Automobilisten mit dem Verkehr auf den Durchfahrtsspuren flüssig vereinigen. Bei vielen Verkehrsteilnehmern ist die Akzeptanz für diese Massnahme (noch) nicht vorhanden. Sie fragen sich – auf der Auffahrtsrampe auf Grün wartend –, weshalb der Transit- gegenüber dem Lokalverkehr bevorzugt wird. Beispiele wie die Einfahrt Baden West vor dem Bareggtunnel oder die Einfahrt Weiningen auf der Nordumfahrung Zürich haben sich bewährt: Staudauer und Rückstaulängen haben abgenommen. Welche Auswirkung eine Rampenbewirtschaftung auf das Netz der Hauptverkehrsstrassen hat und wie man unerwünschten Begleiterscheinungen entgegenwirkt, untersucht der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS). Die Ergebnisse werden Ende 2008 publiziert.
Verkehr leiten und lenken
Um die Kapazität einer Strecke zu erhöhen, wird auch darüber diskutiert, den Standstreifen umzunutzen. Diesen als zusätzlichen Fahrstreifen zu verwenden, lässt sich verantworten, wenn gleichzeitig die Geschwindigkeit herabgesetzt und der Verkehr lückenlos überwacht wird. In Deutschland hat man mit der dynamischen Umwidmung von Standstreifen vor allem im Grossraum München gute Erfahrungen gemacht. Bis Ende 2008 wird der VSS erarbeiten, wie die technische Ausrüstung der Strasse bei dieser Massnahme aussehen soll. Derzeit wird der maximale Durchfluss vor allem durch Verkehrsleitsysteme erreicht. Sie detektieren Verkehrsdichte, Geschwindigkeiten sowie Störungen und passen die Signalisation automatisch den Gegebenheiten an. Dynamische Gefahren- und Geschwindigkeits signalisationen (allenfalls Fahrstreifensignalisationen) werden eingesetzt, um einem Verkehrszusammenbruch auf einem Abschnitt entgegenzuwirken. Weiteres Ziel des Verkehrsleitsystems ist die Erhöhung der Sicherheit, insbesondere sollen Auffahrunfälle bei Nebel und Stau verhindert werden. Blockiert ein Ereignis den Verkehr oder sind Teile einer Route stark belastet, kann der Verkehr durch Wechselwegweisung an neuralgischen Punkten im Netz gelenkt werden; ein Beispiel ist die Umleitung über die San-Bernardino-Route bei Hindernissen am Gotthard. Wechseltextanzeigen werden unterstützend zur Verkehrslenkung und zur Information der Verkehrsteilnehmer eingesetzt.
Über den Verkehrszustand informieren
Um effizient von A nach B zu kommen und gar nicht erst in einen Stau zu geraten, helfen Verkehrsinformationen im Radio oder im Internet. Heute gehören zudem Navigationsgeräte zum Standard von höherklassigen Autos. Durch das GPS (Globales Positionsbestimmungssystem) und die gespeicherte digitale Strassenkarte kennt das Auto seinen Standort und den Weg zum Fahrziel. Die Empfehlungen der Navigationsgeräte können allerdings von den Routenempfehlungen der Verkehrsmanagementzentrale abweichen, da sie nicht auf den Verkehrsmanagementplänen (siehe Kasten), sondern auf Streckenattributen basieren. Der VSS untersucht die Möglichkeit, diesbezügliche Konflikte zu vermeiden und die Informationen und Massnahmen besser abzustimmen. Die aktuelle Diskussion zeigt, dass im Verkehrsmanagement intensiv nach Lösungen gesucht wird, um das vorhandene Netz langfristig optimal zu nutzen. Kurzfristig liegt der Fokus auf der Europameisterschaft.
Normalverkehr und Euro 08
Überlagern sich die Spitzenzeiten des täglichen Verkehrs mit dem Verkehr einer Grossveranstaltung, spitzt sich die Situation auf der Strasse zu. Dazu kommen erhöhte Sicherheitsanforderungen: Die Interventionsdienste müssen jederzeit schnell den Ereignisort erreichen können. Durch die Fanmeilen wird das Verkehrsregime der Innenstädte der Host Citys vollständig umgekrempelt. Sondermassnahmen für den privilegierten Verkehr und für Reisebusse müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
Bauliche Massnahmen ohne langfristigen Nutzen in der Zeit nach der Euro 08 wurden aus Nachhaltigkeitsgründen nicht verfolgt. Allerdings sind kurzfristige ökologische Belastungen vertretbar, zum Beispiel werden verlängerte Abflugzeiten für die Flughäfen und Parkieren in Grundwasserschutzzonen während der Euro 08 genehmigt. Betriebliche Massnahmen werden speziell für Grossanlässe in Betracht gezogen: So wurde während der Expo in Hannover auf der ganzen Strecke von Kassel nach Hannover der Standstreifen als dritter Fahrstreifen genutzt. Die dafür notwendigen Massnahmen wie Ummarkierung und Geschwindigkeitsreduktion wurden vor und nach der Expo in Kauf genommen. Die Schweiz verzichtet für die Euro 08 auf solche Massnahmen.
Um die An- und die Abreise für die Besucherinnen und Besucher während der Euro 08 so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten, wird das Verkehrsmanagement in der Schweiz und in Österreich angepasst. Selbstverständlich werden auch Autofahrer und -fahrerinnen, die nicht auf dem Weg zu einer Fussballveranstaltung sind, berücksichtigt. Die Verantwortlichen in der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz und die zuständigen Kantonspolizeistützpunkte legten im Vorfeld Lenkungs-, Leitungs-, Steuerungs- und Informationsmassnahmen fest, die situationsabhängig aktiviert werden. Wichtiger Bestandteil dieses Massnahmenpakets bilden eigens entworfene und mit den Verantwortlichen aus Österreich abgestimmte Signalisationsmittel sowie eine einheitliche Verkehrsinformation. Bei der Signalisation werden Massnahmen eingesetzt, die sich ausschliesslich an den «Euro 08- Verkehr» richten und auf den ersten Blick erkennbar sind, damit der Besucher sein Ziel direkt erreicht. Für die übrigen Verkehrsteilnehmenden gibt es Signalisations- und Informationsmassnahmen, die auf die spezifische Situation hinweisen und Umfahrungen signalisieren. Die Verkehrssituation wird während der Euro 08 beobachtet, laufend analysiert und daraufhin verbessert. Ob die Verkehrsströme wie angenommen verlaufen und die Massnahmen greifen, wird erst im Nachhinein beurteilt werden können.
[Alexandra Diewald, RappTrans AG, Basel, alexandra.diewald@rapp.ch]TEC21, Mo., 2008.06.09
Anmerkungen / Literatur
[1] Daniel Sutter, Infras AG, Zürich, Präsentation Europaforum in Salzburg, 20./21.02.08
– Bericht Verkehrsentwicklung und Verfügbarkeit der Nationalstrassen. Jahresbericht 2006. Bundesamt für Strassen (Astra)
– Glossar Verkehrsmanagement Schweiz, Ausgabe 2007 V4.21. Bundesamt für Strassen (Astra)
– Schweizer Norm SN 640781, Verkehrsmanagement, gültig ab 1. Februar 2006
09. Juni 2008 Alexandra Diewald