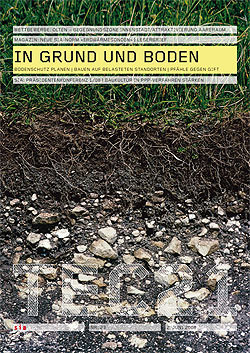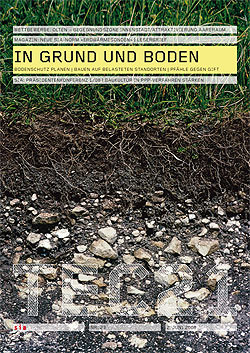Editorial
Böden haben einen schweren Stand. Den meisten Menschen ist klar, dass die Reinhaltung von Luft und Wasser für uns unmittelbar lebenswichtig ist. Dass der Boden ebenfalls eine der Grundlagen unseres Lebens ist, wird kaum (mehr) wahrgenommen. Ein Grund dafür ist sicher, dass die wenigsten von uns die Bedeutung von intakten, fruchtbaren Böden noch unmittelbar erleben. Nur ein Bruchteil der Bevölkerung in den Industrienationen ist noch in der Landwirtschaft tätig, ein etwas grösserer Teil vielleicht noch als Hobbygärtner. Ausserdem ist die Verfügbarkeit von ausreichend Nahrungsmitteln selbstverständlich. Der Wert von Böden besteht für die meisten heute primär in seinem Geldwert als Baugrund.
Zudem macht es einem der Boden schwer, eine emotionale Beziehung zu ihm aufzubauen. Er ist in der Regel nur zweidimensional erlebbar. Für die meisten ist es schlicht Dreck. Nur Fachleute wissen, wie ästhetisch Farben und Strukturen von Böden in ihren verschiedenen Ausprägungen sein können und welch vielfältige Funktionen in Stoff- und Wasserkreislauf dieses komplexe Gebilde aus Festsubstanz, Poren und Bodenlebewesen erfüllt. Dazu kommt, dass sich die Schädigung von Böden in der Regel nicht sofort, sondern zeitverzögert und schleichend bemerkbar macht. Die Wiederherstellung seiner Funktionsfähigkeit ist - wenn überhaupt - nur mit grossem Arbeits- und Zeitaufwand möglich.
Umso mehr Bedeutung kommt dem vorsorglichen Schutz der Böden zu. Der Artikel «Bodenschutz planen» legt den Fokus auf den Schutz vor physikalisch-mechanischen Belastungen des Bodens auf Baustellen. Vielen Planern ist noch zu wenig bewusst, dass die Weichen für bodenschonendes Bauen bereits in der Planung gestellt werden, z.B. durch entsprechende Auflagen bei Submissionen und die Einplanung von Zeitreserven.
Ist der Boden einmal geschädigt, stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist. Der Artikel ab Seite 24 empfiehlt, die Schadstoffbelastung von Baugrundstücken rechtzeitig abzuklären, um die mit der Entsorgung von Aushub oder einer Sanierung verbundenen Kosten einkalkulieren zu können.
Die Methoden zur Sanierung von Altlasten sind vielfach schon Standard, aber es gibt immer wieder Fälle, wo konventionelle Methoden ungeeignet oder zu teuer sind. So zum Beispiel bei einem Schadensfall auf dem Gelände eines Holzimprägnierwerkes, bei dem giftiges Chromat aus dem Boden das Grundwasser belastete.
Ab Seite 28 berichten wir über die Entwicklung einer neuen Sanierungsmethode von den ersten Laborversuchen über den Einbau vor Ort bis hin zur Überprüfung des Sanierungserfolges.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Olten: Begegnungszone Innenstadt und Attraktivierung Aareraum
12 MAGAZIN
Neue SIA-Norm «Erdwärmesonden» | Leserbrief
18 BODENSCHUTZ PLANEN
Judith Burri, Gaby von Rohr
Umwelt: Wird der Boden beim Bauen geschädigt, zieht das oft aufwendige Garantieleistungen nach sich. Die Weichen für den physikalischen Bodenschutz müssen bereits in der Planung gestellt werden.
24 BELASTETE STANDORTE: KOSTENFALLE VERMEIDEN
Rita Hermanns Stengele, Daniel Bürgi
Umwelt: Entpuppt sich der Standort für ein Bauvorhaben als schadstoffbelastet, kann dies teuer werden. Frühzeitige Abklärungen sind daher empfehlenswert.
28 PFÄHLE GEGEN GIFT IM GRUNDWASSER
Claudia Carle
Umwelt: Auf dem Gelände eines Holzimprägnierwerkes sickerten jahrelang Holzschutzmittel mit giftigem Chromat in den Untergrund. Für die Sanierung wurde eine neue und kostengünstige Methode entwickelt.
34 SIA
Präsidentenkonferenz 1/08 | Diskussion über die Lex Koller | Register Dichtungsbahnen | Baukultur in PPP-Verfahren stärken | Reise ins Südtirol mit A&K
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Bodenschutz planen
Beim Thema physikalischer Bodenschutz auf der Baustelle denkt man zunächst an die Verantwortung der ausführenden Baufirmen. Viele Weichen dafür, dass es später nicht zu teuren Garantieforderungen kommt, werden aber bereits in der Planung gestellt – durch entsprechende Auflagen bei der Submission und die Einplanung von Zeitreserven. Da das vielen Planern noch zu wenig bewusst ist, haben die Bodenschutzfachstellen der Kantone und des Bundes eine Sensibilisierungskampagne lanciert. [1]
Böden sind eine der unverzichtbaren Lebensgrundlagen des Menschen. Ihre Entstehung benötigt Hunderte von Jahren, ihre Zerstörung oft viel weniger. Daher ist der natürlich gewachsene Boden in der Schweiz durch das Umweltschutzgesetz und die seit 1998 gültige Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vor chemischen, biologischen und physikalischen Beeinträchtigungen geschützt. Mit dem Schutz vor physikalischen Bodenbelastungen sollen künstliche Veränderungen der Struktur, des Aufbaus und der Mächtigkeit vermieden werden (siehe Kasten S. 19). Erweisen sich Eingriffe in den Boden als unumgänglich, wie dies praktisch bei sämtlichen Bauarbeiten der Fall ist, sind gemäss den Umweltvorschriften zumindest alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit der belebte Boden keinen bleibenden Schaden nimmt. Wer Anlagen erstellt, muss deshalb laut VBBo die physikalischen Eigenschaften und die Feuchtigkeit des jeweiligen Bodens berücksichtigen. Auswahl und Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sind grundsätzlich so zu planen, dass es dadurch nicht zu Verdichtungen oder zu anderen Strukturveränderungen kommt, welche die Bodenfruchtbarkeit langfristig gefährden könnten. Im Interesse einer späteren Wiederverwendung des ausgehobenen Erdmaterials müssen die verschiedenen Bodenschichten zudem getrennt voneinander abgetragen und zwischengelagert werden. Denn Strukturschäden entstehen oft auch durch unsachgemässen Bodenaufbau.
Risiken für den Boden beim Bauen
Auf Baustellen werden bedeutende Mengen an fruchtbarem Boden ausgehoben, umgelagert und später vor Ort wieder verwendet oder abtransportiert, um ihn andernorts für Rekultivierungen einzusetzen. Die Eingriffe beschränken sich aber nicht nur auf den eigentlichen Aushub, sondern umfassen häufig auch Flächen im unmittelbaren Umfeld der Baugruben, die als Transportpisten, Manövrierraum für Fahrzeuge und Maschinen oder als Lagerraum für Baumaterialien dienen.
Werden diese Flächen bei nassen Witterungsbedingungen und entsprechend hoher Bodenfeuchtigkeit von schweren Maschinen befahren oder anderweitig belastet, droht die Gefahr einer Verdichtung und Zerstörung der Hohlräume, aus denen eine fruchtbare Bodenschicht zu über 50 Prozent besteht. In verdichteten Böden staut sich das Regenwasser an der Oberfläche, statt zu versickern. Zudem können die meisten Wurzeln nicht mehr in die Tiefe vordringen, was zu Wachstumsstörungen der Pflanzen führt und ihre Anfälligkeit gegenüber Krankheiten erhöht. Und schliesslich kommt der Stoffwechsel der üblichen Bodenlebewesen im Oberboden zum Erliegen, weil ihnen der notwendige Sauerstoff fehlt. Eine Folge davon sind Fäulnisvorgänge, verbunden mit der Freisetzung unangenehm riechender Gase.
Teure Garantieansprüche
Von blossem Auge lassen sich derartige Bodenschäden oft nur schwer erkennen. In der Regel sind die Neubauten schon bezogen, wenn Pfützen nach dem ersten grösseren Regen Hinweise auf eine Bodenverdichtung geben. Da sich einmal geschädigte Böden kaum oder nur mit beträchtlichem Aufwand sanieren lassen, haben die beteiligten Tiefbau- oder Generalunternehmen im Schadenfall teure Garantieleistungen zu erbringen. Schlimmstenfalls müssen sie den gesamten Ober- und Unterboden nochmals ausheben und durch Erdmaterial mit intakter Porenstruktur ersetzen. Solche nachträglichen Sanierungsaktionen kommen die Verantwortlichen weitaus teurer zu stehen als eine vorausschauende Bauplanung, welche die Anliegen des Bodenschutzes bereits in der Vorbereitungsphase berücksichtigt.
Bodenkundliche Baubegleiter auf Grossbaustellen
Auf Grossbaustellen hat sich diese Erkenntnis – vor allem im Tiefbaubereich – mittlerweile durchgesetzt. So werden bei Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegen, heute praktisch alle Erdarbeiten durch speziell ausgebildete und anerkannte Bodenfachleute im Rahmen der sogenannten bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) betreut. Diese Fachperson ermöglicht es dem ausführenden Bauunternehmen, frühzeitig alle bodenrelevanten Eingriffe zu erkennen und zu planen. Ihre Aufgabe besteht darin, abgestimmt auf die spezifischen Verhältnisse vor Ort die je nach Arbeitsschritt erforderlichen Bodenschutzmassnahmen festzulegen und deren korrekte Umsetzung zu begleiten. Damit will man sicherstellen, dass es während des gesamten Bauablaufs nicht aus Unwissenheit, Zeitdruck oder Unachtsamkeit zu schweren Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenstruktur kommt.
Entscheidend ist die zeitliche Flexibilität
Auf kleineren Baustellen müssen – neben der ausführenden Baufirma – vor allem Planer und Architekten diese Aufgaben wahrnehmen. Ein neues Merkblatt und eine Website 1 informieren über das richtige Vorgehen. Sie wurden von den Bodenschutzfachstellen der Kantone und des Bundes im Rahmen einer Sensibilisierungskampagne lanciert. Sind die Bodenverhältnisse ungünstig, verlangt der gesetzlich vorgeschriebene Bodenschutz Einschränkungen beim Einsatz von Baumaschinen, die bis zur mehrtägigen Einstellung der Grabarbeiten gehen können. Dem steht das wirtschaftliche Interesse an einem zügigen und reibungslosen Bauablauf gegenüber. «Der häufigste Fehler besteht darin, dass die Aspekte des Bodenschutzes zu spät in ein Vorhaben einbezogen werden», sagt Marion Kaiser, die als Projektleiterin Umwelt beim Basler Ingenieur- und Planungsbüro Gruner AG bereits mehrere BBB-Mandate betreut hat. «Ohne eine grosse zeitliche Flexibilität, welche die Möglichkeit von Schlechtwetterperioden und damit verbundene Unterbrüche heikler Arbeitsphasen einplant, besteht auf Baustellen ein enormer Druck, der unweigerlich zu Konflikten führt.»
Beim von ihr begleiteten Projekt «Futuro» in Liestal war dies bisher allerdings nicht der Fall. Auf einer Fläche von rund 18 000 m² lässt die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung dort seit März 2007 für etwa 110 Millionen Franken einen ökologisch wegweisenden Verwaltungskomplex erstellen. Um das Landschaftsbild zu schonen, kommen die doppelstöckigen Bürogebäude unter die Erde zu liegen, wobei grosszügige Lichthöfe die Räume ausreichend mit Tageslicht versorgen.
Der Bodenschutz war hier bereits bei der Ausschreibung des Bauauftrags ein Thema. Sind die entsprechenden Auflagen bei Submissionen transparent dargestellt, können offerierende Firmen ihre Kosten für schonende Arbeitstechniken, den Einsatz von Maschinen mit geringer Flächenpressung, das Anlegen von temporären Baupisten oder für Wartezeiten bei zu feuchten Witterungsverhältnissen seriös kalkulieren, was spätere Nachforderungen erspart.
Weichenstellung bei der Detailplanung
Bei der Detailplanung geht es um eine möglichst bodenschonende Organisation des späteren Bauablaufs. In dieser Phase werden etwa die Bodeneigenschaften bestimmt, allfällige Schadstoffbelastungen abgeklärt und die Schichtdicke des getrennt abzutragenden Ober- und Unterbodens ermittelt. Mit Hilfe dieser Angaben lässt sich das Materialmanagement optimieren, indem man den Bodenabtrag, die Transportwege auf der Baustelle sowie den übrigen Flächenbedarf reduziert. Dies geschieht unter anderem durch eine geschickte Erschliessung, die Wahl geeigneter Maschinen, eine hohe Verwertungsquote und das Anlegen zweckmässiger Zwischenlager für die verschiedenen Aushubkategorien.
Instruktion und Kontrolle während der Bauausführung
Am Anfang der Realisierung steht jeweils eine Instruktion der Bauverantwortlichen. In dieser Phase haben die Planungsverantwortlichen sicherzustellen, dass alle Vorgaben für ein bodenschonendes Arbeiten auf der Baustelle auch tatsächlich bekannt sind und umgesetzt werden. So muss etwa der Boden für Erdarbeiten möglichst trocken sein. In der Regel eignen sich die Sommermonate daher am besten. Da der Boden im Spätherbst oft trockener ist als im Frühsommer, sind die Verhältnisse aber auch im Oktober häufig noch ideal.
Für den Bodenaushub kommen ausschliesslich Raupenbagger in Frage, weil sie den Druck auf eine grössere Fläche verteilen als Pneufahrzeuge. Der humusreiche, dunkle Oberboden ist generell getrennt vom ebenfalls noch biologisch aktiven Unterboden, und dieser ist wiederum separat vom mineralischen Untergrund abzutragen. Der schichtweise Aushub erlaubt eine gesonderte Zwischenlagerung der verschiedenen Bodenkategorien und bei späteren Rekultivierungsarbeiten wieder einen geordneten Bodenaufbau.
Die Rekultivierung vorbereiten
Beim Anlegen der Zwischenlager ist auf die Höhenbegrenzung der Schütthöhe zu achten, damit das Erdreich in den Bodendepots nicht durch sein Eigengewicht verdichtet wird. Während die oberste Humusschicht direkt auf dem gewachsenen Boden lagern kann, empfiehlt sich für die Zwischenlagerung des steinigeren Unterbodens eine dünne Schutzschicht aus Sand, die später den Rückbau erleichtert.
Die Zwischenlager sollten mit einer tief wurzelnden Pflanzenmischung begrünt werden. Dies schützt den Boden vor Auswaschung und hält ihn biologisch aktiv. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten ist der Boden in der Umgebung gemäss seiner natürlichen Schichtung wieder einzubauen und möglichst rasch mit einer Grasmischung zu begrünen. Bei einer sachgemässen Rekultivierung erholt er sich in der Regel nach wenigen Jahren von den Strapazen.
[Judith Burri, Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern
Gaby von Rohr, Amt für Umwelt, Kanton Solothurn]
Anmerkung
[1] Das Merkblatt «Für einen wirksamen Bodenschutz im Hochbau – Tipps und Richtlinien für die Planung» und weitere Informationen sind erhältlich unter
– www.bodenschutz-lohnt-sich.ch
– www.bafu.admin.ch > Themen > Boden > Vollzug
– www.soil.ch > Produkte > Bodenschutz
– www.kvu.ch > Zu den Kantonen oder > Themen > BodenTEC21, Mo., 2008.06.02
02. Juni 2008 Judith Burri, Gaby von Rohr
Belastete Standorte: Kostenfalle vermeiden
Wenn sich der Standort für ein Bauvorhaben als schadstoffbelastet entpuppt, kann dies kostspielige Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren oder während der Ausführung und hohe Kosten für die Entsorgung belasteter Materialien nach sich ziehen. Es empfiehlt sich daher, die Belastungssituation des Untergrundes sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen so früh wie möglich abzuklären.
Erste Informationsquelle für die Abklärung einer allfälligen Schadstoffbelastung eines Standortes sind die in jedem Kanton der Schweiz erstellten (oder noch in Bearbeitung befindlichen) Kataster der belasteten Standorte (KbS). Diese Kataster sind öffentlich zugänglich und können in vielen Kantonen via Internet konsultiert werden. Aus dem KbS ist ersichtlich, ob ein Eintrag als Deponie-, Industrie- oder Unfallstandort vorliegt und ob zusätzliche Abklärungen zu treffen sind.
Im KbS wird auch eingetragen, ob es sich um eine «echte» Altlast handelt oder nicht. In der Umgangssprache wird bei allen belasteten Standorten von «Altlasten» gesprochen. In der Altlastenverordnung [1] und im KbS wird der Begriff «Altlast» hingegen nur für einen kleinen Teil der belasteten Standorte verwendet: – Altlasten sind nur diejenigen belasteten Standorte, die zu gravierenden Einwirkungen auf die Umwelt (z. B. das Grundwasser) führen. Bei diesen «echten» Altlasten besteht unabhängig von Bauvorhaben ein Sanierungsbedarf. Dieser Fall ist allerdings selten: Weniger als 10 % der belasteten Standorte sind sanierungsbedürftig. [2] – Bei Belastungen mit geringen Einwirkungen auf die Umwelt spricht die Altlastenverordnung von belasteten Standorten mit Überwachungsbedarf. – In den meisten Fällen im KbS handelt es sich jedoch um belastete Standorte ohne Sanierungs- oder Überwachungsbedarf (oft etwas unpräzise als «Bauherren-Altlasten» bezeichnet). Da in diesen Fällen keine akute Gefährdung für die Umwelt (z. B. das Grundwasser) besteht, sind Massnahmen erst bei einem Bauvorhaben notwendig. Dann können allerdings hohe Kosten für die Entsorgung des baubedingt notwendigen Aushubs anfallen.
Belastete Standorte ohne Sanierungsbedarf
Im Umgang mit Bauprojekten auf eingetragenen Arealen ist ein stufenweises Vorgehen sinnvoll. Ein Eintrag im KbS bedeutet nicht zwingend, dass es sich beim betroffenen Areal tatsächlich um einen belasteten Standort handelt. Ein KbS-Eintrag durch den Kanton erfolgt bei «grosser Wahrscheinlichkeit», dass eine Belastung vorliegt. Bestehen Zweifel, ist es empfehlenswert, in einem ersten Schritt abzuklären, ob der Eintrag überhaupt gerechtfertigt ist. Falls sich der Standort als unbelastet und somit der Eintrag als falsch erweist, kann sich der Bauherr die entsprechenden Untersuchungskosten vom Kanton rückerstatten lassen. [3] Handelt es sich beim betrachteten Areal tatsächlich um einen belasteten Standort, jedoch ohne Überwachungs- oder Sanierungsbedarf, muss erst bei einem Bauprojekt geklärt werden, ob Aushub im belasteten Bereich anfällt oder nicht. Fällt belasteter Aushub an, ist dieser gemäss geltendem Abfallrecht zu entsorgen. [4, 5, 6] Dabei können beträchtliche Mehrkosten anfallen.
Liegt ein Bauvorhaben auf einem belasteten Standort vor, ist daher dringend anzuraten, vor Planungsbeginn die Belastungssituation und damit allenfalls anfallende Zusatzkosten abzuklären. Die Umweltbehörde verlangt für Vorhaben auf belasteten Standorten ohne Überwachungs- oder Sanierungsbedarf nur minimale Abklärungen,verlässliche Prognosen zu Mengen und Kostenfolgen werden nicht verlangt. Daher muss die Bauherrschaft bzw. die Bauherrenvertretung selbst entscheiden, welche Planungssicherheit für das Projekt angestrebt werden soll. Die Untersuchungsgenauigkeit richtet sich nach dem Sicherheitsanspruch oder eben nach der Risikobereitschaft der Bauherrschaft. Bei hoher Risikotoleranz wird vor der Ausführung in der Regel nur wenig untersucht. Damit werden die Untersuchungskosten tief gehalten; allerdings wird damit ein höheres Risiko für die später auftretenden Kosten in Kauf genommen (Bild 3). Dieses Vorgehen kann sinnvoll sein bei Bauvorhaben auf eigenen Grundstücken zum Eigenbedarf. Bei tiefer Risikotoleranz, insbesondere bei Verkaufsobjekten, versucht man, die Kostenrisiken durch gezielte Untersuchungen in den Verdachtsbereichen einzugrenzen. In diesem Fall lohnt sich ein höherer Untersuchungsaufwand, da die Untersuchungskosten mit grosser Wahrscheinlichkeit tiefer sein werden als der zusätzliche «Minderwert», den der Käufer geltend macht, wenn er zu wenig über die Belastungssituation weiss.
Vor Baubeginn müssen die Bauverantwortlichen das Dekontaminationsziel (umgangssprachlich: «Sanierungsziel») festlegen. Wollen sie alle belasteten Materialen vom Grundstück entfernen (Totaldekontamination) oder nur den baubedingt notwendigen Aushub tätigen (Teildekontamination)? Die Behörde macht bei belasteten Standorten ohne Überwachungsund Sanierungsbedarf keine entsprechenden Vorgaben; die Bauherrschaft kann frei wählen. Eine Totaldekontamination ist immer teurer, sie ermöglicht aber die anschliessende Entlassung der Parzelle aus dem KbS. Dies kann bei einem Verkauf der ganzen Liegenschaft oder beim Verkauf von Wohneigentum von Vorteil sein. Die bessere Verkäuflichkeit rechtfertigt in diesem Falle den Mehraufwand für die Totaldekontamination. Bei Eigenbedarf oder bei einer Vermietung ist dieser «psychologisch begründete Minderwert» in der Regel weniger ein Problem, die günstigere Teildekontamination ist hier sinnvoller.
Belastete Standorte mit Sanierungsbedarf
Auf Arealen mit Sanierungsbedarf (also bei den «echten» Altlasten) sind Sanierungsmassnahmen auch dann durchzuführen, wenn kein Bauvorhaben vorliegt. Ist ein Bauvorhaben auf einer sanierungsbedürftigen Altlast geplant, so sollte das zu erstellende Sanierungsprojekt [1] sinnvollerweise mit dem Bauvorhaben koordiniert werden. Eine Baubewilligung durch die zuständige Behörde wird erst nach dem Vorliegen einer Genehmigung des Sanierungsprojektes erteilt.
Als Sanierungsziel verlangt die Altlastenverordnung nicht, dass die Schadstoffe notwendigerweise vom Standort zu entfernen sind. Es gilt das Prinzip des nachhaltigen Quellenstopps. Die Ziele der Sanierung können mit Massnahmen erreicht werden, mit denen: – die Schadstoffe beseitigt werden (Dekontamination) – die Ausbreitung der Schadstoffe verhindert und überwacht wird (Sicherung) – die Nutzung bei Bodenbelastungen eingeschränkt wird (Nutzungseinschränkung) [2] (Bild 2)
Für jede Altlast sind unter Berücksichtigung obiger Rahmenbedingungen zahlreiche Sanierungsvarianten denkbar. Dazu gehören Dekontaminationsmassnahmen wie Bodenluftabsaugungen und «Pump and treat»-Verfahren, Sicherungsmassnahmen wie Oberflächenabdichtungen, Spundwände und Dichtwände oder Nutzungseinschränkungen (z. B. kein Spielplatz auf einer stark belasteten Rasenfläche). Viele der theoretisch denkbaren Varianten sind im konkreten Einzelfall jedoch technisch sehr aufwendig, wenig wirksam oder sehr teuer. Für die Auswahl der ökologisch und ökonomisch optimalen Sanierungsversion werden die Varianten daher nach verschiedenen Beurteilungskriterien wie Machbarkeit, Wirksamkeit und Kosten bewertet.
Kostenrisiko und Kostenoptimierung
Späte oder ungenügende Altlastenabklärungen führen häufig zu terminlichen Verzögerungen bei der Projektabwicklung und damit zu Mehrkosten. Es ist deshalb frühzeitig sicherzustellen, dass die für die Erteilung der Baubewilligung und Baufreigabe notwendigen Nachweise, Untersuchungen und Konzepte vorliegen.
Bei der anschliessenden Ausführung stellen die Entsorgung von Aushub und / oder Sanierungsmassnahmen bei «echten» Altlasten erhebliche Kostenrisiken dar. Zur besseren Abschätzung der zu erwartenden Kostenfolgen empfehlen sich unter Umständen detailliertere Untersuchungen. Bei frühzeitigem Einbezug der Belastungssituation in die Planung eines Bauprojekts sind durchaus Möglichkeiten zur Kostenoptimierung gegeben: – Planung einer Baugrube möglichst ausserhalb des belasteten Bereichs – Verzicht auf ein Untergeschoss, z. B. Verlegung der Haustechnik auf das Gebäudedach – Teil- statt Totaldekontamination anstreben (nur baubedingt notwendigen Aushub tätigen) – Ausführung einer Sicherung anstelle einer Sanierung bei «echten» Altlasten – Professionelle Ausschreibung und Kontrolle der Entsorger durch geschulte Altlastenfachperson – Keine Pauschalvergaben von Aushub und Entsorgung in belasteten Bereichen (Pauschalen enthalten immer einen Risikozuschlag und sind bei unerwarteten Belastungen sowieso hinfällig) – Gute Triage (Trennung von belastetem und unbelastetem Material) mit gut instruiertem Baustellenpersonal – Schwach belastetes Material (T-Material4) vor Ort wieder einbauen (Areal bleibt dann jedoch im KbS verzeichnet) – Frühzeitig (vor Vertragsunterzeichnung) alle umwelt- und privatrechtlichen Rahmenbedingungen abklären. – Regress nehmen auf die ursprünglichen Verursacher der Belastung; wenn diese nicht mehr greifbar sind, muss der Kanton die Ausfallhaftung übernehmen.
Ein starres, standardisiertes Vorgehen ist dabei wenig sinnvoll; jedes Projekt stellt eine neue Herausforderung für Bauherren und Altlastenfachpersonen dar.
[Rita Hermanns Stengele, Dr. sc. techn. ETH / SIA, Dipl.-Ing.
Bauingenieurin, Friedlipartner AG, Zürich
Daniel Bürgi, dipl. Natw. ETH, NDS BWI ETH,
Umweltnaturwissenschafter, Friedlipartner AG, Zürich]
Anmerkungen / Literatur
[1] Bundesrat: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten, Altlasten-Verordnung (AltlV). Bern, 1998
[2] Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal, heute Bafu): Altlasten: erfassen, bewerten, sanieren. Bern, 2001
[3] Bundesrat: Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG). Bern, 2006
[4] Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal, heute Bafu): Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von mineralischem Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie AHR). Bern, 1999
[5] Bundesrat: Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Bern, 1990
[6] Bundesrat: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA). Bern, 2005TEC21, Mo., 2008.06.02
02. Juni 2008 Rita Hermanns Stengele, Daniel Bürgi