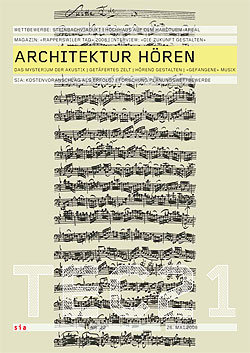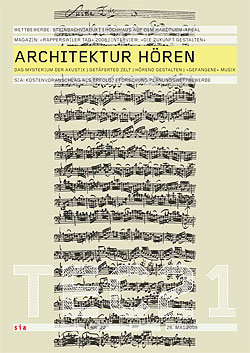Editorial
Ob ein Raum eine gute Akustik aufweise, schrieb Adolf Loos 1912, sei weniger von dessen Geometrie als vielmehr von der Materialisierung abhängig. Dabei meinte er nicht lediglich die Kombination schallabsorbierender oder -reflektierender Baustoffe, sondern das, was er als «Mysterium der Akustik» [1] bezeichnete: Die Materialien würden die Qualität der Töne gleichsam speichern. Um die akustische Qualität eines Raumes zu erhöhen, müsse man demnach über Jahre hinweg ausschliesslich gute Musik darin spielen: «Im Mörtel des Bösendorfer Saales wohnen die Töne Liszts und Messchaerts und zittern und vibrieren bei jedem Ton eines neuen Pianisten und Sängers mit.» Entsprechend sei es auch möglich, einen akustisch einwandfreien Raum durch schlechte Musik zu verstimmen.
Loos’ kurzer Text ist auf Seite 26 integral abgedruckt. Nicht nur wegen seiner erfrischenden, bisweilen absurden Polemik und seiner hintergründigen Poesie, sondern auch, weil er auf Probleme hinweist, die heute aktueller sind denn je: Wie soll man architektonisch mit Innenräumen umgehen, in denen alles andere als hochstehende Töne erklingen – also mit den allermeisten? Welche städtebaulichen Mittel gibt es für die akustische Gestaltung von Quartieren, deren Klangkulisse nicht von den Wiener Philharmonikern, sondern von Motorengeräuschen, schlagenden Autotüren und spielenden Kindern geprägt wird?
In diesem Heft soll es nicht um die akustische Optimierung von Konzertsälen gehen, sondern um das, was wir praktisch rund um die Uhr in unserer gebauten Umwelt zu hören bekommen. Ein Bericht erläutert die Methoden und Ziele eines Forschungsprojekts, das die akustische Langzeitbeobachtung der Stadt Schlieren in der Zürcher Agglomeration zum Ziel hat; aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen Strategien und Methoden entwickelt werden, um akustische Aspekte in zukünftigen Planungen besser berücksichtigen zu können. «Getäfertes Zelt» untersucht einen letztes Jahr fertiggestellten dörflichen Mehrzweckraum, der unterschiedlichsten und teilweise auch widersprüchlichen akustischen Anforderungen gerecht wird, ohne dabei auf architektonische Qualität zu verzichten.
Als Abschluss – und als Kontrast sowohl zu Loos’ Theorie als auch zum nüchternen Alltag – widmen wir uns der Frage, was mit Musik geschieht, die ein virtuoser Cellist in einem imaginären Raum spielt.
Judit Solt
Anmerkung
[1] Adolf Loos: «Das Mysterium der Akustik», in: Über Architektur – Ausgewählte Schriften. Die Originaltexte. Hrsg. Adolf Opel. Prachner, Wien 1995