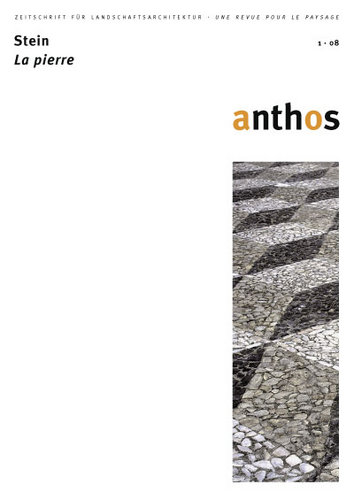Editorial
Die Menschheit sitzt in einem Hochgeschwindigkeitszug – ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Darüber kann man nur spekulieren, Szenarien aufstellen, Modelle berechnen. Technisches Wissen potenziert sich ständig und beschleunigt das Entwicklungstempo. Neben aller Euphorie erzeugt dies auch Unsicherheit und Ängste.
Stein, die gewachsene Grundsubstanz unseres Planeten, aufbereitet durch die Kräfte der Natur, evoziert dagegen Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrautheit, emotionale Werte in einer schnelllebigen Zeit. Seit Jahrtausenden ist Naturstein Roh- und Baustoff der Menschen. Wind und Wetter ausgesetzt, ist er durch nichts zu ersetzen. Seine Schönheit und Ausstrahlung, die unglaubliche Vielfalt an Farben und Maserungen wird von keinem Industrieprodukt erreicht. Seit jeher geht vom Stein eine Faszination aus, eine Magie, die oft in kosmische Dimensionen weist. Allein von den britischen Inseln sind uns 700 vorgeschichtliche monumentale Steinkreise bekannt. Und Künstler aller Epochen haben grossartige Werke aus Stein geschaffen.
Auch in der Landschaftsarchitektur ist Stein – neben der Pflanze – das wichtigste Gestaltungselement. Selbst in einer Zeit, wo sich die Profession in grossflächige Asphaltbeläge vernarrt hat, entstehen immer wieder hervorragende Gestaltungen mit Naturstein, wie dieses anthos zeigt. Nicht verschwiegen werden sollen aber auch die Probleme rund um den Naturstein. Er ist teuer, das Budget meist klein. So verschliesst man sich gerne der Frage, wo unsere Steine eigentlich herkommen, vor allem natürlich die billigeren. Ist es China, Indien oder Brasilien? Wird mit dem Abbau ein Stück Umwelt zerstört? Vielleicht sogar von Kindersklaven? Eine differenzierte Betrachtung hierzu lesen Sie ebenfalls in diesem Heft. Und – gehen in der Schweiz Steingewinnung und Landschaftsschutz wohl immer Hand in Hand?
anthos startet in diesem Heft mit einer neuen Rubrik, dem «Forum». Diese wird jeweils im Anschluss an den thematischen Teil – im losen Wechsel mit den Rubriken «Porträt » und «Das Detail» – erscheinen. Hier sollen Autorinnen und Autoren zu Wort kommen, die sich, unabhängig vom Heftthema, zu besonderen, aktuellen und kritischen Fragen äussern. Den Anfang macht Matthias Stremlow mit Betrachtungen zum umstrittenen Begriff «Heimat» und dessen Tauglichkeit für den Natur- und Landschaftsschutz.
Bernd Schubert