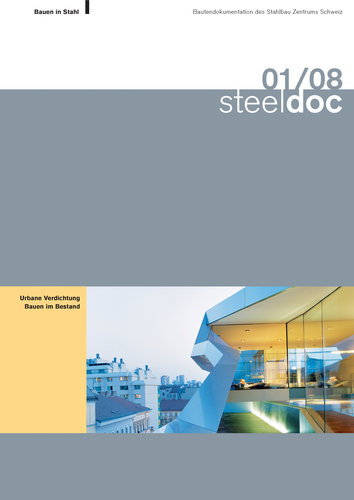Editorial
Stadtraum ist begehrt und teuer. Die Verdichtung der bestehenden Bausubstanz in den Städten und Ballungszentren ist deshalb von zunehmender Bedeutung. Schon seit Jahren sagen Konjunkturforscher voraus, dass sich die Bautätigkeit von der grünen Wiese wieder in die Städte verlagern wird, wo bestehende Bausubstanz saniert und umgenutzt wird. Bei der Verdichtung des Stadtraums geht es um die Nutzung von brachliegenden Dachflächen, um die Schliessung von Baulücken oder die Verdichtung von Innenhöfen. Interessant dabei ist es, die vorhandene Infrastruktur des Altbaus zu nutzen und das Gebäude aufzuwerten. Vor allem das Potenzial der freien Dachflächen ist vielerorts noch völlig unausgeschöpft. Wo es die Bauordnung erlaubt, können Geschosse aufgestockt und Dachräume umgenutzt werden, was dem bestehenden Gebäude ein neues Gesicht gibt und attraktiven Wohn- und Arbeitsraum schafft.
Dass sich die Stahlbauweise für diese Eingriffe im Bestand besonders eignet, liegt auf der Hand. Geringes Gewicht bei grosser Tragfähigkeit, Vorfertigung, einfache Montage, modulare Ergänzung und eine Baustelle ohne Lärm und Staub sind entscheidende Vorteile, wenn die Platzverhältnisse eingeschränkt sind und der Betrieb im Gebäude und in der Stadt ringsum während dem Bau weiterläuft. Dazu kommt, dass man bei einer Tragstruktur aus Stahl bis zu 10 Prozent Konstruktionsvolumen einspart, das dem wertvollen Nutzungsraum zugeschlagen werden kann. Der Unterhalt des Neubaus und des Altbaubestandes ist durch die modulare Bauweise einfach und kostensparend. Und schliesslich bietet der Stahlbau eine totale Nutzungsfreiheit, von der mancher Bauherr sogar schon während den Bauarbeiten Gebrauch macht. So wird der Einbau einer neuen Treppe, eines Durchgangs oder einer Nasszelle zum Kinderspiel. Wer damit noch nicht genügend Argumente für die Nachhaltigkeit der Stahlbauweise hat, kann noch ins Feld führen, dass europäischer Baustahl hauptsächlich aus Recyclingmaterial besteht.
Im vorliegenden Steeldoc werden Projekte vorgestellt, die in kreativer Weise brachliegenden Stadtraum erschliessen und dabei sorgsam mit dem Altbaubestand umgehen. Natürlich gibt es auch in der Schweiz etliche solcher Beispiele, wie der Hofeinbau der juristischen Fakultät Zürich von Calatrava, der bereits dokumentiert wurde, die Aufstockung Epsilon des Grossprojektes Sihlcity von Theo Hotz oder des SIA-Hochhauses von Romero & Schaefle in Zürich. Leider ist es uns nicht gelungen, letztere beiden Projekte zu dokumentieren. Umso aufschlussreicher werden die attraktiven Auf- und Einbauten in anderen Städten vorgestellt, ob prestigeträchtige oder einfache und kostengünstige. Wir wünschen unseren Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre und beim Studium der folgenden Seiten von Steeldoc.
Inhalt
03 Editorial
04 Wohnhaus Ray 1, Wien
Demarkationslinie zwischen Himmel und Erde
10 Haus im Haus, Handelskammer Hamburg
Gläsernes Herz in stilvollen Mauern
16 Wohnen im Zentrum, Wien
Luxus-Mansarden für die Grossstadt
22 Dachaufbau Wohnhaus, Stuttgart
Die Leichtigkeit des Wohnens
26 Dachaufbau Bürogebäude, Biel
Lounge in Himmelsnähe
31 Impressum
Demarkationslinie zwischen Himmel und Erde
Der Bauplatz ist ungewöhnlich. Das Flachdach eines Wiener Bürogebäudes haben die Architekten Degulan Meissl lediglich gepachtet und darauf eine gefaltete Raumskulptur als «Haus auf dem Haus» gebaut. Ebenso ungewöhnlich ist der schwebende Raumeindruck, der durch die stützenfreien Spannweiten des Stahlfachwerks erreicht wird. James Bond lässt grüssen.
Die Aufstockung ist von der Strasse her kaum wahrnehmbar und erfüllt wider Erwarten die strengen Bauvorschriften für Flachdachaufbauten der Stadt. Ein Bürogebäude aus den 60er Jahren hat damit einen dynamischen Abschluss erhalten, eine Art extravaganten Hut, der die Begegnung zwischen alt und neu, zwischen statischem Körper und dynamischer Form zelebriert. Der Neubau führt die Giebellinie zwischen den beiden angrenzenden Häusern fort und schliesst gewissermassen eine Baulücke. Dabei schafft er durch seine Faltung und Raumstaffelung eine durchlässige Grenze zwischen dem strengen Altbau und dem bewegten Wiener Stadthimmel. Obwohl der Entwurf baurechtlich als Flachdachaufbau gilt, konnte in Abstimmung mit der Baubehörde eine neue Interpretation gefunden werden. Die strassenseitige Auskragung des Gebäudes ist zum Beispiel aus baurechtlicher Sicht eine Gaube.
Die Grundfigur von Ray1 basiert auf der längsrechteckigen Form des Sockelbauwerks. Daraus entwickelt sich ein Baukörper von skulpturalem Charakter. Der Zugang erfolgt über den knapp sechs Meter aus der hofseitigen Gebäudefront auskragenden Kubus, der achsversetzt auf dem Treppenhaus-Risalit sitzt. Ein lang gestreckter, mit flachen Treppen langsam ansteigender Gang führt in den loftartigen Wohnbereich, der sich als Raumkontinuum fliessend nach oben entwickelt. Die plastische Gestaltung der Aussenhaut schafft auch im Innenraum Zonen mit verschiedener Wertigkeit. Nischen und Möbel entwickeln sich direkt aus dem Formenverlauf der Architektur heraus und schaffen einen fliessenden Übergang von äusserer Hülle zu innerer Wohn-Landschaft. Der weiträumige Wohnbereich mit der zentralen Küche liegt etwa einen Meter höher als die separierten Schlafzonen. Eine grosse, lederbezogene Liegelandschaft öffnet sich in einer über die Grundstücksgrenzen expandierenden Gebäudefaltung. Sie liegt über die ganze Breite vollständig auf tragendem Glas auf und scheint so vom Boden losgelöst zu schweben.
Eine Eckverglasung lässt sich vollständig zur Terrasse hin öffnen und erweitert damit den Wohnbereich um einen spektakulären Aussenraum. Der Terrasse ist ein schmales, mit Sitzstufen versehenes Bassin vorgelagert, so dass auf ein Geländer verzichtet werden konnte. So entsteht eine harmonische Verbindung von ruhendem Ort und räumlicher Bewegung.
Um auf das Tragwerk des Altbaus reagieren zu können, wurde die Aufstockung als Stahlskelettbau realisiert. Durch ein homogen verdichtetes Stahlrohrsystem werden die Lasten über die gesamte Fläche gleichmässig verteilt und vor allem über die Giebelwände in den Altbestand eingeleitet. Die entwurfsimmanenten Faltungen der Dachlandschaft führen zu einem weitgehend stützenfreien Raumfluss.
Für Haus Ray 1, das seinen Namen der Bauherrentochter verdankt, gab es weder ökonomische Restriktionen noch ideelle Einschränkungen, da die Architekten ihre eigenen Bauherrn waren. Ein umfassendes Ineinanderwirken von Tragwerksplanung und Entwurfskonzept führte zu dieser Architektur als Stadt-Landschaft.Steeldoc, Mo., 2008.06.09
09. Juni 2008 Evelyn C. Frisch
verknüpfte Bauwerke
Ray 1
Luxus-Mansarden für die Grossstadt
Aus dem Mansard-Geschoss eines historischen Wiener Stadtblocks sind exklusive Appartements entstanden. An der äusseren Form der alten Mansard-Dächer wurde kaum etwas geändert – die Konstruktion ist allerdings ein leichtes, lichtdurchflutetes Stahlgehäuse, ausgestattet mit edelsten Materialien und Klimatechnik.
Es ist eine der besten Adressen für gehobene Wohnansprüche im historischen Zentrum von Wien. Kein Wunder, hat die Bauherrschaft das Projekt durch einen europäisch ausgeschriebenen Projektwettbewerb ausgelobt. Der 5-geschossige Gebäudeblock von 1860 wird durch vorspringende Mittel- und Eckrisalite gegliedert. Da einige der ursprünglichen Dachaufbauten im 2. Weltkrieg zerstört und nach dem Krieg durch unsensible Ergänzungen mehr schlecht als recht «repariert» worden waren, wurde eine Komplettsanierung des Dachgeschosses mit einer Nutzungsänderung zu Wohnzwecken ins Auge gefasst. Im Sinne des Denkmalschutzes sollte der historische Umriss des Gebäudes als Gestaltungsmaxime dienen.
In Anlehnung an die ursprüngliche Form des Gebäudes projektierten die Architekten insgesamt 12 exklusive Wohnungen, die man für sich genommen als Stadt-Villen bezeichnen könnte. Die neuen Wohnungen werden über drei neue, vor den Altbau positionierte Lifttürme erschlossen. Die bestehenden Treppenhäuser dienen lediglich als Fluchtwege im Brandfall. Von den Aufzügen aus erreicht man die Wohnungen durch fingerartig ausgebuchtete Erschliessungsflure. Die organischen Gehwege sollen die Flexibilität für zukünftige Entwicklungen garantieren und gleichzeitig Identifikation und Nachbarschaft fördern.
Die bis zu 420 m² grossen Maisonetten mit Terrasse, Einliegerwohnung, zwei Bade- wie Schlafzimmer bieten einen atemberaubenden Ausblick auf den Wiener Ring. Der Benutzer navigiert in einem Raumkonstrukt, dessen enorme Technikausstattung in den Innenräumen nicht wahrzunehmen ist. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen 6 m² grossen Haustechnikraum. Alle Leitungen sind in 50 bis 100 cm hohen Doppelböden untergebracht. Die räumliche Exklusivität bezieht sich auch auf die Materialwahl im Innenausbau, welche gemäss den Vorstellungen der jeweiligen Eigentümer offen stand. Auch die Transparenz der Fassade und der Zwischenwände wurde durch die Wahl von geschlossenen, transparenten oder offenen Elementen den individuellen Vorlieben der Hausherrschaften angepasst.
Leichte Tragstruktur auf alten Mauern Um Fundamentverstärkungen in den Untergeschossen zu vermeiden, sollte eine gleichmässige Lastabtragung entsprechend den darunter liegenden Geschossen erreicht und das Gewicht der Konstruktion optimal an die entsprechenden Bestandsverhältnisse angepasst werden. Die gesamte Dachform verläuft auf die Gebäudetiefe als durchgehende Kurve mit unterschiedlichen Radien. Die Primärstruktur wurde dabei durch Stahlträger mit einem Achsabstand von 4-6 Metern gelegt. Die Lastabtragung erfolgt über die Aussen- und Mittelmauer, wodurch die Lastzunahme auf das bestehende Objekt gleichmässig verteilt werden konnte.Die Zugkräfte in den Hauptrahmen werden durch Zugbänder in der Fussbodenkonstruktion aufgefangen. Die Längsaussteifung erfolgt über die Flächenwirkung der Galerieebenen und der nordseitigen Dachebene. Die Primärkonstruktion besteht demnach aus geschweissten, paraboloid gekrümmten Stahlbögen in einem Abstand von etwa 15 Metern. In jedem vierten Feld wird die Konstruktion durch Diagonalstäbe zur Aufnahme von Längs- und Querkräften ausgesteift.
Die Sekundärkonstruktion besteht aus Elementdecken aus Stahlbeton und aus hochgedämmten Holzleichtbauelementen im Dachbereich. Die Betondecken wurden aus bauphysikalischen Erwägungen eingebaut. Durch die Wahl einer Stahlkonstruktion war die Flexibilität während der gesamten Planungs- und Bauphase gewährleistet, so dass auch kurzfristige Umplanungen möglich waren. Diese Flexibilität zahlt sich auch bei zukünftigen Umnutzungen oder Anpassungen aus.
Zur Strasse hin wurde die bauchige Dachhaut mit grau vorbewitterten Zinkblechen eingedeckt. Die flächenbündigen Verglasungen sind mittels darüber liegenden Aluminiumlamellen beschattet. Zur Hofseite öffnen sich Terrasseneinschnitte, die ebenfalls durch Sonnenschutzlamellen in Form gehalten sind. Im Scheitelpunkt der Bögen und im Bereich der Galeriedecken wurde die Lamellenverteilung dichter gewählt, während die Abstände auf Augenhöhe grösser sind. Da der Verglasungsanteil von 70 Prozent eine hohe Erwärmung im Sommer erwarten lässt, wurde eine stille Kühlung mittels Klimaplatten an den Decken und im Schrägdachbereich installiert. Man kann nachvollziehen, dass das Berühren gekühlter Wandflächen im heissen Wiener Sommer ein durchaus angenehmes Gefühl sein muss. Ziel der Planer war es, bei einer Aussentemperatur von 34 Grad im Innenbereich maximal 26 Grad spürbar zu machen, deswegen gibt es zusätzlich noch Heiz-Kühl-Estriche, kontrollierte Wohnraumlüftung und klassische Umluft-Quellluft-Fancoils.Steeldoc, Mo., 2008.06.09
09. Juni 2008 Evelyn C. Frisch
verknüpfte Bauwerke
WZW Dachausbau