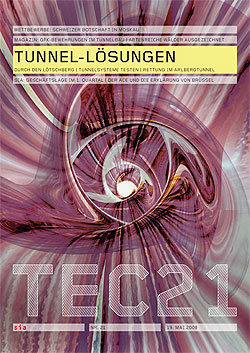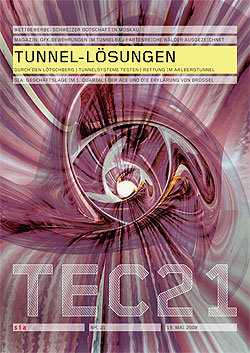Editorial
Der Lötschberg-Basistunnel, ehemals politisch umstritten und redimensioniert, ist im Dezember 2007 reibungslos in Betrieb genommen worden. Heute, wenige Monate später, ist die teilweise eingleisige Verbindung bereits weitgehend ausgelastet. Die Meinungen zur Zweckmässigkeit des Bauwerks gehen weiterhin auseinander, doch dürfte der fulminante Start den Kritikern doch einigen Wind aus den Segeln genommen haben. Dafür zeichnen sich bereits Kapazitätsengpässe, auch auf den Zubringerlinien, ab. Einen Überblick über die bisherige Entwicklung, die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven am Lötschberg vermittelt der Beitrag ab S. 18.
In sehr langen Tunnels wie dem Lötschberg-Basistunnel wird auch bezüglich Sicherheit Neuland betreten. Allerdings nicht unvorbereitet, denn jahrzehntelange Erfahrungen sowie theoretische und praktische Erkenntnisse in Projektierung und Betrieb von Tunnels sind in dieses Projekt eingeflossen. Dazu gehören auch die Lehren, die aus glücklicherweise seltenen, aber umso wertvolleren früheren Unglücksfällen gezogen wurden, wie etwa aus dem Brand eines Lastenzugs vom 3. Oktober 1989 auf dem Lehnenviadukt Beckenried der A2. Dabei floss brennendes Dieselöl in die Brückenentwässerung, die teilweise verbrannte oder schmolz, wobei am Beton beträchtliche Schäden entstanden. Aus diesem Unfall und aus den in der Folge durchgeführten Brandversuchen und Modellierungen wurden Erkenntnisse zur Brandsicherheit von Kunstbauten und zu ihrer Entwässerung gewonnen. Sie sind auch auf die Entwässerung und die technische Ausrüstung von Tunnels übertragbar. Der Beitrag «Tunnelsysteme testen» zeigt anhand der Tunnelentwässerung und weiterer Teilaspekte des Lötschberg-Basistunnels beispielhaft, wie sicherheitsrelevante Risiko- und Einflussfaktoren heute definiert und verifiziert werden.
Ein anderer historischer Unglücksfall hat frühzeitig die Notwendigkeit von Rettungsmassnahmen in Tunnels aufgezeigt: Am 4. Oktober 1926, zur Zeit des Dampfbetriebs, blieb ein Güterzug im eingleisigen, 8603 m langen Ricken-Tunnel zwischen Kaltbrunn und Wattwil (SG) stehen. Die 6 Mann des Zugpersonals und 3 Mitglieder einer Hilfskolonne starben darauf an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das damalige Unfallszenario ist durchaus noch aktuell: Die grossen Mengen von brennbaren oder toxischen Stoffen, die durch Tunnels transportiert werden, stellen insbesondere bei Stillstand oder Havarie ein Sicherheitsrisiko dar. Selbstrettung und Evakuation der Betroffenen sind von zentraler Bedeutung. In älteren Tunnels fehlen dafür aber die baulichen Voraussetzungen. Der Beitrag ab S. 28 beschreibt die elegante Lösung des Dilemmas am Arlberg. Das realisierte, bisher einzigartige Konzept könnte unter günstigen Voraussetzungen auch zur sicherheitstechnischen Sanierung anderer Tunnelbauwerke beitragen.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schweizer Botschaft in Moskau
10 MAGAZIN
GFK-Bewehrungen im Tunnelbau | Artenreiche Wälder ausgezeichnet | Der Wald produziert nicht nur Holz
18 DURCH DEN LÖTSCHBERG
Toni Eder
Kaum in Betrieb gesetzt, ist der erste Alpen-Basistunnel schon weitgehend ausgelastet. Mit Einbezug der Bergstrecke kann das Verkehrsvolumen noch bewältigt werden.
22 TUNNELSYSTEME TESTEN
Urs Stoller et al.
Entwässerung, Lüftung und weitere Systeme im Lötschberg-Basistunnel müssen auch im Ereignisfall zuverlässig funktionieren. Mit realistischen Messungen ist das vor der Eröffnung verifi ziert worden.
28 RETTUNG IM ARLBERGTUNNEL
Hanspeter Stadelmann
Bei dieser einzigartigen Symbiose von Bahn- und Strassentunnel dienen die beiden parallelen Röhren gegenseitig als Flucht- und Rettungswege.
33 SIA
Geschäftslage im 1. Quartal | NPK-Vernehmlassung | Häufige Fragen bei Wettbewerben | Der ACE und die Erklärung von Brüssel
36 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Durch den Lötschberg
Der Lötschberg-Basistunnel wurde im Dezember 2007 für den Personenverkehr freigegeben. Die Verkehrsnachfrage übertrifft alle Erwartungen. Da erst eine der beiden Röhren durchgehend betriebsfertig ausgebaut ist, wird immer wieder der Vollausbau gefordert. Der Autor gibt einen Überblick über die heutige Nutzung und wägt das Für und Wider eines Ausbaus ab.
Seit dem 9. Dezember 2007 fahren die Züge fahrplanmässig durch den Lötschberg. Zwischen Bern und dem Wallis verkehren täglich rund 40 Personenzüge und 60 Güterzüge durch den Basistunnel; über die Bergstrecke kommen etwa 40 Personenzüge und 20 bis 25 Güterzüge hinzu. Für Personenzüge beträgt die Fahrzeit von Spiez nach Brig durch den Basistunnel 35 Minuten gegenüber rund 70 Minuten über die Bergstrecke. Damit ist mit dieser zentralen innerschweizerischen schnellen Verbindung auch ein wichtiges Mosaikstück in der Anbindung der Schweiz an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz realisiert. Für den Güterverkehr schafft der Lötschberg-Basistunnel zusätzliche Kapazitäten, um den Schwerverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern.
Der 34.6 km lange Tunnel besteht zwischen dem Nordportal in Frutigen und Mitholz aus einer Tunnelröhre und dem zum Rettungs- und Sicherheitsstollen umgebauten früheren Sondierstollen Kandertal. Südlich von Mitholz bis zum Südportal in Raron bestehen zwei Einspurtunnelröhren. Zwischen Frutigen und Ferden ist nur eine, im Abschnitt Ferden – Raron sind beide Röhren bahntechnisch ausgerüstet (Bild 2).
Das Gesamtsystem Lötschberg
Auf den durchgehenden Ausbruch und den Vollausbau der zweiten Röhre wurde im Zuge der heftigen politischen Diskussionen über die Finanzierung der Neat als Gesamtsystem Gotthard – Lötschberg im Wesentlichen aus Kostengründen verzichtet. Es konnte dadurch ca. 1 Milliarde Franken gespart werden. Damit wurde die Realisierung der Netzlösung, d.h. der Bau von beiden AlpTransit-Achsen, möglich. So steht im gültigen Alpentransit Beschluss [1], dass «das Netz der BLS Lötschbergbahn AG (...) durch einen neuen, teilweise eingleisig ausgerüsteten Lötschberg-Basistunnel zwischen dem Raum Frutigen und dem Raum Steg / Baltschieder einschliesslich der Verknüpfungen an die Stammlinien erweitert» wird. Dieser Parlamentsauftrag ist seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2007 erfüllt. Das heutige System – Lötschberg-Basistunnel und Lötschberg-Scheiteltunnel – genügt kapazitäts- mässig mittelfristig für das zu bewältigende Verkehrsaufkommen. Im Basistunnel fahren die schnellen Personenzüge, alle Güterzüge nach Süden und 1/3 der Güterzüge nach Norden. Durch den Scheiteltunnel verkehren die Züge für den Autoverlad Kandersteg – Goppenstein. Die Bergstrecke Frutigen – Brig wird für den Tourismus- und den Interregioverkehr sowie für den periodischen Autoverlad bis Iselle genutzt. Zugleich ist sie auch Entlastungs- und Ausweichstrecke für den Basistunnel. Weiter werden 2/3 des Güterverkehrvolumens Richtung Norden über die Bergstrecke geführt, da sie in der Regel ein geringeres Gewicht aufweisen. Basis- und Scheiteltunnel bilden somit ein Gesamtsystem für eine kapazitätsseitig homogene Nord-Süd-Achse.
Engpässe auf den Zulaufstrecken und deren Beseitigung
Seit der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels verkehrt der Güterverkehr auf der Achse Lötschberg – Simplon über Basel entlang der folgenden Strecke durch die Schweiz: Basel – Ergolztal – Olten – Bern [2] – Lötschberg-Basistunnel oder Bergstrecke – Simplontunnel – Domodossola. Gegenwärtige und prognostizierte Engpässe auf den Zulaufstrecken werden mit einer Reihe von Massnahmen in den nächsten Jahren behoben (Bild 3). Damit wird der Güterverkehrsnachfrage auf dieser Achse mittelfristig entsprochen werden können.
Die Frage des Vollausbaus des Lötschberg-Basistunnels
Bereits während des Baus wurden Forderungen nach einem Vollausbau des Tunnels gestellt. Sie kommen vor allem aus den Kantonen Wallis und Bern und haben sich jetzt verstärkt. Schon sehr bald nach der Betriebsaufnahme der neuen Strecke zeigte sich, dass das neue Angebot so gut genutzt wird, dass alle Erwartungen im Personenverkehr übertroffen wurden und fast alle Gütertrassees bereits belegt sind. Tatsächlich verkehrten am bisherigen Spitzentag, dem 24. Januar 2008, 108 Züge durch den Basistunnel. Die Forderung nach einem Vollausbau wird auch mit den zeitlichen Verzögerungen beim Bau des Gotthard- Basistunnels als Rückgrat der Neat begründet, der erst rund zehn – statt wie vorgesehen sechs – Jahre nach dem einspurigen Lötschberg-Basistunnel in Betrieb gehen wird. In diesem Zusammenhang ist zudem auf den Umstand hinzuweisen, dass auf einer leistungsfähigen Verkehrsachse einmal eingespielte Verkehrsströme sich erfahrungsgemäss nur schwer auf später fertig gestellte Achsen zurückholen lassen. Betrieblich gesehen hat die Einspurstrecke zur Folge, dass der Lötschberg-Basistunnel nur eine begrenzte Flexibilität aufweist und dadurch Stabilitätsprobleme beim Fahrplan auftreten können. Verspätet eintreffende Züge müssen deshalb auf einen nächsten freien Slot (ein zeitliches «Durchfahrfenster») warten oder über die Bergstrecke geführt werden. Zwischen dem 9. Dezember 2007 und Anfang April 2008 kam dies bei 234 Zügen (Güter- und Personenverkehr) vor, wobei nur 10 % der Fälle auf Störungen der Infrastruktur des Basistunnels zurückzuführen waren, der Rest auf Verspätungen und Störungen der Eisenbahnverkehrsunternehmung. Dabei hat sich gezeigt, dass von den 74 Verspätungsfällen 71 auf Güterzüge entfielen. Insgesamt verkehrten seit der fahrplanmässigen Inbetriebnahme über 10 000 Züge durch den Basistunnel.
Die infrastrukturbedingten Umleitungen über die Bergstrecke betrafen somit lediglich 0.2 % aller Züge, was die hohe Verfügbarkeit des Tunnelsystems belegt. Diese Kapazitäts- und Betriebsfragen gilt es bei der Frage eines allfälligen Vollausbaus zu berücksichtigen: Das heute bestehende, zwischen Zulaufstrecke und Alpenquerung austarierte System ermöglichte eine Optimierung des Einsatzes der finanziellen Mittel. Trotzdem kann damit das Verkehrsvolumen mittelfristig mit dem jetzt gebauten Netz bewältigt werden. Der Lötschberg- Basistunnel wurde entsprechend dem übrigen Bahnnetz auf das Mischsystem ausgelegt, da der Wegfall der Steigungen einerseits der verstärkten Umlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene dienen soll, andererseits im Personenverkehr schnelle und attraktive Verbindungenangeboten werden können. Der Lötschberg-Basistunnel und die doppelspurige Lötschberg- Bergstrecke bilden zusammen ein Gesamtsystem. Dieses ermöglicht die gewünschte Steuerung der Verkehrsflüsse. So war es betrieblich möglich, die erwähnten verspäteten Züge über die Bergstrecke umzuleiten. Die aufgezeigten Stabilitätsprobleme stehen einer Grossinvestition eines durchgehend zweispurigen Ausbaus gegenüber.
Durch den Ausbau der Betriebszentrale der BLS in Spiez, von wo aus die BLS den gesamten Zugverkehr zwischen Gümligen Süd und Domodossola sowie auf der Rhonetallinie zwischen Brig und Siders steuern und optimieren kann, wurde versucht, mit betrieblichen Massnahmen die Probleme zu lösen. Gegen einen Vollausbau spricht auch, dass die mit einem Ausbau im Tunnel geschaffene Kapazität nur dann genutzt werden kann, wenn die Zulaufstrecken die zusätzliche Kapazität auch bewältigen können. Die Kapazität und Stabilität eines Bahnnetzes darf nicht nur lokal betrachtet, sondern muss in einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. Wie oben erwähnt ist das System heute austariert. Das heisst, dass in die Zulaufstrecken im Norden und im Süden mehrere Milliarden Franken investiert werden müssten, um Basis- und Scheiteltunnel auslasten zu können.
Schliesslich ist ein Vollausbau in nächster Zeit auch deshalb nicht vorgesehen, weil die Lötschberg-Simplon-Achse auch bei einem Doppelspurausbau nicht zu einer Flachbahn für den Güterverkehr wird. Die Südrampe des Simplontunnels weist grosse Steigungen auf, die entsprechende kostenintensive Traktionsleistungen erfordern. Es gibt somit – bei beschränkten finanziellen Mitteln – verschiedene Gründe gegen einen kurzfristigen Vollausbau der zweiten Röhre; längerfristig könnte dies aber anders sein.
Ausblick
Im Gesetzesprojekt zur zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB), das im laufenden Jahr im Parlament behandelt wird, sind aus Gründen der finanziellen Ressourcen nur die vordringlichsten Infrastrukturausbauten aufgenommen. Deshalb ist der Ausbau des Lötschberg-Basistunnels darin nicht enthalten. Bei einem weiteren Ausbauschritt des schweizerischen Eisenbahnnetzes gilt es, nachfragegerecht für die verschiedenen Zugsarten / -typen (Fernverkehr, Regionalverkehr, Güterverkehr, Unterhaltsverkehr) mit den unterschiedlichen Fahreigenschaften (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse usw.) marktgerechte Bahntrassees bereitzustellen und die damit verbundenen Infrastrukturen zu planen. Mittelfristig würde die Realisierung einer Erweiterungsoption zu ZEB, die jedoch nicht finanziert ist, eine weitere Verdichtung des Personenverkehrsangebots zwischen Bern und dem Wallis ermöglichen. Mit dieser Erweiterungsoption könnten zudem alle Güterzüge via Lötschberg- Basistunnel geführt werden. Dazu wäre es notwendig, den Rohbauabschnitt zwischen Ferden und Mitholz im Lötschberg-Basistunnel bahntechnisch auszurüsten. Die dafür erforderlichen Investitionen belaufen sich gemäss heutigen Schätzungen auf rund 460 Millionen Franken. Die Prüfung der Erweiterungsoptionen zu ZEB ist im Rahmen der Erarbeitung der Folgebotschaft zur Gesamtschau FinöV vorgesehen.
Fazit
Die Verkehrsnachfrage des neuen Lötschberg-Basistunnels ist nicht nur erfreulich, sondern übertrifft alle Erwartungen. Das neue Bauwerk und die bahntechnischen Installationen funktionieren zuverlässig und sicher. Bei den hohen Kosten von 4.3 Milliarden Franken (Preisstand 1998) eines solchen Werks muss dies so sein. Die weitere Entwicklung, d. h. der zweiröhrige Ausbau, ist damit eine Frage der Zeit, der finanziellen Möglichkeiten und des politischen Willens.
[Toni Eder, Vizedirektor Bundesamt für Verkehr]TEC21, Mo., 2008.05.19
Anmerkungen
[1] Bundesbeschluss über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale, Artikel 5 bis Buchstabe b (SR 742.104)
[2] Der Güterverkehr ist gemäss Bundesgerichtsentscheid, soweit dies mit den betrieblichen Anforderungen zu vereinbaren ist, über die Neubaustrecke zu leiten und darf in der Zeit von 22.00–06.00 Uhr nicht über die alte Strecke via Langenthal–Burgdorf geleitet werden
19. Mai 2008 Toni Eder
Tunnelsysteme testen
Der Lötschberg-Basistunnel als Einspurtunnel verfügt über geringere freie Querschnitte als vergleichbare Tunnelbauwerke, weshalb bislang wenige übertragbare Erfahrungen aus anderen Projekten vorliegen. Die Verifizierung der bislang nicht messtechnisch überprüften rohbaurelevanten Projektannahmen hat gezeigt, dass die Annahmen der Planungsgrundlagen richtig waren. Sie können als Vergleichswerte in anderen in zwei Einzelröhren geführten Bahntunnelprojekten in die Projektierung einfliessen und am erstellten Bauwerk überprüft werden.
Die Ingenieurgemeinschaft Lötschberg-Basistunnel (IG-LBT) als Projektierende des Rohbaus (siehe Bild 2 des vorhergehenden Beitrags) hatte von der BLS AlpTransit AG den Auftrag, die Projektannahmen für den Rohbau zu verifizieren, also die theoretischen Berechnungen, die den verschiedenen Gesamtsystemen zu Grunde liegen, in der Praxis zu überprüfen. Dazu wurde ein Versuchskonzept erarbeitet, das mit mehreren, grösstenteils unabhängigen Versuchen die getroffenen Projektannahmen und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Gesamtsysteme wie Bahntunnelsystem, Diensttunnelsystem, Entwässerungssystem und Lüftungssystem umsetzt. An unterschiedlichen Stellen im Bahntunnel sowie im Diensttunnel, den Querschlägen und -verbindungen (QS und QV) sowie in der näheren Peripherie des Bauwerks wurden hierfür Messstellen definiert.
Im Rahmen der Inbetriebsetzungsphase des LBT im Frühjahr 2007 wurden umfangreiche Testfahrten mit verschiedenen Zugtypen und Zuggeschwindigkeiten bis 280 km / h durchgeführt. Anhand des diversifizierten Rollmaterials war es möglich, unter betriebsnahen Verhältnissen die verschiedenen Gesamtsysteme (Entwässerungssystem, Aerodynamik etc.) und deren Wechselwirkungen durch Messungen am Bauwerk zu testen. Im LBT wurden hohe Anforderungen bezüglich Sicherheit und Hydraulik an das Entwässerungssystem (Trennsystem mit Tunnelabwasser- und Bergwassersystem) gestellt.
Funktionstüchtigkeit des Entwässerungssystems
Elemente des Tunnelabwassersystems tragen dazu bei, die Explosionssicherheit zu erhöhen und eine geeignete Ereignisbekämpfung zu ermöglichen. Bei der Projektdefinition wurden einerseits Vorgaben bezüglich des oberflächigen Abflussverhaltens bei einer Havarie mit flüssigem Gefahrgut definiert. Andererseits sind mit der Projektierung systematische Vorkehrungen, wie die Quersiphonierung, der Einbau von Retentionsschwellen auf der Fahrbahn und die Einspeisung eines Stetslaufs, getroffen worden. Die Quersiphonierung unterbindet den Luftaustausch zwischen der Tunnelatmosphäre und dem Tunnelabwassersystem. Bautechnisch wurde sie zwischen den Einlaufschächten und -rinnen in der Fahrbahn sowie den Kontrollschächten der Tunnelabwasserleitung realisiert. Die in einem Abstand von rund 84 m versetzten Retentionsschwellen verhindern eine gross-flächige Ausbreitung der Lachen bei einem Ereignis mit flüssigem Gefahrgut. Beim Stetslauf handelt es sich um Bergwasser, welches mit einem Volumenstrom von rund 5 l / s in die jeweilige Tunnelabwasserleitung eingespeist wird. Der Stetslauf erhöht die Explosionssicherheit durch das Verlöschen der Flammenfront und die Unterbindung der Explosion und garantiert zudem das Auftreten niedriger Druckwerte (rund 1 bar) im Fall von Explo sionsereignissen im Tunnelabwassersystem. Mit den Versuchen zum Entwässerungssystem galt es, Aussagen zum Abflussverhalten bei einem Havariefall mit flüssigem Gefahrgut und über die Abflusswirksamkeit des Stetslaufs zu formulieren sowie qualitative Aussagen zum Verhalten in den Schächten bei Zugsdurchfahrten zu dokumentieren.
Versuchsanordnung und -durchführung am Entwässerungssystem: Für die Simulation des Havariefalls sind zwei repräsentative Tunnelquerschnitte ausgewählt worden. Bei diesem Versuch wurde einerseits das oberflächige Abflussverhalten (Lachenausbreitung, Wasserstand zwischen den Retentionsschwellen) mittels Beobachtungen und einfachen manuellen Messungen registriert. Anderseits wurde das Abflussverhalten im Leitungssystem durch Messung der Abflusshöhe und des Volumenstroms mittels Venturidüsen und Niveaumessungen (Drucksonden, Echolote) ermittelt (Bild 2). Die Abflussdaten wurden bei jeder Messstelle mit einem autarken Datalogger aufgezeichnet. Der Havariefall – in den Projektvorgaben als zweiphasiger Prozess modelliert (1. Phase: Freisetzungsrate Q = 125 l /s während 10 Minuten; 2. Phase: Freisetzungsrate Q = 25 / s während 110 Minuten) – erforderte die Bereitstellung von 240 m³ Wasser. Die Bereitstellung des Gesamtvolumens bedingte eine aus zwei Lösch- und Rettungszügen sowie fünf zusätzlichen Kesselwagen bestehende Zugskomposition. Die Simulation des Havariefalls wurde während jeweils eines Tages bei jeder Versuchsstelle durchgeführt (Bilder 1 und 3). Die Verifikation des Stetslaufs erforderte die Erfassung des Volumenstroms jeweils bei den Einspeisungs- und Austrittstellen aus dem Tunnel. Für die Ermittlung des Volumenstroms wurden ebenfalls Durchflussmessstellen (Venturidüsen und Drucksonden) mit autarken Dataloggern installiert. Um das Abflussverhalten im Tunnelabwassersystem während Zugdurchfahrten zu registrieren, wurden im Abstand von rund 2 km Niveaumessungen (Drucksonden) in den Kontrollschächten eingebaut. Mit diesem Versuchsaufbau konnten Aussagen über die Füllstände der Siphons sowie über allfällige durch Zugdurchfahrten implizierte Wellenbewegungen formuliert werden. Die für den Versuch installierten Datalogger registrierten Daten über mehrere Tage und ermöglichten eine für die Inbetriebsetzungsphase repräsentative Auswertung.
Resultate der hydraulischen Messungen und Vergleich mit den Projektannahmen: Die Simulation des Havariefalls im Basistunnel hat ergeben, dass Differenzen zu den Vorgaben und zu den im Rahmen des Detailprojektes «Entwässerungskonzept» erstellten numerischen Simulationen der EPFL vorliegen. Dies ist v. a. auf Abweichungen bei den Modellannahmen von der Realität zurückzuführen (z. B. kann durch Undichtheiten der Retentions schwellen das zur Verfügung stehende Retentionsvolumen nicht vollständig ausgeschöpft werden). Die hydraulischen Prozesse (Verweildauer bei der Retention und Ableitung) sind in Wirklichkeit tendenziell günstiger als bei den theoretischen Betrachtungen. Unter Einbezug der sicherheitsrelevanten Aspekte gilt es, die Ereigniskräfte für die realen Verhältnisse zu sensibilisieren. eim zweiten Versuch haben die Beobachtungen während rund fünf Tagen aufgezeigt, dass der Stetslauf grundsätzlich in sämtlichen Tunnelabwasserleitungen abflusswirksam ist. Die durch die Zugdurchfahrten hervorgerufenen Druckschwankungen im Bahntunnel wiesen geringfügige Auswirkungen auf die Wasserspiegellage in den Kontrollschächten auf. Die kurzzeitige Veränderung der Wasserspiegellage hat jedoch keinen Einfluss auf die für die Sicherheit erforderliche Quersiphonierung. Des Weiteren konnten teilweise geringe Wellenbewegungen vermutet werden (Bild 5). Es kann davon ausgegangen werden, dass der Einfluss von Zugdurchfahrten die Siphonierung im Allgemeinen nicht massgeblich beeinträchtigen wird. Zudem gewährleistet der Stetslauf – neben der Erhöhung der Explosionssicherheit – eine stetige Nachfüllung der Siphons in den Tunnelabwasserschächten.
Beurteilung und Empfehlung: Im Allgemeinen haben die Versuche aufgezeigt, dass das Entwässerungssystem funktional den Anforderungen entspricht. Um die Resultate, beispielsweise der Auswirkungen von Druckschwankungen im Bahntunnel auf das Entwässerungssystem, zu erhärten, sind Versuche bei Zugfahrten während des Betriebszustandes anzustreben.
Drainage-Belüftung bei Erdgasvorkommen
Die im Verlaufe mehrerer Jahre im LBT durchgeführten Erdgasmessungen belegen, dass eine geringe, in einzelnen Tunnelabschnitten mässige Ausgasung des Gebirges vorliegt. Diese Ausgasung tritt nur in wenig belüfteten Bergwasserdrainageleitungen, in Bohrlöchern oder in abgeschlossenen, unbelüfteten Räumen auf. Im freien Querschnitt konnte bei der herrschenden Luftzirkulation nie Gas festgestellt werden. Mit Ausnahme bei Querverbindung Nr. 19 konnten zudem in der Bergwasserentwässerung nirgends und zu keinem Zeitpunkt (Methan-) Gaskonzentrationen festgestellt werden, die im Bereich eines Alarm- oder gar eines Explosionswertes liegen.
Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Bergwasserdrainage bei Querverbindung Nr. 19 mittels der Druckdifferenz zwischen Dienststollen und Bahntunnel zu belüften. Basierend auf Machbarkeitsuntersuchungen sowie auf Messungen in einer Versuchsstrecke wurden Vorgaben zur Umsetzung dieser Erdgasbelüftung festgelegt.
Versuchsanordnung und -durchführung bei den Gasmessungen: Die Messkampagnen des Gasexperten zeigten, dass die gemessene Erdgaskonzentration wesentlich von den herrschenden, zum Teil meteorologisch bedingten Druckverhältnissen im Tunnel abhängt und grossen Schwankungen unterworfen ist. Unter dieser Voraussetzung kann die Funktionalität der Erdgasbelüftung nicht abschliessend mittels Erdgasmessungen nachgewiesen werden. Der Nachweis kann hingegen mittels Überprüfung des auftretenden Luftaustauschs (Strömungsgeschwindigkeit) im Entwässerungssystem erfolgen.
Hierauf basierend wurden 2 Messszenarien, eines ohne Bahnbetrieb während zukünftiger Betriebsphasen ohne Zugverkehr (Nacht, Erhaltung etc.) und eines mit Bahnbetrieb während Betriebsphasen mit Zugverkehr, definiert. Die im Laufe der Messkampagne erfassten Messorte in der Bergwasserdrainage bei Querverbindung Nr. 19 sind in Bild 7 dargestellt.
Resultate der Gasmessungen und Vergleich mit den Projektannahmen: In den betrachteten Bereichen der Bergwasserentwässerung wurde ein ausreichender Luftwechsel mit Strömungsgeschwindigkeiten zwischen ca. 0.3 m / s und 3.8 m / s gemessen (Bilder 4 und 6). Ohne Bahnbetrieb bestand eine starke Abhängigkeit des Luftwechsels in der Bergwasserentwässerung von der lüftungsbedingten Druckdifferenz zwischen Dienststollen und Bahntunnel. Mit Bahnbetrieb dominieren die zugbedingten Druckschwankungen den Luftaustausch in der Bergwasserdrainage (Bild 8). Eine diesbezügliche Beeinträchtigung der Erdgasbelüftung konnte aber nicht festgestellt werden. Aufgrund der Erdgasbelüftung wurden nur in einzelnen Entwässerungsschächten und zudem unkritische Methankonzentrationen erfasst.
Beurteilung und Empfehlung: Anhand der Messungen konnte die ausgelegte Funktionalität der Erdgasbelüftung des LBT nachgewiesen werden.
Im Zusammenhang mit allfälligen künftigen wirtschaftlichen Optimierungen der Betriebslüftung muss auch die Erdgasbelüftung auf einen ausreichenden Luftaustausch in der Bergwasserentwässerung bei reduzierter Druckdifferenz zwischen Dienststollensystem und Bahntunnel überprüft werden.
Druckschwankungen im Tunnel
Zugbedingte Druckschwankungen in Bahntunnels entstehen insbesondere während der Zugein- und -ausfahrt in oder aus dem Tunnel, der Zugdurchfahrt durch Querschnittsänderungen (z. B. bei Spurwechseln) und der unmittelbaren Zugvorbeifahrten. Sie breiten sich entlang der Bahntunnelröhren aus und können über Öffnungen wie Spalte, Lüftungsöffnungen, offene Klappen etc. in benachbarte Hohlräume übertragen werden. Als Hohlräume gelten z. B. Querschläge, Kavernen, Zugangsstollen, Schränke, Entwässerungsrohre, Kabelkanäle und -schächte. Dabei wirken Kräfte auf die Wandungen oder Abschlüsse (beispielsweise Querschlagtüren, Schaltschränke) ein. Im Bahntunnel befindet sich der Oberflächen-Kabelkanal (OKK). Durch zugbedingte Druckschwankungen treten kurzzeitig Kräfte auf die Abdeck platten des OKK auf. Da die Abdeckplatten des OKK lose aufgelegt sind, stellt sich die Frage, ob zugbedingte Druckschwankungen zu einem Abheben der Schachtdeckel führen können. Öffnungen zwischen den OKK-Deckeln (Spalte) sowie regelmässige grössere Aussparungen zwischen dem OKK und dem Bahntunnel bewirken einen Druckausgleich. Dadurch wird verhindert, dass aufgrund von Druckunterschieden zwischen dem Kabelkanal und der Bahntunnelröhre die OKK-Deckel abheben und den Zugverkehr gefährden.
Versuchsanordnung und -durchführung zur Messung zugbedingter Druckschwankungen: An drei Orten im LBT erfolgten Messungen zugbedingter Druckschwankungen sowie der resultierenden Auswirkungen auf OKK-Abschlüsse (Bilder 9 und 10).
Resultate der Luftdruckmessungen und Vergleich mit den Projektannahmen: An den drei Messorten im Tunnel bleiben die maximalen Druckschwankungen bezogen auf den Normaldruck in Tunnel / QV / QS für den Extremfall eines Höchstgeschwindigkeitszuges (vZug ≈ 280 km / h) unterhalb der Projektannahmen. Als Beispiel werden in Bild 11 die gemessenen Druckabweichungen vom Normaldruck für den Bahntunnel bei QV 46 sowie für den angrenzenden Querschlag dargestellt. Im ausgewählten Zeitintervall von ca. 12 h erfolgten Messfahrten mit bis zu 280 km / h. Die Druckänderungen in der Bahntunnelröhre werden nur gedämpft über die Lüftungsöffnungen übertragen. Der extreme Druckabfall (von Pos 1: ca. 1.5 kPa, zu Pos 2: ca. –2.5 kPa) aufgrund der unmittelbaren Zugvorbeifahrt beträgt in der Bahntunnelröhre ca. Δp = 4 kPa, während die maximalen Druckschwankungen im Querschlag | pmax | = 2.5 kPa betragen. Die Druckänderungen im QS 46 betragen im ungünstigsten Fall dagegen nur ca. Δp = 0.8 kPa (rote Linie), die Messung erfolgte im QS in der Nähe des QS-Abschlusses. Druckschwankungen werden über die Lüftungsöffnung nicht nur in ihrer Amplitude gedämpft, sondern auch in ihrem zeitlichen Verlauf beeinflusst. Daraus ergeben sich Druckdifferenzen über den QS-Abschluss von maximal Δpmax = /–2.8 kPa.
Für gemischten Zugverkehr (Personen-, Güter- und weitere Testzüge) sind die zugbedingten Druckschwankungen sowie die resultierenden Auslenkungen der OKK-Deckel für einen Messzeitraum von 20 Tagen in Bild 12 dargestellt. Während des Messzeitraumes sind die Auslenkungen der OKK-Deckel aufgrund zugbedingter Druckschwankungen in der Grössenordnung von ca. 5 mm, was auf die Lagefestigkeit der betrachteten OKK-Deckel zurückzuführen ist. Diese liegen lose auf und neigen aufgrund geringer Unebenheiten zu Auslenkungen um die Ruhelage (kippeln). Grössere Auslenkungen oder einseitiges Abheben der Schachtdeckel wurden für keinen der Messorte festgestellt.
Beurteilung und Empfehlung: Für die vorliegende Betriebsphase liegen die maximal auftretenden Druckabweichungen vom Normaldruck in Tunnel, QV und QS innerhalb der Projektannahmen.
Die untersuchten Vorgaben an den Rohbau konnten durch Messungen bestätigt werden. Treten keine Abweichungen vom Grundlagendossier auf, so sind die Beanspruchungen von Einbauten aufgrund zugbedingter Drucklasten unproblematisch. Bei zukünftigen Abweichungen von den Projektgrundlagen (beispielsweise durch verändertes Rollmaterial) ist eine erneute messtechnische Verifizierung der Projektannahmen zu prüfen.
[Christoph Schlotter, dipl. Bauing. FH, Projektleiter Versuchsprogramm, IG LBT, p. A. Emch Berger AG Bern
Andreas Busslinger, Dr. sc.nat., dipl. Naturwissenschafter ETH, Versuchsleiter Funktionstüchtigkeit Drainage-Belüftung in Bereichen mit Erdgasvorkommen, IG-LBT, p. A. HBI Haerter AG Bern
Bernd Hagenah, Dr.-Ing., Dipl.-Physiker, Wirtschaftsingenieur (FH) / SIA, Versuchsleiter zur Bestimmung der Druckschwankungen im Tunnel, IG-LBT, p. A. HBI Haerter AG Bern
Roger Kolb, dipl. Bauing. FH / NDS FH BWL / UF, Versuchsleiter Funktionstüchtigkeit Entwässerungssystem, IG-LBT, p. A. Emch Berger AG Bern
Urs Stoller, Leiter Projektierung, BLS AlpTransit AG]TEC21, Mo., 2008.05.19
19. Mai 2008 Christoph Schlotter, Andreas Busslinger, Bernd Hagenah, Roger Kolb, Urs Stoller