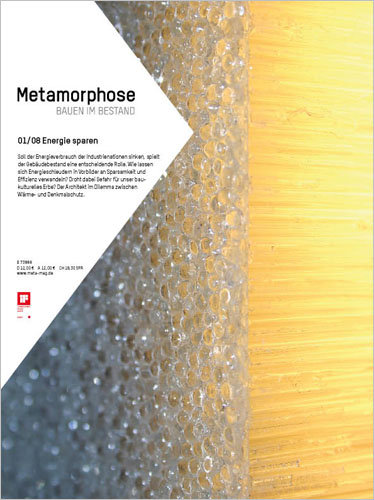Editorial
Fokus Energie sparen
„Lassen Sie mich noch einmal darauf hinweisen, dass die Halbierung allein des Energieverbrauchs von Gebäuden den globalen Energiekonsum um ein Viertel reduzieren würde.“ (Sir Richard Rogers, 1995)[1]
Die Grundlagen für ein Nachfolgemodell des Kioto-Protokolls waren es, die 187 Länder auf der Klimaschutzkonferenz auf Bali im Dezember erarbeiten wollten. Deutschland zeigte sich dabei als Vorreiter und beschloss schon jetzt konkrete Ziele für die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020. Welche Auswirkungen hat dies auf die Baubranche und vor allem auf die Sanierung bestehender Gebäude?
Nur noch bis 2012 sind die im Kioto-Protokoll erzielten Übereinkünfte für die beteiligten Länder gültig. Angesichts der spürbaren Auswirkungen von Erderwärmung und Klimawandel stehen die Grundlagen für ein neues, schärferes Abkommen, das auf der Klimaschutzkonferenz in Kopenhagen 2009 erzielt werden soll, schon jetzt zur Debatte. Um mehr als 50 Prozent müssen die Länder ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 reduzieren, wenn die Erderwärmung auf rund zwei Grad begrenzt werden soll – so eine Untersuchung des Weltklimarats.
Zeitgleich zur Konferenz in Bali setzte die Bundesregierung mit dem Beschluss eines umfangreichen Pakets zur Energie- und Klimapolitik (IEKP) ein deutliches Zeichen. Mit den neuen Regelungen sollen die Investitionen von Energiewirtschaft, Industrie und Verbrauchern so gesteuert werden, dass bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent unter den Stand von 1990 sinken. Zudem soll das Programm Impulse für die Entwicklung neuer Technologien im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz geben.
Betroffen ist von diesen Regelungen auch die Architektur. Mit 40 Prozent haben Gebäude den größten Anteil am Energieverbrauch und damit auch am Kohlendioxidausstoß. Sie tragen entscheidend zum Klimawandel bei. Ins Gewicht fallen hier in erster Linie die Wohnbauten, die in Deutschland den Großteil des Gebäudebestandes ausmachen. 75 Prozent ihres Energieverbrauchs entfallen auf die Erzeugung der Raumwärme. Die Regelungen setzen also genau hier an und stellen höhere Anforderungen an die Energieeffizienz von Neu- aber auch Bestandsbauten.
Neubauten, die nach dem 31. Dezember 2008 fertig gestellt werden, müssen demnach einen bestimmten Anteil der von ihnen benötigten Wärme mit der Hilfe regenerativer Energien bestreiten, und auch bei Bestandsgebäuden soll die Nutzung von erneuerbaren Energien gefördert werden. Verständlich, schließlich haben Sanierung und Umbau von bestehenden Gebäuden in Deutschland in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, während die Zahl der Neubauten deutlich zurückgegangen ist. Wenn wir die Treibhausgasemissionen reduzieren und damit die Auswirkungen des Klimawandels bremsen wollen, dann müssen wir uns also vor allem darum bemühen, den Energieverbrauch von Bestandsgebäuden herunterzuschrauben. Um den Bewohnern Anreize zu einer energetischen Sanierung zu geben, will die Bundesregierung die zur Verfügung gestellten Fördergelder bereits im diesem Jahr mehr als verdoppeln und bis 2009 auf 500 Millionen Euro anwachsen lassen. Zusätzlich sollen die Anforderungen der EnEV im Laufe der nächsten Jahre deutlich verschärft werden.
Um die Bestandsgebäude in ihrem Energieverbrauch zu drosseln, sind jedoch oft weitreichende Veränderungen der Bausubstanz nötig. Wie können Architekten und Planer diese Eingriffe verträglich in den Altbau integrieren? Und welche konstruktiven und gestalterischen Lösungen bieten sich für diese neue Aufgabe an? Diese Ausgabe der Metamorphose zeigt, wie sich architektonische Qualität bewahren und dennoch Energie sparen lässt.
Anmerkung:
[1] Rogers, Richard: „Nachhaltige Architektur. Dritte Vorlesung“. In: arch+, 127 (1995), S. 47
Inhalt
Bestandsaufnahme
06-11 | Projekte, Bücher, Termine
14-15 | Energie sparen
16-17 | Freude am Sparen: Energiebewusstes Bauen - nur lästige Pflicht?
18-19 | Denken statt Dämmen: Zerstört das Energiesparfieber unseren Baubestand?
20-27 | 01 Frischzellenkur: Umbau der Landwirtschaftskammer Münster
28-29 | 02 Innere Werte: Niedrigenergiehaus in Alsdorf
30-35 | 03 Blau statt Grau: Verwaltungs- und Betriebsgebäude der Remscheider Entsorgungswerke
36-39 | 04 Vorbildlich verpackt: Umbau eines ehemaligen Postgebäudes in Bozen
40-45 | 05 Schaustück hinter Backsteinzinnen: Hörsaal- und Laborgebäude der Technischen Fachhochschule Wildau
Technik
46-51 | 90 Prozent Energiesparen: Erfahrungen aus der Sanierungspraxis
52-53 | Mitten ins Zentrum: Umbau eines Wohnblocks in Neu-Ulm - Ergebnisse eines Modellvorhabens
54-61 | Mit Kompetenz und Sorgfalt: Chancen und Risiken der Innendämmung
Produkte
62-63 | Vakuumisolationspaneele
64-65 | Wärmeschutzverglasung/-fenster
66-67 | Neuheiten
Ausbildung
68-69 | Aufbaustudium in Weimar
70-71 | DLE 50 Professional Architektur-Förderpreis
Rubriken
74 | Vorschau, Impressum, Bildnachweis
Freude am Sparen
(SUBTITLE) Energiebewusstes Bauen – nur lästige Pflicht?
Wann endlich erkennen Architekten die ungeheuren Chancen, die in der Energiespar-Thematik stecken? Sie erschließt nicht nur neue Geschäftsfelder, sondern sorgt auch dafür, dass baulich-architektonische Fragen wieder in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit rücken. Und sie kann einer neuen regionaltypischen Architektur den Weg ebnen.
Alle Welt redet vom Energiesparen, nur eine Gruppe hält sich vornehm zurück: Architekten. Dabei sitzen sie an den Schalthebeln, mit denen sich der Gesamtverbrauch deutlich verringern ließe. Rund 40 Prozent der Endenergie entfallen auf Gebäude. Die Planungsentscheidungen eines Architekten haben also nicht unwesentlichen Einfluss darauf, ob wir es schaffen, die ehrgeizigen Ziele zur Reduktion des Treibhauseffekts zu erreichen.
Gewaltige Förderprogramme unterstützen bauliche Maßnahmen zum Energiesparen, vor allem in den Bestand fließen erhebliche Summen. Hier tut sich ein ganz neues Betätigungsfeld für Architekten auf, es öffnet sich eine Tür für eine Berufsgruppe, die zuletzt nicht unbedingt unter einem Übermaß an Planungsaufträgen litt. Und ihre Kompetenz wird dringend benötigt, denn die durchschnittliche energetische Modernisierung – meist ohne Architekt durchgeführt – ist eher selten mit Gestaltverbesserungen verbunden (siehe Seite 18,19). Anspruchsvolle Lösungen, die bauhistorische, gestalterische und energetische Anforderungen gleichermaßen erfüllen, muss man suchen wie die Nadel im Heuhaufen. Es gibt noch viel zu tun.
Existenz sichern
Zugleich erlegt die Energiefrage dem Architekten jedoch eine neue gesamtgesellschaftliche Verantwortung auf. Sie ist nicht irgendeine, sondern vermutlich die entscheidende Herausforderung der Zukunft, sowohl aus Klimaschutzgründen, als auch, weil der Energiehunger immer schwerer zu stillen sein wird. Öl und Gas sind endliche Energiequellen und werden uns in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen. Schon jetzt treibt das Zusammenspiel von sinkendem Angebot und steigender Nachfrage durch die Schwellenländer den Preis in die Höhe. Für den Zeitpunkt, an dem die weltweiten Vorräte knapp werden, sagen pessimistische Stimmen gar einen Krieg um Öl voraus, ein Gemetzel um die letzten Reserven an fossilen Brennstoffen. Mag dieses Schreckensszenario gegenwärtig auch übertrieben erscheinen, so kann es nicht schaden, den Verbrauch rechtzeitig zu senken und sich ein Stück weit unabhängiger zu machen. Energieeffiziente Gebäude können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Plötzlich geht es beim Bauen und Modernisieren um Existenzielles.
Bedenkt man, dass der Primärenergiebedarf Deutschlands zu 95 Prozent von fossilen Energieträgern gedeckt wird, und dass drei Viertel davon importiert werden müssen, so wird deutlich, dass sparsame Architektur auch helfen kann, unsere Abhängigkeit von jenen Staaten zu reduzieren, in denen nicht immer ganz lupenrein demokratische Verhältnisse herrschen. Salopp gesagt: Wer in einem Passivhaus wohnt, das kaum noch Heizenergie verbraucht, kann sich entspannt zurücklehnen, wenn Russland der Ukraine wieder einmal den Gashahn zudreht. Bauen erhält eine politische Komponente.
Und zu guter Letzt wird bei der energetischen Sanierung Geld für Arbeit und Ingenieurskunst im Inland, statt für Brennstoff-Importe aus dem Ausland ausgegeben. Bauen bekommt eine stärkere volkswirtschaftliche Bedeutung.
Es geht wieder um die großen Fragen in der Architektur. Die Arbeit des Architekten erhält eine Relevanz für die Allgemeinheit wie lange nicht mehr. Zuletzt hatte sie diese Bedeutung vielleicht in der Nachkriegszeit, als es darum ging, die zerbombten Städte wieder aufzubauen und Antworten auf die Frage zu geben, wie mit knappen Mitteln ausreichend Wohnraum geschaffen werden kann. Heute geht es darum, wie mit knappen Energiereserven umzugehen und der Klimawandel aufzuhalten ist. In diesem Kontext bietet sich die Chance, architektonische Debatten in die Öffentlichkeit zu tragen und damit mehr Menschen zu erreichen als bisher. Und vielleicht gelingt es, sie dabei auch für die ästhetischen und kulturellen Aspekte des Bauens zu interessieren, die bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Gebäuden immer dazugehören, bislang aber außerhalb der Fachszene kaum Beachtung fanden.
An den Ort binden
Ein solcher Aspekt könnte die Frage sein, welche Auswirkungen das Energiesparen auf die Gestalt der Gebäude haben wird. Den Internationalen Stil und seine heutigen, späten Nachzügler müssen wir endgültig zu den Akten legen. Denn er entwickelte sich, als Energie im Überfluss vorhanden war. Die riesigen Glasflächen eines Seagram Building oder eines Farnsworth House, eine Architektur, die sich in solchem Ausmaß von den Gegebenheiten des Orts löste, wären vorher undenkbar gewesen. Jahrtausendelang bedeutete Bauen, sparsam mit Energie umzugehen, weil sie ein kostbares Gut war. Die Zeitspanne, in der wir uns keine Sorgen um die Energieversorgung machen mussten, neigt sich zu Ende und dürfte nur ein kurzes Kapitel in der Menschheitsgeschichte gewesen sein.
Energiebewusst Bauen heißt klimagerecht Bauen, und das Klima wechselt von Region zu Region. Die Architektur wird wieder stärker auf den Ort eingehen. In milden, sonnigen Gegenden wird man etwa bemüht sein, Solarenergie aktiv und passiv zu nutzen, die Gebäude können großzügig nach Süden verglast sein, und auf den Dächern lohnt es sich, Kollektoren zu installieren – Maßnahmen, die in kühlen, nebligen Gegenden mit geringerer Sonnenscheindauer weniger sinnvoll sind. Es dürfte ein neuer Regionalismus auf technisch höherem Niveau entstehen, ein Regionalismus 2.0, nicht aus Heimatschutz-, sondern aus Wärmeschutzgründen.
Nicht nur beim Neubau, auch beim Bauen im Bestand bietet die Energiefrage die Chance, Bauwerke besser zu verorten. Findet man etwa ein konventionelles Wohngebäude vor, dessen Öffnungen nach allen Himmelsrichtungen gleich gestaltet sind, so besteht die Möglichkeit, sie bei einem Umbau zu differenzieren und die Südfenster größer auszubilden. Ein Bau, der vorher möglicherweise beziehungslos auf dem Grundstück „schwamm“, wird auf diese Weise „festgezurrt“, steht in Beziehung zur Sonne, bietet Orientierung.
Neue Aufgaben angehen
Es gibt also viele Gründe, die momentan häufig noch etwas stiefmütterliche Behandlung der Energiesparthematik in der Architektur aufzugeben. Wem es als Motivation nicht ausreicht, am großen Ziel Klimaschutz mitzubauen, wird sich vielleicht für die Auseinandersetzung mit Energiefragen erwärmen können, wenn er die Aussicht hat, Formentscheidungen künftig energetisch begründen zu können und damit schlagkräftige Argumente für seine – nicht zuletzt auch gestalterisch motivierten – Konzepte in der Hand zu haben.Metamorphose, Mo., 2008.01.07
07. Januar 2008 Christian Schönwetter
Denken statt Dämmen
(SUBTITLE) Zerstört das Energiesparfieber unseren Baubestand?
Dass die Modernisierung bestehender Bauten entscheidend dazu beiträgt, die ehrgeizigen deutschen Energiesparziele zu erreichen, steht außer Frage. Doch ganze Stadtbilder drohen derzeit einem unreflektierten Dämmwahn zum Opfer zu fallen.
Sparen, bis es quietscht. So muss man die Dämmwelle bezeichnen, die seit einiger Zeit unsere Städte überzieht. Ganze Siedlungen verschwinden hinter dicken Styroporpaketen, die den Energieverbrauch der Gebäude senken sollen. Nichts gegen das Energiesparen, aber ist es wirklich nötig, jeden freien Quadratmeter Fassadenfläche zu dämmen? Beim verputzten Teil des Gebäudebestands spricht in der Regel nicht viel dagegen, gerade bei Backsteinbauten jedoch geht die Patina, die lebendige Struktur, die handwerkliche Individualität der Fassade verloren. Entweder verschwindet sie hinter Wärmedämmverbundsystemen oder hinter neuen, industriell gefertigten und damit gleichförmigen Vormauerungen. Im günstigsten Fall versucht man sie nach dem Foto des Originals als dünne Oberflächenschicht nachzubilden – eine hohle Geste.
Mag dies bei Einzelgebäuden noch verschmerzbar sein, so wächst sich die Dämmwelle im urbanen Maßstab zum ernsthaften Problem aus. Die Backsteinstädte Norddeutschlands drohen in Thermohaut zu ersticken, das typische Stadtbild, das sich dort wesentlich über die Materialität der Fassaden definiert,bleibt auf der Strecke: ein breiter Identitätsverlust. Die Spitzenorganisationen des Denkmalschutzes wehren sich deshalb gegen den Energiepass für Baudenkmäler. Sie schlagen stattdessen eine Energieberatung vor, die auf den jeweiligen Einzelfall individuell eingehen kann. Denn auch sie befürchten, dass sonst „das Erscheinungsbild und/oder die Substanz von Baudenkmälern durch ungeeignete und unsachgemäße Wärmedämmmaßnahmen gefährdet werden“.(1) Doch Denkmäler stellen nur einen Anteil von ungefähr fünf Prozent des gesamten Gebäudebestandes. Die wirkliche Gefahr für das Stadtbild geht von der Modernisierung der übrigen 95 Prozent aus. Während Energiesparen im Bestand sowohl gesetzlich geregelt ist als auch durch staatliche Finanzspritzen gezielt gefördert wird, gilt für Gestaltanforderungen weder das eine noch das andere. Es bleibt dem Wohlwollen des Bauherrn überlassen, ob er stadtbildverträglich modernisiert oder nicht.
Genau hinschauen
Es zeichnet sich also ein Konflikt zwischen den Wächtern über das Klima und den Wächtern über die Baukultur ab. Die Klimafraktion betont dabei gerne, dass eine Reduktion des Treibhauseffekts nun einmal wichtiger sei als sentimentales Festhalten an der Originalanmutung alter Gebäude. Allerdings greift dieses Argument zu kurz. Denn schwer nachvollziehbar wird die Dämmwut an den Fassaden, wirft man einen genaueren Blick auf deren tatsächliches Energiesparpotenzial. Bei Modellvorhaben wurde der Verbrauch städtischer Mehrfamilienhäuser detailliert untersucht. Die Wohnungen im Erdgeschoss verbrauchten etwa doppelt, diejenigen im obersten Geschoss rund dreimal soviel Energie wie die in den mittleren Etagen (siehe auch Seite 52, 53). Die Verluste über die Außenwände machen also nur einen Bruchteil dessen aus, was über Kellerdecke und Dach verloren geht. Werden letztere ausreichend gedämmt, so kann man bei größeren Bestandsbauten mit anspruchsvoll gestalteter Fassade getrost auf eine außenliegende Dämmschicht verzichten und – falls überhaupt nötig – eine Innendämmung einbauen. Die erreicht zwar nicht die gleiche, aber eine immer noch ausreichende Wirkung.
Warum packt man so oft die Styroporkeule aus, ohne erst einmal darüber nachzudenken, wo sie sinnnvoll eingesetzt werden kann und wo nicht? Der Wohnungsbau der Gründerzeit etwa kann mit überraschend günstigen Verbrauchswerten aufwarten. Denn durch seine kompakten Gebäudeformen weist er ein hervorragendes A/V-Verhältnis auf. Bei einer geschlossenen Blockrandbebauung haben die Wohnungen der mittleren Geschosse kaum Wärmeverlustflächen. Boden, Decke und Seitenwände weisen zu benachbarten, beheizten Wohnungen, lediglich Straßen- und Hofseite verlieren Wärme an die Außenluft, aber eben deutlich weniger als gemeinhin angenommen. Gerade gründerzeitliche Fassaden dämmen nicht schlecht – dank ihrer üppigen Wandstärken. Allein mit neuen Fenstern und einer modernen Heizungsanlage lässt sich der Primärenergiebedarf einer solchen Mittelwohnung auf etwa 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr reduzieren. Das ist nur noch halb so viel, wie eine durchschnittliche Bestandswohnung verbraucht (ungefähr 250 Kilowattstunden) und entspricht immerhin dem Standard der Wärmeschutzverordnung von 1995, die wohlgemerkt für Neubauten formuliert wurde. Der reiche Fassadenschmuck solcher gründerzeitlicher Bauten sollte es verbieten, dort ein Wärmedämmverbundsystem einzusetzen, solange Dachboden und Kellerdecke, meist weniger ambitioniert gestaltet, geradezu nach einem dicken Dämmpaket schreien.
Verhältnisse verschoben
Während wir an der Fassade mit großem Aufwand um jede eingesparte Kilowattstunde ringen, verschließen wir die Augen vor anderen Energiefressern, derer man viel leichter Herr werden könnte: Seit Jahren ist bekannt, dass sich in Deutschland bei konsequentem Verzicht auf Stand-by-Schaltungen zwei Atomkraftwerke abschalten ließen. Ersatzlos. Elf Prozent des bundesweiten Stromverbrauchs gehen laut Bundesumweltamt auf das Konto von Leerlaufverlusten, 20 Milliarden Kilowattstunden im Jahr ließen sich sparen. Die ganze Absurdität des Dämmwahns wird deutlich, wenn man diese Zahlen einmal in Relation zum Energieverbrauch der oben beschriebenen Gründerzeitwohnung auf einer mittleren Etage setzt. Bei einer typischen Größe von 75 Quadratmetern verbraucht diese Wohnung gerade einmal 9.750 Kilowattstunden im Jahr. Mit der Energie, die wir bundesweit im Stand-by-Betrieb verpulvern, ließen sich über zwei Millionen solcher Wohnungen heizen. Zwei Millionen! Angesichts dieser Größenordnungen muss die Frage erlaubt sein, warum es nicht längst ein Gesetz gibt, dass den Stand-by-Betrieb bei neuen Geräten verbietet. Damit ließen sich mit geringstem Aufwand größte Einsparungen erzielen. Ohne schädliche Nebenwirkungen für Stadtbild und Baukultur.
(1) Architektenblatt 12/07, Seite 38Metamorphose, Mo., 2008.01.07
07. Januar 2008 Christian Schönwetter
Innere Werte
(SUBTITLE) Niedrigenergiehaus in Alsdorf
Ein historisches Gebäude in ein Niedrigenergiehaus zu verwandeln, ohne sein Erscheinungsbild komplett zu verändern, ist im rheinländischen Alsdorf gelungen. Rüdiger Lange schonte die Ziegelfassade an der Straße. Seine subtile Gestaltung leistet einen Beitrag zur Ortsbildpflege.
Ein altes Haus umzubauen, ohne auf Ensembleschutz oder denkmalpflegerische Belange Rücksicht nehmen zu müssen, verführt in der Regel zu einer konsequent sichtbaren Durchmischung alter und neuer Bauelemente. Nicht so bei der Straßenfassade einer Doppelhaushälfte in Alsdorf bei Aachen, 1910 als Teil einer durchgängigen Wohnzeile errichtet. Der Fassade ist auf den ersten Blick keine Veränderung anzumerken. Lediglich die hellgrau gestrichenen Holzfensterrahmen, der farblich passende Sockel und die offensichtlich nicht aus dem Baumarkt stammende Eingangstür lassen dort auf eine anspruchsvolle Modernisierung schließen. Der Architekt Rüdiger Lange, gleichzeitig sein eigener Bauherr, hat sich bewusst und aus freien Stücken dafür entschieden, die Authentizität der bescheidenen, zweigeschossigen Straßenflucht zu erhalten. „Niemand würde es wagen, hier aus der Reihe zu tanzen.“ Dieses Bekenntnis zum Erhalt alter, dörflicher Bausubstanz war allerdings nur durch den Einbau einer Innendämmung zu realisieren.
Jeder Architekt kennt die Problematik: So wie ein Flachdach selten ganz dicht zu bekommen ist, lässt sich auch bei der Innendämmung eindringende Feuchtigkeit nie gänzlich ausschließen. Um die mögliche Kondenswasserbildung in Schach zu halten, ist die Wahl der richtigen Folie (als Dampfsperre oder -bremse) entscheidend. Rüdiger Lange hat ein atmungsaktives Fabrikat auf dem Markt entdeckt, das mittels einer Umkehr des Dampfdiffusionswiderstandes im Sommer die völlige Austrocknung der Dämmung verspricht, im Winter dagegen verhindert, dass Feuchte aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt.
Von einem nicht ganz geringen Verlust des Raumvolumens einmal abgesehen – immerhin beträgt der Aufbau der Vorsatzschale aus Ständerwerk, Mineralwolle und haustechnischen Leitungen 13,5 Zentimeter – brachte die Innendämmung dem Bauherren über den Erhalt der Fassade hinaus noch weitere Vorteile. Da der kleinteilige Grundriss und die maroden Bauteile im Inneren, einschließlich der Dachkonstruktion, eine Entkernung ohnehin unumgänglich machten, erlaubte dieser Neuanfang eine sorgfältige, weil durchgängige Dämmung, die selbst von den Holzbalkendecken kaum unterbrochen wird: Auch der Raum zwischen den Balken des Gründerzeithauses erhielt eine Dämmung, so dass sich Kältebrücken weitgehend vermeiden ließen.
Um für seine vierköpfige Familie im Erdgeschoss auf der nahezu quadratischen Grundfläche von knapp acht mal acht Metern genügend Raum zu schaffen, ließ der Architekt nur zwei Teilstücke der alten Mittelwand stehen. Kochen und Wohnen gehen nun fließend ineinander über, mit direktem Zugang ins Freie. Die alte Holztreppe zum Obergeschoss wurde gründlich aufgearbeitet und führt zu den beiden Kinderzimmern mit eigenem Bad. Die Eltern haben sich ihr Reich unter dem neuen Dach eingerichtet. Eine große Gaube mit bodentiefen Fenstern bringt heute viel Helligkeit in den einst nur als Abstellkammer genutzten Bodenraum. Während die Straßenfassade weitgehend nach Vermutungen wieder hergestellt wurde (eine belegbare Geschichte für das Gebäude gibt es nicht), wartet auf der Gartenseite eine große Überraschung: Das Ziegelwerk ist grau geschlämmt, die Fensteröffnungen sind vergrößert und von breiten Putzfaschen in einem helleren Ton gerahmt.
Den Niedrigenergiehausstandard erreichte Rüdiger Lange auch deshalb, weil das Haus über insgesamt nur zwei Außenfassaden verfügt. Neben dieser günstigen Ausgangslage sind es aber in erster Linie die hoch effizienten Modernisierungsmaßnahmen bis hin zur komplett erneuerten Haustechnik, die halfen, den Energieverbrauch des Gebäudes von ursprünglich 260 auf lediglich 57 kWh/m2a zu reduzieren. Gleichzeitig sank der Kohlendioxid-Ausstoß von 65 auf 14 kg/m2a – in Zeiten des drohenden Klimawandels ein zwar kleiner, dennoch aber wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.Metamorphose, Mo., 2008.01.07
07. Januar 2008 Felicitas Tilg
verknüpfte Bauwerke
Niedrigenergiehaus in Alsdorf