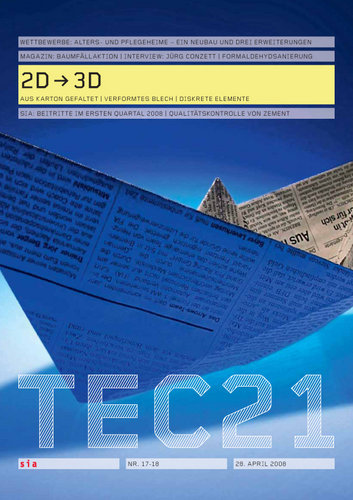Editorial
Jedes Kind, das schon einmal ein Blatt Papier zerknüllt hat, weiss: Aus (annähernd) zweidimensionalen Elementen können bemerkenswert stabile dreidimensionale Strukturen gebildet werden. Das Phänomen lässt sich in der Natur beobachten, etwa bei Palmen, deren gefaltet wachsende Blätter bei sehr geringem Eigengewicht eine hohe Steifi gkeit aufweisen. Es prägt auch unübersehbar unseren Alltag: Pappbecher und Fruchtkartons, Wellblech und Spundwände, Eierschachteln und Kunststoffgartenmöbel, Flugzeugfl ügel und Autokarosserien zeugen vom weiten Anwendungsbereich einer alten Erkenntnis. Doch so vertraut das Prinzip auch ist, so ungebrochen bleibt die Faszination, die es auf unterschiedlichste Berufsgruppen ausübt. Sowohl die traditionelle japanische Papierfaltkunst Origami als auch die Objekte des zeitgenössischen Künstlers Richard Sweeney[1] machen es sich zunutze. Der Architekt Shigeru Ban zelebriert es in seinen Papprollen-Konstruktionen – vom «paper arbor» in Nagoya (1989) über den japanischen Pavillon an der Expo Hannover (2000) bis zur Papierbrücke im französischen Remoulin (2007). Ingenieure entwickeln optimierte Rohrprofi le und räumliche Tragwerke aus Platten und Scheiben, die trotz minimalem Materialaufwand eine maximale Steifi gkeit erreichen.
Mit der digitalen Revolution hat dieses Prinzip zusätzliche Bedeutung erlangt. Weil es heute dank CAAD (computer aided architectural design) und CNC (computer aided numerical control) möglich ist, ohne erhebliche Mehrkosten gegenüber Standardbauteilen fast jede Form aus einem zweidiensionalen Element auszuschneiden, haben sich die potenziellen Anwendungen vervielfältigt. Drei davon werden in diesem Heft vorgestellt. Die 2007 in Betrieb genommene Modellbauwerkstatt des Instituts für Architektur und Raumplanung der Hochschule Liechtenstein weist eine Tragstruktur aus gefalteten Kartonteilen auf. Am Lehrstuhl für CAAD der ETH Zürich wurde eine 6 m lange Blechbrücke konstruiert, die – einem Papierbeutel ähnlich – aufgeblasen und so in ihre endgültige Form gebracht wurde.[2] Das Holzkonstruktionslabor der EPF Lausanne erforscht Falttragwerke aus Holz und die Möglichkeit, komplexe Formen mit einfachen mathematischen Mitteln zu fassen.
Judit Solt
Anmerkungen:
[1] Richard Sweeney gehört zu den Referenten der internationalen Design-Konferenz «Design Blast», die am 23. Mai 2008 an der HfG Karlsruhe stattfi ndet (vgl. Veranstaltungskalender in diesem Heft); www.richardsweeney.co.uk
[2] Am gleichen Lehrstuhl entstand als Anwendung dieser Technologie auch der Hocker «Plopp», der heuer mit der Design-Auszeichnung Red-Dot-Award ausgezeichet wurde; vgl. auch «Tages- Anzeiger» vom 9. April 2008, S. 54
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neubau Altersheim Egerkingen | Erweiterung Altersheim Ringgenberg | Erweiterung Altersheim Konolfingen | Erweiterung Pflegeheim Frutigland
12 MAGAZIN
Folgenreiche Baumfällaktion | Berufsbild im Wandel: Interview mit Jürg Conzett | Formaldehydsanierung mit Schafwolle
30 AUS KARTON GEFALTET
Oliver Fritz
Das Tragwerk eines Neubaus besteht aus rund 600 unterschiedlichen Kartonteilen. Sie wurden mit computergestützten Verfahren hergestellt.
35 VERFORMTES BLECH
Oskar Zieta, Philipp Dohmen, Uwe Teutsch
Mittels FIDU (Freie-Innendruck-Umformung) wurde eine Stahlblechbrücke konstruiert. Anschliessend wurde sie in einem Belastungstest bis zur Zerstörung belastet.
40 DISKRETE ELEMENTE
Judit Solt
Ein neues Computerprogramm soll es ermöglichen, dreidimensional gekrümmte Formen mit zweidimensionalen Elementen darzustellen und zu bauen.
49 SIA
Beitritte im ersten Quartal 2008 | Qualitätskontrolle von Zement | Vermischte Meldungen
54 PRODUKTE
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
Aus Karton gefaltet
Im Rahmen eines Workshops entstand an der Hochschule Liechtenstein im September 2007 ein geschwungener Baukörper, dessen tragende Struktur aus rund 600 unterschiedlichen Wellkartonelementen besteht. Der temporäre Bau ergänzt die bestehende Modellbauwerkstatt des Instituts für Architektur und Raumplanung. Entworfen und vorfabriziert wurde er mithilfe von computergestützten, standardisierten Produktionsverfahren.
Dieses Bauexperiment steht zusätzlich in engem Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt «Computergestützte Freiformen in der Architektur», das in den letzten zwei Jahren unter der Leitung des Autors an der Hochschule Liechtenstein von Tom Pawlofsky bearbeitet wurde. Schwerpunkt dieser staatlich und privat geförderten Forschung ist die Auseinandersetzung mit standardisierten Produktionsverfahren für beliebige Formen in architektonischem Massstab. Durch die Möglichkeit des freien Modellierens dreidimensionaler Formen am Computer und die sich daraus verändernde Formensprache der Architektur gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Ein Produkt des Forschungsprojekts ist der Prototyp eines Schalungssystems für Freiformen aus Wellkarton: Zu sehr günstigen Preisen ist nun die computergestützte Produktion grossformatigen Formenbaus – direkt aus dem 3-D-Programm gesteuert – möglich geworden. Es ist ein deutlicher Fortschritt zu den bisherigen Produktionsmethoden, bei denen für vergleichbare Projekte schiffbauähnliche Spantenkonstruktionen entworfen und gebaut werden. Das Herausfräsen von Grossformen mit CNC-Maschinen aus massiven Schaumklötzen findet aus Kostengründen kaum statt.
Entwurf
Das Institut für Architektur und Raumplanung der Hochschule Liechtenstein leidet seit geraumer Zeit an Platznot, daher der Wunsch nach einer ausgelagerten Modellbauwerkstatt. Auf Anfrage wurde ein ausdrücklich als temporär deklariertes Gebäude im Eingangsbereich der Schule genehmigt. Basierend auf den Resultaten studentischer Entwurfsarbeiten wurde entschieden, eine Werkstatt aus Wellkarton zu bauen: Einerseits unterstützt dieses Material den temporären Charakter eines solchen Baus, andererseits verfügt die Hochschule dank dem oben erwähnten Forschungsprojekt über die nötige Kompetenz, um es zu verwirklichen. Im Vorfeld konnten die Projektleiter bereits in einem ebenfalls gebauten Projekt, dem so genannten Pappshop, material- und produktionsspezifische Erfahrung sammeln und nachweisen, dass ein Selbstbau in einem Workshop mit Studierenden realisierbar ist.
Der Perimeter für die neue, 60 m² grosse Modellbauwerkstatt ist durch die Topografie geprägt sowie durch Fenster und Schächte, die nicht verbaut werden sollten, und durch einen Baum, den es zu erhalten galt. Eine aufgeständerte Holzplattform, die infrastrukturell mit Wasser und Strom ausgerüstet wurde, bildete die Grundlage für den Bau. Die Form des Grundrisses wurde im Wesentlichen durch Nutzung und äussere Faktoren beeinflusst. Da das Material Wellkarton nur bedingt Zugkräfte aufzunehmen vermag, musste sich der Schnitt dem Kräfteverlauf annähern. Um die 600 Elemente konstruktiv gleich einsetzen zu können, entstand eine unhierarchische Struktur ohne Unterscheidung zwischen den Bauteilen für Decke oder Wand. Da der Workshop zeitlich auf zwei Wochen limitiert war, mussten zahlreiche Entwurfsentscheidungen und Produktionsschritte vorweggenommen werden. Auch wurde der Bau erst nach dem erhofften Termin fertig, weil der gesamte Bauablauf der Wettervorhersage angepasst werden musste: Zu gross war die Gefahr, dass ein sommerlicher Regenschauer das in der Bauphase noch undichte Konstrukt innert zwei Stunden aufweichen würde. Der Grossteil der Vorfertigung fand im Atelier der Hochschule statt, die eigentliche Montage der Tragstruktur auf der Baustelle geschah innerhalb von drei bis vier Tagen.
Digitaler Prozess
Nachdem die Hüllform in einer 3-D-Software (Rhino 3D) modelliert worden war, musste ein Konzept für die angestrebte Triangulierung entwickelt werden. Ziel war es, möglichst gleich grosse, nahezu gleichseitige Dreiecke zu generieren. Dabei konnte auf Ideen Buckminster Fullers zurückgegriffen werden, der sich bei der Konstruktion seiner geodätischen Kuppeln genau mit dieser Problematik beschäftigt hatte. Üblicherweise wird ein Knotenpunkt über sechs sich treffende Dreiecke definiert. Um jedoch eine zweifache Krümmung herstellen zu können, bedarf es einiger Knotenpunkte, die – vergleichbar dem Abnehmen beim Stricken – aus nur fünf Dreiecken bestehen.
Nachdem die Position der Knotenpunkte auf der Form festgelegt worden war, konnten die Dreiecke gezeichnet werden; dann kamen die Streben, die Laschen der Kartons und schliesslich die Schnittmuster. Jedes der 600 Dreiecke hat eine andere Dimension und einen anderen Winkel. Ein Projekt dieser Komplexität manuell zu zeichnen, wäre nicht durchführbar gewesen; stattdessen wurden für die einzelnen Bearbeitungsschritte CAD-Skripte geschrieben, die – ähnlich wie das Drucken eines Word-Serienbriefs an unterschiedliche Adressaten – automatisch jedes einzelne Schnittmuster mit seinen individuellen Laschen, Falzlinien und seiner Beschriftung zeichneten. So gab es ein Script für die Generierung der Haut und eines für die Aufkleber der Bauteile; ein weiteres fertigte – einem Druckertreiber vergleichbar – aus den farbigen Linien der Zeichnung die Maschinendaten für die unterschiedlichen Werkzeuge des CNC-Flachbettcutters (Schneiden, Falzen, Beschriften). Auf diese Weise konnten die Daten für die Produktion und den Bau frei von Flüchtigkeitsfehlern und Zeichentoleranzen unmittelbar aus den Entwurfszeichnungen in wenigen Minuten generiert werden.
Dezentraler Aufbauplan und intelligente Bauteile
Der Aufbau der Bauelemente untereinander war über die Definition von Nachbarschaftsverhältnissen organisiert: Es gab also keinen klassischen Übersichtsplan mit Grundrissen oder Schnitten, sondern nur die Informationen zu Produktion, Identität und Nachbarschaft, die jedes Bauteil auf einem Sticker trug. Dieses System mit «intelligenten Puzzleteilen» hat sich beim Aufbau bewährt; ein «globaler» Plan wurde lediglich erstellt, um beim Verschweissen der PVC-Haut die Übersicht zu behalten.
Die Tragkonstruktion besteht aus schiefwinkligen Kartons mit Laschen, die zu stabförmigen Elementen gefaltet werden und die Kante eines Dreiecks bilden. Gemeinsam ergeben die geringfügig unterschiedlichen Elemente eine zweifach gekrümmte Form. Als Material wurde paraffinierter Wellkarton gewählt, der üblicherweise für die Produktion von Obstkartons zum Einsatz kommt. An den Knotenpunkten wurden die windmühlenförmig ineinandergreifenden Laschen verleimt und getackert; zu Montagezwecken wurde um jedes Dreieck ein Umreifungsband gespannt. Im Sockelbereich dient eine sägezahnförmige Unterkonstruktion aus Holz, die auf der aufgeständerten Holzplattform angebracht ist, zugleich als Schablone, Auflager und Spritzwasserschutz. Um die Pappkonstruktion gegen Regen zu schützen, erhielt sie eine Haut aus opaker PVC-Lastwagenplane, die zu einem grossen «Taucheranzug» aus konfektionierten Einzelteilen zusammengeschweisst wurde. Die Hinterlüftung wurde mittels gebrauchter Tennisbälle gewährleistet, die als Abstandhalter zwischen der Konstruktion und der Blache (Folie) fungieren.
Dieses selbst gebaute Experiment vermittelt mit einfachen Mitteln komplexe Technologie als Lehrinhalt. Die erarbeiteten Erkenntnisse lassen sich separat anwenden oder auf andere Materialien übertragen, zeigten zum Abschluss des Forschungsprojekts aber auch die Grenzen der Machbarkeit auf. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts erscheinen dieses Jahr als Buch der Reihe «Positionen der Architektur» unter demselben Titel im Michael Imhof-Verlag, Petersberg.
[Oliver Fritz, ehem. Assistenzprofessor Hochschule Liechtenstein]TEC21, Mo., 2008.04.28
28. April 2008 Oliver Fritz
Verformtes Blech
Studierende der Fakultät Architektur der ETH Zürich haben eine 6 m lange Stahlblechbrücke mit der Freie-Innendruck-Umformung (FIDU) konstruiert und einem Belastungstest unterzogen. Diese neue Produktionsmethode hat ein hohes Potenzial für weitere Anwendungen in der Architektur – die entwickelten Formen können leicht und günstig konstruiert werden.
Die Professur für Computer Aided Architectural Design (CAAD) von Prof. Ludger Hovestadt an der ETH Zürich untersucht seit Jahren neue industrielle Produktionsmethoden. Ziel der Forschungsarbeiten ist die Entwicklung computerunterstützter, nahtlos ineinandergreifender Entwurfs- und Bauprozesse. Ein Thema, dem sich die Professur von Anfang an gewidmet hat, ist die Bearbeitung von Blech.
Die Freie-Innendruck-Umformung (FIDU)
Beim FIDU-Prozess werden aus zwei deckungsgleich geschnittenen und am Rand miteinander verschweissten Blechen stabile Formen erzeugt. Der Raum zwischen den Blechen wird durch Wasser- oder Luftdruck aufgeblasen und somit in seine endgültige Form gebracht. Die Form wird wesentlich über die Geometrie des Zuschnitts (Kontur), den verwendeten Innendruck und die Dauer des Druckes gesteuert. Im Gegensatz zur Innenhochdruck-Umformungs-Methode IHU (siehe Kasten Seite 37) kommt die FIDU mit einem Tausendstel dieser Drücke aus (0.1–7 bar). Die FIDU ermöglicht zudem eine Formgebung für das Blech am Ende einer digitalen Produktionskette. In dieser hat sich der CNC-gesteuerte Laser als universelles Trenn- und Verbindungsverfahren bewährt.
Entwurf und Produktion einer Brücke
In den Workshops und Seminarwochen der Professur für CAAD konnten die Studierenden einen Entwurf mit Stahlblechen machen und in der Werkstatt umsetzen. Dabei wurde die Diskrepanz zwischen der hochpräzisen Lasertechnologie und der ungenauen manuellen Montage deutlich, die sich bei Anwendung der FIDU-Methode für die Formgebung noch verstärkt. In bisherigen Experimenten wurden die Produktions- und Konstruktionsmöglichkeiten von Blechobjekten stets im kleinen Massstab getestet, in der Seminarwoche des Herbstsemesters 2007 wurde erstmals ein grösseres Tragwerk entworfen und produziert.
Die erste Phase der Seminarwoche bestand in der Auseinandersetzung mit der FIDU-Technologie, der Blechbearbeitung im Allgemeinen und dem materialgerechten Entwurf einer Brücke in Stahlblechkonstruktion (Typ St 3s DC04). Die zweite Phase widmete sich der Umsetzung und Realisierung des Konzepts. Zur Produktion der Brücke kamen computergesteuerte Maschinen zur Anwendung, die bei der CNC-Metallverarbeitung üblich sind (Laserschneid- und -schweissanlagen). Die 6 m langen Längsträger wurden mit einem Flachbett-Laser geschnitten (Bild 1), die Herstellung der 30 Querträger von1.2 m Länge erfolgte mit einem Laser-Schweissroboter (Bilder 2 3). Alle vorproduzierten Teile wurden im flachen, noch unverformten Zustand an die ETH gebracht. Die Hauptträgerelemente wurden vor Ort zusammengeschweisst und zum Aufblasen vorbereitet. Der Formgebungsprozess der Längs- und Querträger erfolgte mit Innendrücken bis 0.4 bar (Bilder 5–8). Nach der Formgebung wurden die Längs- und Querträger zu einer Brücke aufgebaut. Die Querträger wurden dabei als Flachkant eingebaut, um direkt eine begehbare Fläche zu erhalten (Bilder 10–12). Für die Auflagerbleche wurden 5 mm starke Stahlplatten gefertigt, die jeweils an den Enden der Längsträger beidseitig angeschraubt wurden (Bild 9 Hintergrund). Vertikale Laschen t=10 mm bildeten die Auflager (Bild 9 Vordergrund).
Im Anschluss fand ein Belastungstest der Konstruktion statt. Dazu wurde die Brücke auf dem Aufspannboden des Instituts für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich so verankert, dass sie horizontal in beide Richtungen unverschieblich gelagert war (Aufbau Bild 13). Bedingt durch die Lagerung ist die Brücke statisch unbestimmt und trägt ihre Lasten, abhängig vom Verhältnis der Steifigkeiten EA / EI, über Normalkräfte und Biegung ab. Im Belastungstest wurde die Konstruktion durch 25-kg-Sandsäcke sukzessive bis zum Bruch belastet. Am nördlichen Lager traten jedoch kleine horizontale Verschiebungen auf. Das Lager bestand aus zwei Hydraulikzylindern, die bedingt durch den zusätzlichen Öldruck aus der Auflast und durch die Elastizität der Ölschläuche Verschiebungen von bis zu 1.4 mm zuliessen. Dadurch reduzierte sich der Normalkraftanteil der Lastabtragung, und die Lasten wurden zu einem grösseren Anteil über Biegung abgetragen.
Tragverhalten der Brücke erfassen
Um das Tragverhalten der Brücke während der Belastung erfassen zu können, wurden sechs induktive Wegaufnehmer jeweils in jedem Viertelspunkt der beiden Längsträger positioniert. Zwei weitere Wegaufnehmer massen die horizontalen Verschiebungen des nördlichen Lagers und die Querverschiebung in Feldmitte der Brücke. Um die vertikalen Auflagerkräfte zu erfassen und die Lastaufbringung zu kontrollieren, wurden unter das nördliche Lager zwei Kraftmessdosen gesetzt. Durch zwölf Dehnmessstreifen (DMS), die an einem der beiden Längsträger jeweils beidseitig an der oberen und der unteren Kante in den Viertelspunkten aufgebracht wurden, konnten Dehnungen des Längsträgers gemessen werden. Zusätzlich wurde die Verformung bzw. Verschiebung der gesamten Brücke mit einem terrestrischen Laserscanner ZLSO7 dreidimensional nach jeder aufgebrachten Last-stufe erfasst. Die Belastung der Querträger wurde nicht separat beobachtet.
Die Belastung erfolgte in Laststufen zu je 8 Sandsäcken à 0.25 kN bis zum Bruch (Bild 14: Last-Verformungs-Kurven; Bild 15: Horizontalkraft und Horizontalverschiebung im nördlichen Lager). Die Last wurde von der Mitte der Brücke nach aussen hin zu den Auflagern als verteilte Last aufgebracht. Nach Erreichen der siebten Laststufe war die Brückenfläche komplett mit Sandsäcken belegt, und die weitere Last wurde in einer zweiten Lage erneut von der Mitte nach aussen hin positioniert. Bei der neunten Belastungsstufe zeigte die Brücke plötzlich grössere Verformungen, bei Beginn der zehnten Laststufe (1.85 kN) versagte die Konstruktion und knickte in der Feldmitte der Längsträger ein.
Aus dem Last-Verformungs-Diagramm (Diagramm 1: blaue Kurve) lässt sich erkennen, dass ab einer Gesamtlast von 14 kN die Steifigkeit der Brücke abnimmt und die Kurve flacher wird. Die Konstruktion versagte bei einer Gesamtlast von 18.5 kN durch Beulen und dadurch bedingte grosse plastische Verformungen im Druckgurt der Längsträger (Bilder 18 und 19). Dieser ist durch die Formgebung von Beginn an stark imperfekt, da die Bleche bereits beim Aufblasen aufgrund der plastischen Verformung beulen. In diesen Bereichen tritt zunächst erstes lokales Versagen auf, was schliesslich zum Versagen der Gesamtkonstruktion führt.
Berechnung am idealen statischen System
Der Vergleich mit einer Berechnung der Brücke anhand eines idealen Systems, also ohne die erwähnten Imperfektionen aufgrund der Formgebung, zeigt, dass bis zu einer Belastung von 8 kN die Steifigkeit der Brücke durch die Imperfektionen nicht vermindert wird. Erst ab einer Belastung von 12 kN nimmt sie ab. Die am imperfekten System gemessene Kurve fiel insgesamt nur leicht flacher aus als die am idealen perfekten System errechnete.[1] Die Berechnung am idealen System erfolgt unter Berücksichtigung der gemessenen horizontalen Verschiebungen u am nördlichen Lager. Die blaue Kurve (Bild 14) zeigt auf der y-Achse bei einer Last von 10 kN und 14 kN horizontale Abschnitte, welche die Kurve nach links verschieben und somit die Steifigkeit erhöhen. Dies erklärt sich durch ein zweimaliges Ausgleichen der horizontalen Verschiebung, wobei die Zylinder des nördlichen Lagers durch Erhöhung des Öldruckes zurück in den unverschobenen Zustand gebracht wurden. Dadurch wird die Normalkraft in den Längsträgern erhöht und der Bieganteil der Lastabtragung verringert, was zu einer Reduktion der Durchbiegung in Feldmitte führt. Die horizontalen Verschiebungen nach rechts zeigen den jeweiligen Beginn der nächsten Laststufe. Bild 15 stellt den Verlauf der horizontalen Verschiebung u am nördlichen Lager (blaue Kurve) und die zugehörige gemessene Horizontalkraft an den Auflagern (rote Kurve) dar. Die Horizontalkraft entspricht der Normalkraft in Feldmitte der Längsträger.
FIDU als Alternative zu bisherigen Profilen
Das Ergebnis des Belastungstests zeigt, dass Konstruktionen aus verschweissten, dünnen Blechen, die mit der FIDU-Methode geformt werden, für grössere statische Systeme eingesetzt werden können. Sie stellen eine Alternative zu herkömmlichen Rohr- oder Hohlprofilen dar. Die auftretenden Imperfektionen aufgrund der Formgebung verringern zwar die maximal aufnehmbaren Lasten. Mit diesen Profilen sind aber – bedingt durch die schnelle und einfache Herstellung, die Materialeinsparung und den einfachen Transport – Konstruktionen möglich, die kostengünstiger sind als vergleichbare Systeme aus herkömmlichen Profilen.
Die Brücke hat bei einer Spannweite von rund 6 m und einer Breite von 1.2 m ein Eigengewicht von rund 170 kg. Die Traglast betrug im Versuch 1800 kg, sodass ein Verhältnis von Nutzlast : Eigengewicht von 10 : 1 erzielt werden konnte. Vergleicht man diese Konstruktion mit einer konventionellen Brücke aus Standardprofilen aus Stahl, zum Beispiel IPE 180 als Längsträger und IPE 100 als Querträger mit einer Fahrbahn aus Stahlgitterrosten, so kann rund die Hälfte an Eigengewicht eingespart werden. Vergleicht man die Produktionskosten der Konstruktionselemente, so ermittelt man rund 3500 Fr. für die konventionelle Bauart. Bei der FIDU-Methode, mit einem realistischen Ansatz von 500 Fr. / Stunde für die Laserschneid- und -schweissmaschine, werden bei ähnlichem Planungsaufwand Produktionskosten von 1200 Fr. generiert. Mit der FIDU-Methode können also nicht nur interessante Formen entwickelt, sondern auch leichtere und günstigere Konstruktionen ermöglicht werden.
Die Entwicklung der FIDU-Methode und ihrer Möglichkeiten steht erst am Anfang. In weiteren Studentenprojekten sollen im Laufe dieses Jahres potenzielle Anwendungsgebiete aufgezeigt werden. Parallel zu dieser konzeptionellen Entwicklungsarbeit wird auf dem Aufspannboden des Instituts für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich ein Versuchsstand erstellt, auf dem verschiedene FIDU-Prototypen, deren Träger sich in Geometrien und Konstruktionsart unterscheiden, systematisch getestet werden können. So soll das Potenzial dieser Konstruktionsmethode auch wissenschaftlich erfasst werden.
Anmerkung
[1] Anmerkung der Redaktion: Auf die Berechnungen, die im perfekten System gemacht worden sind, ist aufgrund der nicht präzis kalkulierbaren Formgebung der Träger nur bedingt Verlass. Die bisherigen Versuche reichen aber noch nicht aus, um einen Abminderungsfaktor festlegen zu können.TEC21, Mo., 2008.04.28
28. April 2008 Oskar Zieta, Philipp Dohmen, Uwe Teutsch