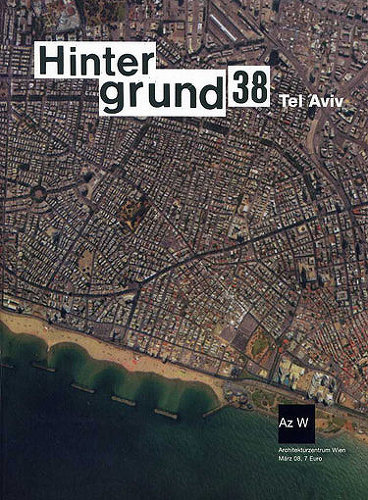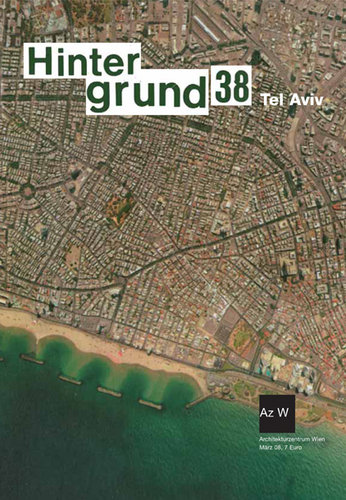Editorial
Im Juli 2003 erhob die UNESCO das Stadtzentrum von Tel Aviv in den Rang eines Weltkulturerbes. Die israelische Stadt am Meer verfügt – wie hierzulande wenig bekannt – über ein einzigartiges Ensemble von mehr als 4.000 Häusern im Stil des Neuen Bauens, die erst in den letzten Jahren teilweise restauriert wurden. Unter dem Titel „The White City of Tel Aviv – The Modern Movement“ tourt seit 2004 eine von der Stadt Tel Aviv organisierte Ausstellung durch die Welt, die von 20.2. bis 19.5.2008 im Architekturzentrum Wien erstmals im deutschsprachigen Raum gezeigt wird.
Die Ausgabe 38 des Hintergrunds widmet sich – als Begleitheft zur Ausstellung – in ihrem Thementeil zur Gänze der israelischen Metropole. Die Stadt versteht sich als das säkulare und liberale Gegenstück zum geschichtsschweren und heiß umkämpften Jerusalem. Tel Avivs funktionalistische Architektur ist nur im Kontext eines zionistisch-sozialistischen Projekts zu verstehen, dem es um einen Neuen Menschen, den Neuen Israeli ging. Doch der Anschein, dass hier das moderne, kosmopolitische Israel ganz bei sich selbst ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Tel Aviv ebenfalls auf eine Geschichte von schweren Konflikten zurückblickt. Seine Entstehung als jüdische Alternative zum Jahrtausende alten Jaffa war von Auseinandersetzungen mit dessen mehrheitlich arabischer Bevölkerung geprägt, die im Unabhängigkeitskrieg 1948 kulminierten. Die Ausstellung „The White City“ repräsentiert den – von berechtigtem Stolz geleiteten – israelischen Blick auf ein bemerkenswertes urbanistisches Projekt. Im vorliegenden Themenheft soll aber auch Kritik an dieser Perspektive auf die Stadtgeschichte ihren Platz haben.
Die deutsche Kunst- und Architekturhistorikerin Ita Heinze-Greenberg, durch zahlreiche Forschungs- und Lehraufträge in Israel bestens mit dessen Architekturgeschichte vertraut, bettet in ihrem Artikel zur „Weißen Stadt“ die Rezeption der Moderne in den zionistischen Kontext ein. In ihren Augen „kürten die Journalisten Tel Aviv zur größten ‚Bauhaus’-Stadt der Welt, unbeirrt von sachten bis deutlichen Hinweisen der Architekturhistoriker, doch den korrekten Umgang mit Begriffen und Bezeichnungen zu pflegen“. Der Erfolg der Eintragung als UNESCO-Weltkulturerbe rief im rechten und linken politischen Lager gänzlich unterschiedliche Reaktionen hervor: Frohlockte der damalige Tourismusminister Benyamin Elon von der rechtsgerichteten Moledet-Partei: „Die Schaffung der Stadt Tel Aviv ist eines der stärksten Symbole für den Erfolg der zionistischen Bewegung“, begann der linke Flügel am Mythos der auf Sand gebauten Weißen Stadt zu rütteln.
Heinze-Greenberg kommt auch in einer ausführlichen Rezension zu einem kontroversiellen Buch von Anna Minta zu Wort: „Israel bauen. Architektur, Städtebau und Denkmalpflege nach der Staatsgründung 1948.“ Minta widmet sich in ihren Forschungen der Bedeutung von Architektur und Städtebau in Israel als geo- und kulturpolitische Instrumentarien. Die Rezensentin verweist auf die postzionistische Sicht der Autorin. Das Aufbrechen tabuisierter Gründungsmythen, wie der freiwilligen Migration der arabischen Bevölkerung, löste einen heftigen Streit unter israelischen Historikern aus.
Jeremie Hoffmann, Direktor des Denkmalamtes der Stadt Tel Aviv, erläutert in seinem Beitrag die Schwierigkeiten bei der dringend notwendigen Sanierung der Häuser der Moderne.
Zur Riege der hochkarätigen Autoren für diese Ausgabe gesellte sich in letzter Sekunde auch der Vorgänger im Amt von Jeremie Hoffmann: Pe’era Goldman (bis 2005 als Leiter des Denkmalamtes tätig).
Ursula Prokop, Kunst- und Architekturhistorikerin, geht in ihrem Artikel auf einige österreichisch-jüdische Architekten ein, die sich – noch vor der großen, durch die Gewaltherrschaft der Nazis bedingten Einwanderungswelle – am Aufbau Palästinas stadtplanerisch beteiligt hatten. Dass sich deren Anteil, gemessen an anderen Nationalitäten, trotzdem in Grenzen hielt, hängt wohl mit der traditionell eher antizionistischen Haltung der österreichischen Juden zusammen.
Im Az W-Journalteil erfahren Sie auch diesmal wieder Wissenswertes über unsere Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen. Sollten sie also keine Gelegenheit gehabt haben, live dabei zu sein, bekommen Sie in der um neue Formate bereicherten Nachlese Einblick in die Aktivitäten des Az W der letzten Monate. Mehr als Vorschau denn als Nachlese ist wohl die Bildstrecke mit unfertigen Hotelanlagen zu bezeichnen, die die Künstlerinnen Sabine Haubitz und Stefanie Zoche zwischen 2002 und 2005 auf der ägyptischen Halbinsel Sinai fotografiert haben. Das Az W zeigt diese außergewöhnliche Dokumentation von 24.04.2008 bis 12.05.2008 in einer Ausstellung in der Halle F3.
Besonders hervorheben möchten wir den Beitrag von Inge Scheidl, die das seit vier Jahren laufende, vom FWF geförderte Forschungsprojekt „Wiener Architektenlexikon 1880-1945“ leitet und in einem pointierten Artikel von ihren teils leidvollen Erfahrungen berichtet. Das akribisch recherchierte Architektenlexikon, ein Desiderat seit Jahrzehnten, wird bereits seit 2005 in einer Datenbank auf der Website des Az W (www.azw.at, www.architektenlexikon.at) sukzessive erweitert und kostenlos zugänglich gemacht. Für das heurige Frühjahr ist mit der Fertigstellung zu rechnen.
Einen ganz anderen Aspekt der Architekturforschung – den Originalitätsbegriff der Moderne sowie die gefährdete Authentizität ihrer Monumente durch Renovierung – berührt Dietmar Steiner in seiner Glosse zur „Sanierung der Moderne“. Diesem nicht nur für die Denkmalpflege in Tel Aviv brisanten Thema ist ein gemeinsam mit dem österreichischen Bundesdenkmalamt organisiertes Symposion gewidmet, das am 12.04.2008 im Az W stattfindet.
Nicht zuletzt möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auch auf die sanfte grafische Veränderung des Heftes lenken. „Eine veränderung, die keine verbesserung ist, ist eine verschlechterung“ – getreu diesem Ausspruch von Adolf Loos hoffen wir, dass Sie das modifizierte Erscheinungsbild des Hintergrunds positiv überrascht. Wenn Sie sich darüber hinaus – was wir besonders hoffen – von den Inhalten dieses Heftes angesprochen fühlen, so erlauben Sie uns an dieser Stelle den dezenten wie pragmatischen Hinweis, dass man den Hintergrund nicht nur günstig erwerben, sondern auch günstig abonnieren kann.
Gabriele Kaiser, Sonja Pisarik
Inhalt
05 Vorwort
Thema Tel Aviv
09 Ita Heinze-Greenberg: Die „Weiße Stadt“ von Tel Aviv. Anmerkungen zur Rezeption der Moderne im zionistischen Kontext
21 Jeremie Hoffmann: Towards Conservation. The „White City” of Tel Aviv as a World Heritage Site
27 Pe'era Goldman: Tel Aviv – Urban Vision and Reality
35 Ursula Prokop: Zum Anteil österreichisch-jüdischer Architekten am Aufbau Palästinas
45 Ita Heinze-Greenberg: Buchbesprechung Anna Minta, Israel Bauen
Az W Journal
50 Az W Bibliothek – Handapparat Tel Aviv
54 Inge Scheidl: Wozu brauchen wir ein Wiener Architekten-Lexikon?
63 Ute Waditschatka: Die Frankfurter Küche und 100 Jahre Theiss & Jaksch
66 Gabriele Kaiser: Sinai Hotels von Haubitz Zoche
73 Ivan Ristić: „Paradoxe ABCs“ von Bogdan Bogdanović
74 1 Frage, 10 Tage, 5 Elemente – Ein Projekt von Sandra Häuplik-Meusburger, Verena Holzgethan und Nikolaus Similache
89 Marion Kuzmany: slowenien brandneu und bratislava topaktuell
92 Dietmar Steiner: Sanierung der Moderne
94 Kurzbios Autorinnen und Autoren
95 Team Az W
96 Mitglieder Architecture Lounge, xlarge Partner
Die „Weiße Stadt“ von Tel Aviv
Die White City of Tel Aviv steht seit Sommer 2003 auf der UNESCO-Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit. Bis dato standen nur zwei bzw. drei Objekte in Israel auf der insgesamt 628 Kulturdenkmäler zählenden Liste: die Altstadt von Akko, die archäologische Stätte Masada sowie auf Vorschlag Jordaniens die Altstadt und die Stadtmauern von Jerusalem. 2005 sind zwei weitere archäologische Stätten hinzugekommen. Mit der Weißen Stadt Tel Avivs ist ein Stadtensemble der Moderne aufgenommen worden – bislang durchaus noch eine Rarität auf der UNESCO-Liste. Die Eintragung des circa 140 ha großen dicht bebauten Gebietes im Zentrum der Mittelmeermetropole basiert auf der Erfüllung von zwei (Criterion ii und Criterion iv) der insgesamt sechs Aufnahmekriterien für Kulturgüter, welche besagen: „Das Objekt hat während einer Zeitspanne oder in einem Kulturgebiet der Erde beträchtlichen Einfluss auf die Entwicklung der Architektur, der Großplastik oder des Städtebaus und der Landschaftsgestaltung ausgeübt“ und „ist ein herausragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden oder architektonischen Ensembles oder einer Landschaft, die (einen) bedeutsame(n) Abschnitt(e) in der menschlichen Geschichte darstellt.“ Die Nominierungserklärung unterstreicht denn auch mit Nachdruck die als bedeutungsvoll herausragende Synthese verschiedenster Trends der Moderne und ihre Adaption an lokale geographische wie kulturelle Bedingungen: „Tel Aviv wurde 1909 gegründet und entwickelte sich unter dem Britischen Mandat (1920-1948). Die Weiße Stadt wurde ab den frühen Dreißigern bis 1948 gebaut. Basierend auf dem Stadtplan von Sir Patrick Geddes reflektiert sie moderne organische Planungsprinzipien. Die Bauten wurden von jüdischen Architekten entworfen, die in Europa ausgebildet wurden und dort praktizierten, bevor sie nach Palästina – Eretz Israel – auswanderten. Sie schufen ein herausragendes architektonisches Ensemble der Moderne in einem neuen kulturellen Kontext.“
Tel Aviv feierte die Aufnahme in die UNESCO-Liste mit Konferenzen, Ausstellungen, Straßenparties und beachtlichem Medienrummel. Die Journalisten kürten die Stadt zur größten „Bauhaus“-Stadt der Welt, unbeirrt von sachten bis deutlichen Hinweisen der Architekturhistoriker, doch den korrekten Umgang mit Begriffen und Bezeichnungen zu pflegen. Der damalige Tourismusminister Benyamin Elon von der rechtsgerichteten Moledet-Partei frohlockte: „Die Schaffung der Stadt Tel Aviv ist eines der stärksten Symbole für den Erfolg der zionistischen Bewegung. Dass ausgerechnet die UNESCO, die doch mit jener Organisation affiliert ist, die einst die abscheuliche Zionismus-Rassismus-Resolution verabschiedet hatte, die Besonderheit Tel Avivs anerkennt, ist von spezieller Wichtigkeit.“ Auch der linke Flügel meldete sich zu Wort und begann, am Mythos der auf Sand gebauten Weißen Stadt zu rütteln. Dies gipfelte ein Jahr nach dem bejubelten Listeneintrag in der Publikation White City, Black City, mit welcher Sharon Rotbard, Architekt und Dozent an der Jerusalemer Bezalel Kunstakademie, seine postzionistische Sicht auf Tel Aviv vorlegte. Was bei der durch die UNESCO gekrönten Erfolgsgeschichte der Weißen Stadt mitschwingt, ist seiner Meinung nach nicht etwa ein Loblied auf die gute, einfache Architektur, sondern das Bestreben, Tel Aviv von seinem politisch-historischen Kontext zu isolieren, die Stadt in eine aristokratisch europäische Zone zu transformieren, und sie, von der Geschichte des arabischen Jaffa losgelöst, als hygienisch reines, ja steriles Gebiet zu konservieren.
Solche Töne sind durchaus nicht neu. Tel Aviv stand von jeher im Fokus des zionistischen Diskurses und im Kreuzfeuer der Kritik. 1909 von sechzig jüdischen Familien als Gartenvorort der alten arabischen Stadt Jaffa gegründet, war die Stadt bis zur Eingemeindung Jaffas 1950 eine ausschließlich jüdische Stadt, in der jeder Bäcker, jeder Polizist, jeder Straßenarbeiter, jeder Lehrer, jeder Maurer jüdisch war. Das war damals etwas Besonderes und einmalig in der Welt. Thomas Mann, der die Stadt 1930 besuchte, nach einem Aufenthalt in Ägypten, wo er Studien für seinen Josephsroman anstellte, schrieb: „Ich habe die junge Stadt Tel Aviv besucht, jene rein jüdische Stadt, wo das Judentum wie nirgends sonst sich eines Selbstbewusstseins seiner unabhängigen nationalen Existenz erfreut.“
Der Name „Tel Aviv“ bedeutet wörtlich übersetzt „Frühlingshügel“. So hatte der Dichter und Schriftsteller Nahum Sokolov poetisch den Romantitel von Theodor Herzls 1902 in Leipzig erschienener zionistischer Utopie Altneuland ins Hebräische übersetzt. „Tel“ ist ein Grabungshügel und als solcher Zeichen für die Überreste alter Siedlungen, „Aviv“ bedeutet „Frühling“, symbolisiert also Neuanfang. Tel Aviv wurde mit der Zielvorgabe gegründet, sich an die Realisierung der Herzlschen Zukunftsvision zu begeben. Die Genese dieser Stadt stand daher ganz unmittelbar im Spannungsfeld der Debatten über die Ziele des Zionismus. Als erste jüdische Stadt – ab 1923 mit jüdischer Selbstverwaltung – präfigurierte sie den autonomen jüdischen Staat. Tel Aviv war das Labor der Unabhängigkeit.
Die kleine Ansiedlung in den Sanddünen entwickelte sich schon bald nach ihrer Gründung zum Anlaufpunkt von Einwanderern, die sie in immer neuen Wellen überschwemmten und sie in wildem Wachstum rasant anwachsen ließen. Bebauungspläne hinkten entweder der Realität hinterher oder waren zu anspruchsvoll, um vor der Realität Bestand zu haben. War die Wachstumsrate vor dem ersten Weltkrieg noch überschaubar, so änderte sich das mit der vielversprechenden Balfour Deklaration von 1917 und der 1920 folgenden Mandatsübernahme der Briten. Zehntausende vorwiegend aus Osteuropa stammende Einwanderer kamen ins Land, von denen sich viele in Tel Aviv ansiedelten. Der junge Arthur Koestler, als Palästina-Korrespondent des Ullstein-Verlages tätig, schrieb damals: „In den frühen Zwanzigerjahren breitete sich die Stadt dann mit wachsender Geschwindigkeit längs des Strandes aus. Sie wuchs mit jeder Einwanderungswelle in Sprüngen und Stößen – eine über die Dünen ins Land vorstoßende Asphalt- und Betonflut. Zum Planen hatte man weder Zeit noch Lust; Wachstum war fieberhaft und anarchisch wie das der tropischen Pflanzenwelt. Jeder Neuankömmling baute aus seinen mitgebrachten Ersparnissen das Haus seiner Sehnsucht, [...] ein wüstes Labyrinth von engbrüstigen Balkonen und bröckelnder Stukkatur.“
In der Regel war das Bild vom ersehnten Traumhaus vorgeprägt durch die Architektur der besseren Gesellschaftsschicht jenes Landes, das die Einwanderer verlassen hatten. Das Tel Aviv der Zwanzigerjahre war ein Spiegelbild der jüdischen Diaspora Osteuropas, bestens reflektiert in seinen zeitgenössischen Spitznamen „Klein Odessa“ und „Klein Warschau“. Schon der Altvater des Zionismus Herzl hatte die Psyche der Immigranten gut eingeschätzt, als er versprach: „Man trennt sich nicht von seinen lieben Gewohnheiten, sondern findet sie wieder.“ In seinem Zukunftsroman Altneuland schildert er ein Palästina unter jüdischer Kontrolle – aufgebaut von einem Team aus hundert jungen Architekten und Bauingenieuren, die als frische Studienabgänger von den Technischen Hochschulen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands kamen; und zwar ganz in der Tradition des 19. Jahrhunderts: hochkarätige Ingenieurleistungen in historistisch-eklektizistischen Gewändern. Schon damals erntete sein völlig westlich assimiliertes Konstrukt, dieses Europa in Asien, harsche Kritik aus den eigenen Reihen, insbesondere von den sogenannten Kulturzionisten mit Achad Haam und Martin Buber an der Spitze. Doch Herzls Fraktion des politischen Zionismus verteidigte ebenso vehement das Primat der westlichen Kultur: „Wir werden nie zugeben, daß die Rückkehr der Juden in das Land ihrer Väter ein Rückfall in die Barbarei sei. Seine Eigenart wird das jüdische Volk innerhalb der allgemeinen westlichen Kultur entfalten, wie jedes andere gesittete Volk, nicht aber außerhalb, in einem kulturfeindlichen, wilden Asiatentum.“
Die Frage, in welcher Form neue jüdische Identität im alten Land Gestalt gewinnt, löste Diskurse aus, die bis heute unter verschiedensten Prämissen geführt werden. Mit der Revitalisierung der hebräischen Sprache gelang den Kulturzionisten ein entscheidender Sieg in der Auseinandersetzung um eine auf eigenen nationalen Traditionen fußende semitische Identität. Analog der Fragestellung: In welcher Sprache sprechen wir? stellten sich die Architekten des zionistischen Projekts die Frage: In welchem Stil bauen wir? Die Antwort gestaltete sich hier jedoch ungleich schwieriger. Hinsichtlich einer nationalen Formensprache mangelte es sowohl an einer hierfür notwendigen gewachsenen Verbindung zum Land als auch an Orientierungsbeispielen erhaltener historischer Bauten aus der Zeit der alten Hebräer. So waren die Verfechter des kulturzionistischen Ansatzes bei der Suche nach einer Identität schaffenden Architektur auf lokale semitisch-arabische Vorbilder angewiesen. Dies jedoch beinhaltete a priori Konfliktstoff. Der Umweg über die Rezeption arabischen Kulturgutes rückte die Akkulturation an die eigene Vergangenheit nahe an eine kulturelle Konversion. Von vielen Juden wurde dies abgelehnt, weil es letzten Endes einer neuen Assimilation gleichkäme, bzw. einer Banalisierung als rein folkloristische Attitüde. Davon abgesehen galt die arabische Architektur in Palästina – mit wenigen Ausnahmen – in den Augen der jüdischen Neueinwanderer durchweg als primitiv und unkultiviert. Der Wunsch, sich davon abzusetzen und Eigenes zu zeigen, überwog die Bestrebungen eines Dialogs mit dem Genius Loci.
Um Tel Avivs rasante bauliche Entwicklung in überschaubare Bahnen zu lenken, hatte die britische Mandatsregierung bereits 1921 einen Masterplan verlangt. Dieser wurde unter großem Zeitdruck von dem gerade ins Land gekommenen, an der TH München unter Theodor Fischer ausgebildeten Richard Kauffmann erstellt. Doch scheint sein Bebauungsplan bereits überholt gewesen, bevor er implementiert werden konnte.
1925 trat der Tel Aviver Stadtrat an den schottischen Biologen und Stadtsoziologen Sir Patrick Geddes mit dem Auftrag eines neuen Leitplanes heran, der den damals 30.000 Einwohner zählenden Ort zu einer Stadt von 100.000 Bewohnern vergrößern sollte. Geddes, der mit dem Land bereits durch Planungen für die Hebräische Universität in Jerusalem und für neue Wohnviertel in Haifa vertraut war, verbrachte in der Folge zwei Monate in Tel Aviv zwecks intensiven Studiums der örtlichen Gegebenheiten. Wichtigste Charakteristika seines Bebauungsplans waren ein fein abgestimmtes, hierarchisch gestuftes Straßennetz, das von breiten Hauptstraßen bis zu ruhigen Wohnstraßen reichte, sowie die Einführung sogenannter home-blocks. Innerhalb dieser meist aus Zweispännern gebildeten Wohnblocks befanden sich halböffentliche Einrichtungen wie Kindergärten oder Waschräume, sowie gemeinschaftliche Grünanlagen. Rasen-, Tennis- oder Spielplätze sollten durch Rosen und Wein überwachsene Passagen – rose and wine lanes – miteinander verbunden werden. Diese über Nachbarschaftseinheiten geschaffene soziale Infrastruktur machte sicherlich die Stärke des Geddes-Plans aus. Einige dieser Wohnblöcke wurden in den Dreißigerjahren erfolgreich im Bereich des sozialen Wohnungsbaus (Meonot Ow’dim und Sh’chunot Poalim) umgesetzt. Sie bestehen zum Teil bis heute und zeugen noch immer von einer hohen Wohnqualität. Der Geddes-Plan wurde in der Folge Grundlage für die urbane Entwicklung der „Weißen Stadt“.
Die im Geddes-Plan einkalkulierte Bevölkerungszahl von 100.000 erreichte Tel Aviv schneller als gedacht, denn aus dem Strom der Immigranten wurde nach 1933 eine Flut. 1932 noch 60.000 Einwohner zählend, verdoppelte sich diese Zahl innerhalb von nur drei Jahren auf 120.000. Unter den aus Mitteleuropa, hauptsächlich Deutschland, stammenden Einwanderern befanden sich auffallend viele, meist junge Architekten. Sie versprachen sich ein großes Betätigungsfeld im Rahmen des Aufbaus der Nationalen Jüdischen Heimstätte und taten sich daher leichter mit der Entscheidung für eine Auswanderung nach Palästina als Berufsgruppen, die auf Sprache und Schrift angewiesen waren und daher englischsprachige Länder bevorzugten. Die meisten der zwischen 1932 und 1939 ins Land kommenden Architekten waren an renommierten europäischen Architekturschulen ausgebildet. Die deutschen Technischen Hochschulen in Berlin-Charlottenburg, München, Darmstadt, Stuttgart standen hier an der Spitze, gefolgt von den Architekturschulen in Paris und Wien. Acht Architekten hatten unter Walter Gropius, Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe am Bauhaus in Dessau studiert.
Der prominenteste unter den Bauhausschülern war zweifelsohne Arieh Sharon. 1900 im polnischen Jaroslav geboren, wanderte er als junger Mann nach Palästina aus, wo er sich zusammen mit anderen jüdischen Pionieren für das Leben in einem Kibbuz entschloss. Hier übernahm er die Verantwortung für die Planung und Ausführung von landwirtschaftlichen Bauten. 1926 entschloss er sich zu einem Studium im Ausland und ging ans Bauhaus nach Dessau, wo er unter Gropius und Meyers Ägide Architektur studierte. 1929 heiratete er Gunta Stölzl, die Leiterin der Bauhaus Webwerkstatt. Von 1929 bis 1931 stand er Hannes Meyers Berliner Baubüro vor. 1932 ging Sharon nach Palästina zurück, eröffnete in Tel Aviv sein eigenes Architekturbüro und wurde zu einem der führenden Architekten und Planer des Landes.
Bei seiner Rückkehr hatte er für die junge jüdische Stadt Tel Aviv nichts als desillusionierte Worte übrig: „Ich erinnere mich, als ich nach sechs Jahren Abwesenheit vom Bauhaus zurückkam, schlenderte ich durch Tel Aviv und war von ihrer Architektur sehr deprimiert. Nach Berlin, das in den späten Zwanzigern die lebendigste Stadt der Welt war mit ihren Beiträgen zur Literatur, den Künsten, dem Theater und der Architektur, war Tel Aviv ein Schock.“ Zusammen mit anderen „Leidensgenossen“ machte sich Sharon in den folgenden Jahren daran, Tel Aviv in eine Weltstadt zu verwandeln. In Anlehnung an die Berliner Architektenvereinigung „Der Ring“ gründeten sie den „Chug“ (hebr. Ring), in dem sich die junge Tel Aviver Architektengeneration zusammenschloss: Ze’ev Rechter und Sam Barkai, beide kamen gerade als überzeugte Corbusianer aus Paris zurück, Carl Rubin und Joseph Neufeld hatten bei Erich Mendelsohn in Berlin gearbeitet, Chlenov war ein Pariser Beaux-Arts Student, Lindheim kam aus den USA, und viele mehr, die fast alle Auslandserfahrung bei der zeitgenössischen europäischen Avantgarde mitbrachten. Journalistisches Sprachrohr des Chug war die einige Zeit von Julius Posener editierte Zeitschrift HaBinjan (hebr.: der Bau).
Posener selbst traf im Herbst 1935 in Palästina ein und ließ sich nach einem kurzen Intermezzo in Erich Mendelsohns Jerusalemer Büro in Tel Aviv nieder. Im Koffer hatte er ein Empfehlungsschreiben Le Corbusiers, welches ihm erlaubte, in dessen Namen Aufträge zu akquirieren. Dazu kam es offenbar nicht, aber Posener antwortete den guten Wünschen, die ihm Le Corbusier mit auf den Weg gegeben hatte, mit einer ausführlichen Beschreibung seiner ersten Eindrücke vom Land. Bezaubert vom magischen Licht des Orients schwärmte er von der Schönheit der Natur, wobei er Le Corbusier an eigene Erfahrungen erinnerte: „Ich habe viel an Sie gedacht bei der Betrachtung dieser Landschaft, die ich nach manchen Ihrer Zeichnungen aus Algier wiederzuerkennen meinte.“ Von der modernen Architektur Zions wusste Posener jedoch nur Enttäuschendes zu berichten: „In Tel Aviv drängen sich die Mietshäuser auf Grundstücken von 15 mal 50 m, gehen auf enge, staubige Straßen hinaus; aber all dies ist ‚modern’. Eckfenster, Betonplatten zum ‚Schutz’ von ich weiß nicht was, allenfalls zum Schutz der ästhetischen Theorien ihrer Architekten; zu breite, zu niedrige Fenster, brutale Öffnungen, durch die das Licht abrupt in die Schlafzimmer fällt, statt wie in Frankreich durch irgendeine ‚Vorrichtung’ zwischen der Lichtquelle und dem Inneren gefiltert zu werden. Beim Anblick eines Hauses kann man sagen: Dein Architekt hat 1926 Stuttgart (oder Breslau) verlassen. Er ist bei diesem letzten Schrei von vorgestern geblieben. Er hat nie geahnt, dass Palästina nicht Schlesien ist und dass es bei gewissen Problemen der Architektur seit 1926 einen Fortschritt gegeben hat.“ Posener bezieht sich hier vermutlich auf die beiden Werkbund-Ausstellungen in Stuttgart-Weißenhof von 1927 und Breslau von 1929 oder möglicherweise auf die beiden Warenhäuser, die Mendelsohn 1927 bzw. 1928 in Stuttgart und Breslau fertigstellte. Man meint überhaupt aus seinen Sätzen Mendelsohn herauszuhören, der nie einen Hehl aus seiner ablehnenden Meinung über die deplazierten Kopien schlechter europäischer Moderne in Tel Aviv machte. Allerdings war es auch der Abfall aus seiner eigenen Formelwerkstatt – die dynamischen Ecklösungen und Treppenhäuser – die er in Tel Aviv wiederfand. Das kränkte ihn, eben weil die Nachahmung möglich war. Er selbst meinte, man müsse in Palästina anders bauen und predigte eine Synthese aus „östlicher Weisheit und westlichem Wissen“, von der er meinte, sie sei „ein Betätigungsfeld, das dem ganzen Land mehr zugute kommt und menschenwürdiger ist als aller nationalistischer Übermut.“ Die neue jüdische Hauptstadt empfand er als Fremdkörper: „Tel Aviv schneidet sich selbst vom arabischen Hinterland ab und entwickelt sich zu einem hundertprozentig jüdischen Geschäftszentrum mit einem eigenen Hafen, eigener Sprache, eigener Kleidung. Es wird zu einer Enklave inmitten der arabischen Welt, die eine Vereinigung anstrebt.“
Mendelsohn gab seiner negativen Haltung gegenüber der rein westlich ausgerichteten Metropole Tel Aviv Ausdruck durch die Wahl seines eigenen Domizils: Er bezog eine alte arabische Windmühle in Jerusalem. In seiner Architektur versuchte er über die Verarbeitung von Elementen aus der lokalen Bautradition seine propagierte Ost-West-Synthese umzusetzen. Posener bemerkte dazu, Mendelsohn habe sich – ganz wie einige andere seiner Jerusalemer Architektenkollegen – in die arabische Architektur verliebt. Seine Bauten in Palästina bewertete er letztlich als hybride Strukturen.
Im Rückblick hat Posener seine Meinung über die Tel Aviver Moderne revidiert. Er beurteilte sie weitaus positiver als noch in seinem Corbusier-Brief. Dazu mögen ihm seine Erfahrungen als Chefredakteur von HaBinjan verholfen haben, die ihm eine Innenansicht gewährten. Wenn er in späteren Jahren über die moderne Architektur sprach, die damals in der jungen Mittelmeermetropole entstand, so verwies er gerne auf die glückhafte Fügung, die die Neueinwanderer aus Deutschland und Mitteleuropa mit dem Neuen Bauen verband, und unterstrich dies stets durch eine Geste sich ineinander verschränkender Finger. Er meinte damit, dass zwischen den Flüchtlingen und der vom Faschismus diskreditierten Moderne so etwas wie eine gegenseitige Solidaritätserklärung in einer neuen Heimat entstand. Und dass die modernen Bauten in Palästina – wie die Migranten – gleichsam von Europa zu ihrem Ursprung, zu ihren mediterranen Wurzeln zurückgeführt wirkten.
Zweifellos gab der pragmatische Funktionalismus der modernen Architektur den Tel Aviver Architekten eine Art Leitlinie an die Hand, die sowohl wirtschaftlich adäquate als auch ästhetisch befriedigende Lösungen für den Aufbau des Landes und ihrer neuen Stadt parat hielt. Dass unter den äußeren Zwängen der in den Dreißigerjahren dramatisch ansteigenden Wohnungsnachfrage für Flüchtlinge und der technisch noch unterentwickelten Bauindustrie des Landes einige Errungenschaften und Qualitäten der Moderne auf der Strecke blieben, dürfte nicht weiter verwundern. So vermisst man vor allem bei den Innendispositionen der Wohnungen die revolutionären Ansätze des offenen Grundrisses eines Mies van der Rohe oder Le Corbusier.
Die zweckorientierte, rationale moderne Architektur passte ins Konzept einer zionistisch-sozialistischen Ideologie, die auf die Formung des Neuen Menschen, den Neuen Israeli, abzielte. Ihn galt es aus der multikulturell geprägten Masse der einwandernden Diaspora-Juden herauszuschälen bzw. neu zu erschaffen. Traditionelle ethnische Kulturwerte des Judentums spielten dabei keine Rolle, sie wurden im Gegenteil bekämpft. Präexistierende Identitätsmodelle bei Immigranten, seien sie nun jüdisch traditionell oder westlich bourgeois geprägt, sollten aufgelöst werden. Gegen die in den Zwanzigerjahren noch vorherrschende eklektizistische Vielfalt setzte das sichtlich geschichts- und traditionslose Neue Bauen eine kulturelle Neutralität, die sich beim Aufbau einer neuen Gesellschaft als gemeinsamer Nenner für alle Einwanderer instrumentalisieren ließ. Anders ausgedrückt: Der zionistischen Vorstellung eines nationalen Neubeginns am Punkte Null kam die ästhetische tabula rasa der Moderne entgegen. Eine Architektur, die sich lediglich an Zweckmäßigkeit orientierte, konnte den Beginn einer neuen Entwicklung markieren, die alle Beteiligten gleichschaltet und eine Basis für eine neue soziale und nationale Identität schafft. Die White City of Tel Aviv wurde zum Sinnbild des nationalen Neuanfangs.
Mit ihrer Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste wurde sie als erfolgreiches Modell gekürt. Dies ist in erster Linie der lokalen Denkmalpflege zu verdanken. Über jahrelange wissenschaftliche Recherche und Dokumentation hinaus leistete sie harte Überzeugungsarbeit bei den örtlichen Entscheidungsträgern gegen eine Politik der Abrissbirne. Nur allmählich konnte ein öffentliches Bewusstsein geschaffen werden, das nicht allein archäologische Funde aus der Zeit König Davids und Salomons als erhaltenswert ansieht, sondern sich der Erkenntnis öffnet, dass das moderne Israel selbst bereits schützenswerte Kultur vorzuweisen hat.
Die Wertschätzung des physischen, des baulichen Erbes ist in Israel eine relativ junge Entwicklung, die vielfach noch in den Kinderschuhen steckt. Wenngleich die Vergangenheit im Judentum grundsätzlich ein Gegenstand der Verehrung ist, so ist die traditionelle jüdische Geschichtsform das Buch – das, was Heinrich Heine das „portative Vaterland“ nannte. Im modernen Israel sind nun Bauten, Siedlungen und ganze Stadtviertel Beleg seiner neuen nationalen Geschichte, seiner Errungenschaften, wie immer man sie bewerten mag, und stehen als Dokumente und Basis eines neuen reflexiven Selbstverständnisses zur Verfügung. Das neue Erbe ist materiell, physisch, das heißt, die neuen Kapitel des großen Buches jüdischer Geschichte sind haptischer Natur – verortet und anfassbar. So heißt eine vor einigen Jahren für den Schulunterricht entwickelte Broschüre der relativ jungen Disziplin der Denkmalpflege in Israel nicht zufällig: „Die Vergangenheit berühren und für das Morgen erhalten.“ Allein die Tatsache, dass der moderne Staat Israel inzwischen ein gebautes kulturell schützenswertes Erbe vorzeigen kann und damit auch ein neues kollektives Gedächtnis schafft, symbolisiert den Anfang einer weiteren Phase innerhalb seiner modernen Geschichte. Für Israels junge Generation, die nach anderen Legitimationsstiftern als Holocaust und Bibel verlangt, bedeutet die Aufnahme der White City of Tel Aviv in die Welterbeliste einen wichtigen Schritt zur Normalisierung des Staates, der ihn als vergleichbar, weil an seinen eigenen Leistungen messbar, und damit gleichwertig in die internationale Völkergemeinschaft aufnimmt. Der israelischen Denkmalpflege steht nun die vielleicht schwerste Aufgabe bevor, denn mit der Annahme der Eintragung als universelles Kulturgut sind konservatorische Auflagen in Verantwortung der Welt gegenüber verknüpft. Hintergrund, Mi., 2008.03.26
26. März 2008 Ita Heinze-Greenberg
Zum Anteil österreichisch-jüdischer Architekten am Aufbau Palästinas
Als Theodor Herzl 1896 mit seiner Aufsehen erregenden Publikation „Der Judenstaat“ an die Öffentlichkeit trat , stieß er insbesondere bei den Wiener Juden auf wenig Gegenliebe für seine zionistischen Utopien. Obwohl sich gerade in Wien, verwiesen sei auf den Aufstieg der Christlichsozialen unter Karl Lueger, ein immer aggressiver agierender Antisemitismus breit machte, der – neben der Affäre Dreyfuss in Paris – einer der Auslöser für Herzls Ideen war. Ungeachtet aller Ausfälle der Antisemiten stand die Wiener assimilierte Judenschaft Herzls zionistischer Bewegung äußerst skeptisch bis ablehnend gegenüber. Symptomatisch für diese Haltung ist Karl Kraus’ berühmtes Pamphlet „Eine Krone für Zion“, das er 1898 als vehemente Absage an Herzls „Judenstaat“ publizierte. Dem entsprechend war auch die Situation unter den jüdischen Architekten in Wien. Viele hatten ihrer Glaubensgemeinschaft den Rücken gekehrt und waren nicht selten mit Nichtjüdinnen verheiratet, manche von ihnen waren auch Bürogemeinschaften mit Nichtjuden eingegangen. Erst die Ereignisse des Jahres 1938, als nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland in Wien eine schreckliche Judenhetze ausbrach, erwiesen sich die Illusionen der Assimilanten (manche waren sich gar nicht mehr bewusst, dass sie für die Nazis als Juden galten) als gescheitert. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Anteil österreichischer Juden am Aufbau Palästinas ein relativ geringer war. Es waren nur wenige, die sich für den Zionismus engagierten, obwohl deren Beitrag zum Teil durchaus bemerkenswert ist.
Ungeachtet der oben dargelegten skeptischen Haltung vieler Wiener Juden gegenüber dem Zionismus, gehörten zwei Architekten zu den unmittelbaren „Gründervätern“ Palästinas, die in engem persönlichen Kontakt mit Theodor Herzl ihre Pläne für ein zu errichtendes Zion entwickelten. Allen voran Oskar Marmorek (Skala/Galizien 1863 – Wien 1909), der Herzl bereits 1895 – noch vor der Drucklegung des „Judenstaates“ – in Paris kennengelernt hatte und neben Max Nordau zu den Gründungsmitgliedern der zionistischen Organisation gehörte. Der aus Galizien stammende Marmorek hatte sich nach seinem Studium am Wiener Polytechnikum anfangs vor allem mit spektakulären Ausstellungsbauten (darunter die berühmte Schau im Wiener Prater „Venedig in Wien“, 1895) einen Namen gemacht. Aus Unzufriedenheit über das Konkurrenzwesen in Österreich hatte er sich auch kurzfristig als Herausgeber der Architekturzeitschrift „Concurrenzen und Neubauten“ betätigt, wo er sich insbesondere für die aufkommende Moderne, wie sie von Otto Wagner und dessen Schülern propagiert wurde, engagierte. Dieser Ausrichtung der frühen Wiener Moderne entsprach auch weitgehend Marmoreks späteres architektonisches Werk, das großteils in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entstand und vor allem Mietshäuser umfasste (darunter das Wohn- und Geschäftshaus, „Rüdiger-Hof“, Wien 5, Hamburger Straße 20, 1902).
Er und sein Bruder Alexander (1865-1923), der als Bakteriologe in Paris lebte, freundeten sich bald mit Herzl an und wurden in der Folge zu glühenden Verfechtern des Zionismus. Als Mitarbeiter der Zeitschrift „Die Welt“, des Zentralorgans der zionistischen Organisation, veröffentlichte Oskar Marmorek, nach einer Aufforderung Herzls, 1897 unter dem Übertitel „Baugedanken für Palästina“ zwei Artikel, die sich mit der Architektur des künftigen Judenstaates befassten: „Der Tempel“ und „Das Bauernhaus“. Die beiden Aufsätze, die sich sehr theoretisch mit Stil- und Funktionsfragen auseinandersetzten, zeigen jedoch, wie sehr Marmorek als Kind seiner Zeit argumentierte. Analog dem Postulat der „Modernen“ rund um Otto Wagner, die den Bruch mit dem Historismus und eine „Naissance der Baukunst“ anstrebten, forderte auch Marmorek, dass die Juden „nicht eine Wiederhervorzerrung der alten, ihrer Zeit entsprechenden, nun aber längst überholten todten (sic) Form (in der Architektur) erstreben“ sollten. Generell waren die beiden Artikel jedoch eher allgemeiner Natur, dennoch scheinen sie eine gewisse Resonanz in jüdischen Kreisen ausgelöst zu haben. In einem neuerlichen Angriff auf Herzl und dessen zionistische Ideen fühlte sich Karl Kraus bemüßigt, dessen „Luftschlösser von Zion, erbaut von Herrn Marmorek“ spöttisch ins Visier zu nehmen. Herzl selbst setzte dahingegen Marmorek mit der Figur des Architekten Steineck in seinem Roman „Altneuland“ ein Denkmal.
Dessen ungeachtet war es Marmorek jedoch nicht vergönnt tatsächlich ein Projekt in Palästina zu realisieren. 1903 nahm er als Bausachverständiger an einer Expeditionsreise nach El Arisch auf der Halbinsel Sinai teil, um die Möglichkeiten einer Besiedlung dieser Gegend zu erkunden, und in diesem Kontext begann er sich mit einem Plan für eine Hafenanlage zu befassen. Aufgrund von Bewässerungsproblemen wurde die Idee der Besiedlung dieser Gegend jedoch bald aufgegeben. Auch das von Marmorek 1909 in Angriff genommene Projekt der Errichtung eines Technikums in Haifa wurde nicht weiter verfolgt. Noch im April desselben Jahres beging Marmorek Selbstmord am Grab seines Vaters. Depressionen, Krankheit und eine schlechte Auftragslage dürften die Ursache für diese Tragödie gewesen sein.
Konkreter hingegen ist der Beitrag des anderen „Gründervaters“ Wilhelm Stiassny (Pressburg 1842 – Bad Ischl 1910). Der eine Generation ältere Stiassny stand in einer Art von Lehrer-Schüler Verhältnis zu Marmorek, der in seinen Anfängen in seinem Büro gearbeitet hatte. Im Gegensatz zu Marmorek zählte Stiassny jedoch zu den meistbeschäftigten Architekten Wiens im ausgehenden 19. Jahrhundert. Außer einer Unzahl von Mietshäusern hat er auch Schulen, Spitäler, Fabriken und insbesondere eine Reihe von Synagogen errichtet. Neben seiner äußerst fruchtbaren architektonischen Tätigkeit bekleidete Stiassny nahezu dreißig Jahre (1878-1910) die Funktion eines Wiener Gemeinderates und war maßgeblich am Ausbau der Wiener Infrastruktur beteiligt. Darüber hinaus war er ein engagiertes Mitglied der Wiener Kultusgemeinde, wo er neben seiner Zuständigkeit für das Bauwesen sich insbesondere um soziale Anliegen kümmerte. Auf seine Initiative ist auch 1895 die Gründung des Jüdischen Museums in Wien zurückzuführen – damals das erste seiner Art in Europa.
Stiassny, der stets für ein selbstbewusstes Judentum eingetreten war, hatte sich schon lange mit Palästina befasst und auch an diversen Publikationen über das Land mitgearbeitet. Höchstwahrscheinlich kam er über die Vermittlung von Marmorek mit Theodor Herzl in Kontakt und wurde in der Folge zu einem engagierten Mitstreiter für die Anliegen des Zionismus. Bereits 1897 beim
1. Zionistenkongress in Basel gehörte Stiassny dem „Engeren Aktionskomitee“ an (dem eigentlichen Exekutivorgan der Bewegung). Während Herzl aber eher auf der politischen Ebene agierte, engagierte sich Stiassny unmittelbar für die Besiedlung Palästinas. 1904 gehörte er daher zu den Mitbegründern des „Jüdischen Kolonisationsvereines“ und hielt auch in der Folge mehrere Vorträge zu diesem Thema. Als das Palästina Amt in Jaffa 1908 die beiden Wiener Architekten Marmorek und Stiassny zur Erstellung eines Bebauungsplanes für die Siedlung Achusat Bajit um die Zusendung von Fachliteratur ersuchte, schickte Stiassny nicht nur eine Reihe von Schriften zu dieser Thematik, sondern äußerte auch seine Bedenken, dass Laien mit dieser schwierigen Aufgabe überfordert sein könnten. Offenbar als Konsequenz dieser Situation bot er sich an, kostenlos einen Bebauungsplan zu erstellen, und ersuchte um die Zusendung der entsprechenden Unterlagen. Nicht zuletzt hatte sich Stiassny im Rahmen seiner langjährigen Wiener Bautätigkeit, die oftmals ganze Viertel umfasste, wie insbesondere das sogenannte „Textilviertel“ im 1. Bezirk (die Gegend zwischen Schottenring und Franz Josefs-Kai) oder eine Villenkolonie in Ober-Döbling (Wien 19, Reithlegasse) große Erfahrung auf diesem Gebiet angeeignet. Als Stiassnys Entwurf schließlich im Mai 1909 in Jaffa ankam, waren in der Zwischenzeit jedoch bereits drei weitere Entwürfe angefertigt worden, und man hatte sich in der Folge auf einen definitiven Bebauungsplan geeinigt. Trotz seiner Nachfrage wurde Stiassny in Wien nicht über diese Situation informiert, was umso tragischer war, als er im Jahr darauf verstarb.
Stiassny hatte in seinem Entwurf auf Basis des Bauprogramms, das eine Wohngemeinde von rund 60 Einfamilienhäusern mit Gärten, Parkanlagen und einer Bildungsstätte im Zentrum vorsah, die damals aktuellsten Tendenzen verarbeitet, insbesondere die Gartenstadtidee von Ebenezer Howard. Eine mit Bäumen gesäumte Hauptstraße, an der auch die Geschäfte situiert sein sollten, hätte die Siedlung mit der wichtigsten Verkehrsroute von Jaffa nach Jerusalem verbinden sollen. Senkrecht dazu war eine Grünzone mit Gärten vorgesehen, die die Gemeinschaftsbauten, wie Schule und Synagoge, umgab. Die übrige Fläche war durch ein Rastersystem unterteilt, wobei die einzelnen Grundstücke jeweils für ein Einfamilienhaus mit Garten gedacht waren. Stiassny hatte dafür drei verschiedenen Haustypen entworfen, deren kubische Formen sich an lokalen Vorbildern orientierten.
Der tatsächliche Ausführungsplan von Achusat Bajit wurde schließlich aus verschiedensten Ursachen zu einer Kompilation aller vier Entwürfe – einschließlich Stiassnys – und musste vor allem auch aufgrund der topografischen Situation mehrfach abgeändert werden. Insbesondere der Umstand, dass eine mit lockerem Sand aufgefüllte Schlucht nicht bausicher war und hier eine lang gestreckte Parkanlage angelegt werden musste (später Boulevard Rothschild), führte dazu, dass das schließlich realisierte Projekt mit einer lang gezogenen Hauptachse und einer grünen Querachse in seiner Grundstruktur weitgehend Stiassnys Konzept entsprach. Darüber hinaus kamen auch im Einzelfall Stiassnys Typenhäuser zur Anwendung, so dass letztlich vieles von seinen Vorstellungen bei der Realisierung Eingang fand. Achuzat Bajit wurde bald zu einer mustergültigen wohlhabenden Vorstadt von Jaffa. 1910 wurde die Siedlung in Tel Aviv umbenannt und bildet bis heute das Herzstück der Stadt.
Unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg kam dann im Rahmen einer größeren Einwanderungswelle eine jüngere Generation von Architekten nach Palästina, die sich am Aufbau beteiligten. Darunter der aus Wien stammende Jakob (auch Jakov oder Jacques) Ornstein (Wien 1885 – Tel Aviv 1953). Nach einem Studium an der Wiener Technischen Hochschule, das er 1908 abschloss, arbeitete er als Bauingenieur bei der Bahn in Wien und Innsbruck. Während des Ersten Weltkrieges eingerückt, war er nach dem Krieg mit einigen Projekten für Wien befasst, um schließlich 1920 nach Palästina auszuwandern. Nachdem er in der neuen Heimat nach anfänglichen Schwierigkeiten Fuß gefasst und eine Anstellung in einem großen Baubüro gefunden hatte, konnte er seine Familie aus Wien nachkommen lassen und bald ein eigenes Atelier aufmachen. In der Folge errichtete er in den späten 1920er Jahren mehrere Wohn- und Bürohäuser und auch einige Kinos in Tel Aviv. Charakteristisch für diese Periode Ornsteins war die Tendenz zu einem betonten Dekorativismus (Katinsky House, 41 Nachalat Binyamin Street). Wieweit hier noch die Einflüsse seiner Wiener Jahre eine Rolle gespielt haben, sei dahingestellt.
Mitte der 1930er Jahre ging Jakob Ornstein eine Bürogemeinschaft mit dem wesentlich jüngeren Salomon Liaskowsky ein. Infolge der guten Baukonjunktur konnten sie innerhalb kurzer Zeit eine Reihe von Büro- und Wohnhäusern in Tel Aviv errichten, wovon viele heute allerdings nicht mehr erhalten sind. Zu ihren wichtigsten Bauten zählen das Hotel Orient (2-4 Harakvet Street, 1935), das Haus Poliashuk (62 Allenby Street, 1934) und vor allem das Haus Recanati (35 Menahem Begin Street, 1935). Im Gegensatz zu den früheren Realisationen Ornsteins orientierten sich diese Projekte an den damals aktuellen Tendenzen des „Neuen Bauens“, die seit der 1933 einsetzende Einwanderungswelle von deutschen Architekten, die vor der NS-Herrschaft geflohen waren, ins Land gebracht worden waren. Bis dahin hatte ja eine Art von späthistoristischer Kolonialarchitektur das Stadtbild von Tel Aviv geprägt. Die essentiellen Kriterien dieser neuen Architektur waren funktionalistische, ornamentfreie Bauten mit Flachdächern, wobei der elaboriert gestaltete Baukörper – oft unter Einsatz von kurvilinearen Formen – selbst zum ästhetischen Ausdrucksträger wurde. Dieser Ausrichtung folgte auch der vielleicht bemerkenswerteste Bau von Ornstein&Liaskowsky, das Haus Recanati, das mit seiner gestaffelten – von vorschwingenden Balkons geprägten – Fassade offenbar nicht zufällig von dem 1931 in Berlin errichteten Shell-Haus von Emil Fahrenkamp beeinflusst war. Die Bautätigkeit Ornsteins kam jedoch Ende der 1930er Jahre infolge des von den Briten verhängten Einreiseverbots und der damit verbunden Stagnation des Ausbaus von Tel Aviv weitgehend zum Erliegen. In seinen letzten Jahren engagierte er sich vor allem in diversen jüdischen Organisationen und hatte unter anderem die Präsidentschaft der „Association of Immigrants from Austria“ inne.
Schließlich ist noch auf Paul Engelmann (Olmütz 1891 – Tel Aviv 1965) hinzuweisen, der vor allem in kulturgeschichtlicher Hinsicht zu den bedeutendsten Persönlichkeiten zählt, die, aus Österreich (bzw. der Donaumonarchie) kommend, in den 1930er Jahren in Palästina tätig waren. Engelmann, der in Wien an der Technischen Hochschule studiert (allerdings ohne korrekten Abschluss) und die Bauschule bei Adolf Loos besucht hatte, gehörte zum innersten Kreis der Wiener Moderne der vergangenen Jahrhundertwende. Als Schüler von Adolf Loos und zeitweiliger Mitarbeiter von Karl Kraus’ Zeitschrift „Die Fackel“ war er in großem Maße von deren ethischen und ästhetischen Vorstellungen geprägt. Noch während des Ersten Weltkrieges kam Engelmann, der auch schriftstellerisch tätig war und sich mit philosophischen Fragen beschäftigte, im Rahmen eines philosophischen Zirkels mit Ludwig Wittgenstein in Kontakt. Auf dessen Empfehlung erhielt er auch seitens der Familie Wittgenstein Aufträge zum Umbau und der Einrichtung ihrer Sommervilla und ihres Stadtpalais in Wien (beide Gebäude existieren nicht mehr) und wurde in der Folge zu einem engen Vertrauten der Familie. Im Rahmen dieser Kontakte ergab es sich, dass Paul Engelmann ab 1925 auch mit den Planungsarbeiten für eine Stadtvilla für Margaret Stonborough, die Schwester Ludwig Wittgensteins, beauftragt wurde. Im Zuge der äußerst komplizierten Baugeschichte des Projektes schaltete sich zuletzt auch Ludwig Wittgenstein selbst in das Vorhaben ein und fertigte auf Basis von Engelmanns Entwürfen die endgültigen Pläne aus. Die schließlich in den Jahren 1927/28 realisierte Stadtvilla (Wien 3, Kundmanngasse 19), die zweifellos auch sehr den Ideen von Adolf Loos verpflichtet war, ist unter dem Namen „Wittgensteinhaus“ als einer der bedeutendsten Bauten der klassischen Moderne in die Architekturgeschichte eingegangen und bis heute Thema zahlreicher Studien, sei es architektonischer oder philosophischer Natur.
Engelmann, der sich schon sehr früh für den Zionismus begeistert hatte, wollte eigentlich schon Mitte der Zwanzigerjahre nach Palästina auswandern und weckte mit diesem Vorhaben auch das Interesse Wittgensteins. Infolge mehrerer Bauaufträge (neben dem Wittgensteinhaus in Wien konnte er vor allem einige Wohnhäuser in Mähren realisieren) musste er dieses Vorhaben jedoch verschieben und kam schließlich erst 1934 nach Palästina, wo er sich in Tel Aviv niederließ. Obwohl die Voraussetzungen relativ gut waren und die Stadt durch eine neuerliche Zuwanderungswelle in diesen Jahren einen Bauboom erfuhr, arbeitete Engelmann, der sich lieber seinen Studien und der schriftstellerischen Tätigkeit hingab, nur fallweise – wenn er gerade Geld benötigte – als Architekt. Dies erklärt sein relativ bescheidenes Œuvre aus diesen Jahren und seine weitgehende Beschränkung auf innenarchitektonische Aufgaben. Neben seiner Tätigkeit für Arthur Wachsbergers Firma „The cultivated home“, stattete er u. a. die Innenräume des King David Hotels, sowie den Touristen- und Presseclub in Jerusalem aus. Außerdem richtete er in Tel Aviv die Räumlichkeiten der Bank Hapoalim ein. Allerdings entstanden in dieser Zeit – in Zusammenarbeit mit Kurt Unger – auch einige größere Projekte, wie zwei Konkurrenzentwürfe für städtebauliche Wettbewerbe, darunter für einen Marktplatz in Haifa und ein Stadtzentrum von Neu-Akko. Tatsächlich zur Ausführung gelangten jedoch nur einige Einfamilienhäuser. Das einzige noch erhaltene Gebäude ist das Haus Yadlin in Haifa, das 1937/38 errichtet wurde. Engelmann passte hier die Ideen des Loos’schen Raumplanes an die klimatischen Verhältnisse an und orientierte sich formal – insbesondere mit dem halbzylindrischen Annex – an die damals gängige Architektur des „Neuen Bauens“. Was Engelmanns Bautätigkeit in Tel Aviv betrifft, so ist unter anderem ein Entwurf für das Haus eines Bankdirektors erhalten, der klassizierend mediterrane Motive aufweist, wie einen offenen Säulengang, der um einen atriumartigen Innenhof angeordnet ist. Es ist jedoch nicht geklärt, ob dieses Projekt zur Ausführung gelangte, so wie generell sein architektonisches Werk für die Stadt noch nicht zur Gänze aufgearbeitet ist.
Neben den hier angeführten Architekten, gab es noch einige, für die Palästina jedoch nur ein kurzes Intermezzo bedeutete. Insbesondere aufgrund der äußerst lückenhaften Quellenlage, die die Forschung auf dem Gebiet der Emigration ungemein erschwert (bis heute verlieren sich viele Spuren der aus Österreich vertriebenen Architekten im Nichts) ist es durchaus wahrscheinlich, dass das tatsächliche Ausmaß größer ist, als hier dargelegt.Hintergrund, Mi., 2008.03.26
26. März 2008 Ursula Prokop
Wozu brauchen wir ein Wiener Architekten-Lexikon?
Das städtebauliche und architektonische Erscheinungsbild Wiens wurde durch keine andere architekturhistorische Epoche so nachhaltig geprägt wie durch die prosperierende Phase zwischen 1850 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Während die Architektur dieser Zeit mit zum Teil markanten, zum Teil faszinierenden, vielfach jedoch auf den ersten Blick unscheinbaren und nur allzu vertrauten Objekten nach wie vor greifbar ist, sind die Architekten dieser Zeit zum überwiegenden Teil in Vergessenheit geraten bzw. vollständig hinter ihrem Werk verschwunden.
Viele Architekten der Donaumonarchie haben in dieser Zeit ihre Ausbildung in Wien erfahren und hier auch ihre ersten selbstständigen Arbeiten vorgelegt, ehe sie in anderen Regionen ihr häufig beeindruckendes Œuvre schufen. Auch diese Architekten sind ein wesentlicher Teil der Wiener Architekturgeschichte, zumal ihre Werke oftmals nachhaltig der vielgestaltigen Aufbruchstimmung verhaftet blieben, die aus der Überlagerung von Moderne und Späthistorismus resultierte, und die ihre Inspirationen immer wieder aus den Erfahrungen dieser frühen Wiener Jahre speisten.
Einen der „exotischsten Wege“ in dieser Hinsicht ist wohl Rolf Geyling gegangen, der an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner studierte. Nach einigen respektablen Aufträgen der Wiener Verkehrsbetriebe (z.B. Errichtung der Bediensteten-Wohnhäuser und des Betriebsbahnhofs Hernals) wurde er zum Dienst im Ersten Weltkrieg verpflichtet. Er geriet in russische Kriegsgefangenschaft, konnte jedoch einige Jahre später fliehen und schlug sich bis nach China durch, wo er erfolgreich Fuß fassen konnte. Dort plante Geyling nicht nur die Gesamtanlage sowie die erforderlichen Neubauten für den Ausbau des Badeortes Peitaiho, heute Beidehe, sondern projektierte auch in der nahe gelegenen Hafenstadt Tientsin, heute Tianjin, zahlreiche öffentliche Gebäude. Darüber hinaus schuf er Villen und Wohnhäuser und arbeitete verschiedene Großprojekte in ganz China aus.
Zu den vollständig „Vergessenen“ wiederum zählt etwa Richard Bauer, der an der Akademie der bildenden Künste bei Franz Kraus studiert hatte und nicht nur in der Werkbundsiedlung Wien 13 ein Doppelhaus realisierte, sondern mit der Planung der sogenannten „Erwerbslosensiedlung“ in Wien 21 ein bedeutendes Beispiel für Sozialbauprojekte schuf.
So manch anderem hingegen, den die (architektur)-historische Erinnerung gnädiger behandelt hat, wurde durch die Kunstgeschichtsschreibung übel mitgespielt. Gustav Korompay beispielsweise ist laut „Wiener Stadt- und Landesarchiv“ am 4.1.1833 geboren, während H. Kosel im „Deutsch-österreichischen Künstler- und Schriftsteller-Lexikon“ weiß, dass der 4.1.1838 der konkrete Geburtstag ist. Wer nun durch Nachschlagen etwa im „Allgemeinen Künstlerlexikon“ Klarheit in dieser Frage zu gewinnen sucht, wird nicht mit Gewissheit, sondern mit einem dritten Geburtdatum Korompays belohnt, nämlich dem 28.2.1833. Und auch Thieme-Becker sowie H. Fuchs („Die österreichischen Maler des 19. Jahrhunderts“) geben dem Datum 28.2.1833 als Geburtsdatum den Vorzug, während L. Eisenberg: („Das geistige Wien“) sich wiederum mit dem 4.1.1838 in den Reigen der Geburtstag-Spekulationen einreiht.
Allein diese wenigen Beispiele – Geylings unbekannter Weg nach China, das vergessene Œuvre Richard Bauers und die Konfusion um Gustav Korompays Geburtstag – zeigen, wie unvollständig und fehlerbehaftet die Forschungslage auf dem Gebiet der Architekturbiographien bisher war. Das seit dem Jahr 2005 erscheinende „Wiener Architektenlexikon 1880-1945“ (www.architektenlexikon.at), verfolgt deshalb den Anspruch, diesen Defiziten Abhilfe zu schaffen und bislang bestehende Lücken in der architekturhistorischen Aufarbeitung dieser Zeit zu schließen.
1. Wiener Architektenbiographien: eine Geschichte der Desiderate, Verwechslungen und unfreiwillig-komischen Irrtümer
Bislang wurde jegliche Forschung im Bereich der Architektur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts tatsächlich wesentlich erschwert durch die äußerst mangelhafte wissenschaftliche Aufarbeitung der Zeit zwischen 1880 und 1945. Nur wenige herausragende Persönlichkeiten – etwa die bekanntesten Ringstraßenarchitekten, vor allem aber die namhaftesten Vertreter der Schule Otto Wagners – sind in eigenen Monographien aufgearbeitet worden. Zahlreiche Baukünstler hingegen, die das späte 19. Jahrhundert hervorgebracht hat und deren Werke die Bundeshauptstadt bis heute prägen, aber auch wichtige Vertreter der Gemeindebau-Architektur sowie viele jener Architekten, die vor dem Nationalsozialismus fliehen mussten, blieben im Großen und Ganzen unberücksichtigt.
Dem stand eine erheblich gründlichere Dokumentation und Aufarbeitung der Bauwerke gegenüber, was nicht zuletzt Verdienst des von Friedrich Achleitner herausgegebenen Führers Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert ist. Ebenso verdeutlichen die Überarbeitung und Neuauflage der Dehio-Handbücher Die Kunstdenkmäler Österreichs, dass die Objektanalyse in Summe sehr viel weiter fortgeschritten ist als die Erhebung und synthetisierende Darstellung des biografischen Materials. Der Mangel an komplementären Nachschlagewerken zu den einzelnen Architektenpersönlichkeiten wurde aber um so deutlicher, als etwa schaffenstypischen Querbezügen innerhalb der Objektanalyse kaum in effizienter Art und Weise nachgegangen werden konnte und ein Überblick über das gesamte Tätigkeitsspektrum des jeweiligen Architekten vollends nicht leistbar war.
Häufig waren nicht einmal die Lebensdaten der Architekten bekannt –wie zum Beispiel von Adolf Ambor, der eine Reihe an repräsentativen Wohn- und Geschäftsbauten in Wien errichtete und der – was erschwerend dazukam – seinen Vornamen um 1904 auf Abraham geändert hatte. Häufig fehlten auch Aufschlüsse über die Ausbildung der Architekten, wie etwa im Falle von Josef Jaroslav Bayer, einem der zahlreichen Gemeindebau-Architekten, der ein Schüler Friedrich Ohmanns war. Auch eine Vielzahl unausgeführt gebliebener Objekte war auf Grund der mangelnden biographischen Forschung letztlich unbekannt, wie etwa der mit einem 2. Preis bedachte Entwurf für die Kaiser Franz-Josef Jubiläumskirche (Wien 2, Mexikoplatz, 1899) von Max Ferstel.
Wesentliche Informationen zu städtebaulichen Überlegungen blieben auf Grund der Dominanz der Objektanalyse ungenutzt, und zwar sowohl Informationen in Zusammenhang mit der Stadterweiterung Wiens als auch im Zusammenhang mit Stadterweiterungen bzw. Stadtregulierungsplänen in diversen Städten der ehemalige Kronländer, die von Architekten wie etwa von K.H. Brunner, A. Lotz, J. Hudetz, S. Sitte, E. Fassbender sowie von E. Egli angestellt wurden, der auch in der Türkei etliche Stadtregulierungspläne entwickelte. Auch zahlreiche architekturtheoretische Publikationen über Wohnungsbau, über Denkmalpflege, über das Arbeiter-Wohnungswesen, über das Siedlungswesen, über Wasserkraftwerke und Industriebauten etc., waren, da sie als Artikel in den damals in großer Zahl erscheinenden Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, nur schwer auffindbar. Auch zur Dauer und Wirkung von Lehrtätigkeiten weniger bekannter Architekten gab es kaum Angaben, wie etwa zu E. Ilz, der Professor für Städtebau an der Technischen Hochschule Wien war, oder zu Norbert Schlesinger, der an der Hochschule für angewandte Kunst die Meisterklasse für Architektur leitete.
Für zahlreiche Fragestellungen war daher nach wie vor das Künstlerlexikon unverzichtbar, das ab dem Jahr 1907 in 37 Bänden von Thieme-Becker herausgegeben worden war (Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart). So verdienstvoll dieses Unterfangen bleibt, ist dieses Lexikon auf Grund des damaligen Wissensstandes zum Teil doch lückenhaft geblieben, zum Teil müssen seine Einträge aber auch schlichtweg als fehlerhaft bezeichnet werden. Trotzdem finden sich die aus diesem Werk gewonnenen Daten noch heute in vielfältigen Zusammenhängen verarbeitet, das heißt die darin unterlaufenen Fehler und Ungenauigkeiten werden bis heute reproduziert.
Das gleiche gilt für die Daten bezüglich der Architekten der Frühen Moderne: Zwar hat Marco Pozzetto eine hilfreiche und dankenswerte Zusammenstellung der Wagner-Schüler unternommen, doch auch ihm unterliefen Fehler oder Ungenauigkeiten, die nunmehr in einschlägigen wissenschaftlichen Arbeiten fortgeschrieben werden.
Das Österreichische Biographische Lexikon (Wien ab 1957) ist bis heute nicht abgeschlossen, und darüber hinaus finden sich in den bisher erschienenen Bänden nur wenige Architekten aufgenommen. Das Österreichische Künstlerlexikon (Wien 1979) wiederum wurde nach Erreichen des Buchstabens D überhaupt eingestellt.
Aber auch jüngere Werke – wie etwa das im Jahr 2005 von H. Weihsmann herausgegebene Lexikon der Wiener Architekten des 20. Jahrhunderts „In Wien erbaut“ – konnten hier keine Abhilfe schaffen. Im Gegenteil hat Weihsmanns Werk sogar so manche falsch tradierte Faktenlage um zusätzliche irrige Angaben bereichert und mit einer Vielzahl an ungenau recherchierten oder frei erfundenen Daten sowie einer Unmenge an Verwechslungen zur zusätzlichen Verwirrung der Forschungslage beigetragen. So wird etwa – um nur einige wenige Beispiele zu nennen – der Architekt Alois Augenfeld zu Anton, der Kriegsgefangene Rudolf Perco zum Spion und der Ort Kladno wird von Tschechien nach Polen transferiert. Adolf Stöger wird zum Vater seines Bruders Karl ernannt, und die Werke von Gustav und Franz Neumann werden ebenso verwechselt wie etwa bei Albert Pecha das 50-jährige Regierungsjubiläum des Kaisers mit der Jubiläumsausstellung in Wien.
Paradoxerweise unterstreicht daher gerade diese jüngste Publikation die Notwendigkeit eines seriös erarbeiteten Wiener Architektenlexikons.
2. Werdegang und Leistungen des „Wiener Architektenlexikon 1880-1945“
Für ein neu zu erstellendes Architektenlexikon galt es daher, einerseits Informationen zu bislang gar nicht oder nur mangelhaft aufgearbeiteten Architektenpersönlichkeiten zugänglich zu machen, andererseits waren aber auch Lücken innerhalb der Biografien und Werkgeschichten von an sich bereits erfassten Persönlichkeiten zu schließen. Nicht zuletzt galt es, fehlerhafte Feststellungen sorgfältig zu korrigieren bzw. überholte Forschungsergebnisse zu revidieren.
Da solch ein Projekt nur mit Hilfe einer renommierten Institution leistbar ist, wurde zunächst bei einer universitären Stelle um Unterstützung angefragt. Dort hat man zwar versichert, dass solch ein Lexikon ein Desideratum darstelle, dass aber trotzdem kein Interesse bestehe, dieses Projekt zu unterstützen. Es ist deshalb das große Verdienst von Dietmar Steiner, Leiter des Architekturzentrum Wien, dass er nicht nur die Bedeutung dieses Projekts erkannt, sondern vor allem auch seine Unterstützung spontan zugesagt hat. Unter seiner Federführung wurde das Projekt beim FWF (Fonds für wissenschaftliche Forschung) eingereicht, wo das Projekt in weiterer Folge mit einer beachtlichen Dotierung für die Projektdauer von insgesamt vier Jahren bewilligt wurde. Dietmar Steiner veranlasste weiters die Einrichtung einer Datenbank, womit das Architektenlexikon seit dem Jahr 2005 auf der Homepage des Az W sukzessiv und kostenlos zur Verfügung gestellt werden konnte. Mittlerweile haben 13 Personen wissenschaftlich am Projekt mitgearbeitet, wobei die einzelnen Beiträge im Lexikon jeweils namentlich gekennzeichnet sind. Dem derzeitigen wissenschaftlichen Team gehören Ursula Prokop, Jutta Brandstetter, Dagmar Herzner-Kaiser, Petra Schumann sowie Inge Scheidl als Projektkoordinatorin an.
Es stellte sich heraus, dass in der Zeit zwischen 1880 und 1945 nachweislich mehr als 1200 Architekten tätig waren. Viele von ihnen erbauten lediglich ein Wohnhaus oder eine Villa und traten sonst im Baugeschehen Wiens nicht mehr fassbar in Erscheinung. Es wurden daher nur jene Architekten erfasst, die in Wien erwiesenermaßen mehrere Projekte oder zumindest ein öffentliches Monumentalgebäude realisieren konnten, aber auch solche Architekten, die vorwiegend in anderer Hinsicht, etwa als Lehrer oder Theoretiker, wirksam waren. Auf Grund dieser Auswahl sind neben den in historistischer Manier bauenden Architekten auch die Architekten der Frühen Moderne sowie der Zwischenkriegszeit repräsentativ vertreten.
Die Lexikoneintragungen umfassen neben den Geburts- und Sterbedaten, dem familiären Umfeld, der Ausbildung, Mitgliedschaften, der Auflistung der Werke, Literaturangaben etc. eine ausführliche Darstellung des Lebenslaufes („Vita“) sowie eine Analyse der Arbeitsweise des Architekten („Stellenwert“). Als besondere Serviceleistung erfolgt für alle Werke, die in der Literatur nur mit Abbildungen aufscheinen (meist Fachzeitschriften), eine genaue Quellenangabe mit exaktem Titel, Band, Jahrgang und Seitenangaben sowie die Angabe des entsprechenden Bauwerks. Darüber hinaus wird der Benutzer auf Fehler und Ungenauigkeiten in anderen Quellen hingewiesen.
Erstmals sind nun Architekten, die in zeitgenössischen Lexika bzw. Nachschlagwerken, aber auch in neueren Lexika mit äußerst mangelhaften Informationen dokumentiert sind, mit vollständigen Daten erfasst. So findet sich beispielsweise Arthur Baron (15.5.1874- 30.8.1944) im „Allgemeinen Künstlerlexikon“ nur mit der Angabe „tätig um 1903-1913“ verzeichnet, oder bei Adolf Ambor (28.3.1891-15.5.1912) wird – wiederum im „Allgemeinen Künstlerlexikon“– statt der Geburts- und Sterbedaten nur der allgemeine Hinweis „tätig A. 20. Jhd. in Wien“ angeführt.
Weiters konnten falsche bzw. in den diversen Quellen unterschiedlich angegebene Daten berichtigt werden, wie z.B. des bereits erwähnten Gustav Korompay (4.1.1833-17.2.1907) oder im Fall von Oskar Laske sen. (1842-16.11.1911), der mit inkorrekten Daten im „Biographischen Lexikon der böhmischen Länder“, im Thieme-Becker, in der „Wiener Bauhütte“ und bei Weihsmann aufscheint.
Wesentliche Missverständnisse und Unklarheiten waren vielfach – sowohl in älteren als auch in neueren Quellen – auf Grund von Namensgleichheiten entstanden. Im „Wiener Architektenlexikon 1880-1945“ ist es auf Grund der sorgfältigen Quellenforschung nun erstmals gelungen, etliche Zuschreibungen klärend zu ordnen. So wird etwa in der „Wiener Bauindustrie-Zeitung“ der Neubau der Universität in Graz von Karl Koechlin fälschlich Heinrich Koechlin zugeschrieben. Der von Heinrich und Karl Köchlin errichtete Bau der Staatsdruckerei wiederum wird von Wagner-Rieger (Wiens Architektur im 19. Jahrhundert) und im Dehio-Handbuch fälschlich nur Karl Koechlin zugeschrieben, während bei Thieme-Becker und Achleitner (Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert) fälschlich nur Heinrich Koechlin genannt wird.
Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Der Familienname „Ludwig“ taucht bei drei Architekten auf, von denen allerdings nur zwei miteinander verwandt sind. Dies führte zu etlichen Fehlschlüssen. M. Pozzetto gibt fälschlich Alois Ludwig als Bruder Josef Ludwigs an. Darüber hinaus wird ein weiterer „Ludwig“ eingeführt. In der Österreichischen Kunsttopographie, bei Achleitner und im Dehio-Handbuch wird Alois Ludwig mit Emil Ludwig (*26.7.1878 i. Wersdorf i. Mähren) verwechselt.
Auch die Frage, ob Franz Berger tatsächlich ein so großes Arbeitspensum zu leisten im Stande war, wie es sich in den Zuschreibungen diverser Quellen darstellt, konnte geklärt werden, da die Unterscheidung in Stadtbaudirektor Franz Berger, geb. 1841, und Landesbaudirektor Franz Berger, geb. 1853, getroffen werden konnte, während in der gesamten Sekundärliteratur die beiden als nur eine Person angegeben werden.
Schließlich konnte auch bei rund 900 Objekten, insbesondere Wohn- und Geschäftbauten sowie Villen, erstmals überhaupt die architektonische Urheberschaft geklärt werden. Zu diesem Zweck wurden u.a. erstmalig Nachlässe in Familienbesitz sowie Privatarchive erschlossen, wie z.B. der Nachlass Bruno Buchwieser sen. sowie der Nachlass von Anton und Josef Drexler. Auch Dr. Erich Schlöss und Msgr. Dr. Norbert Rodt stellten freundlicherweise ihre Privatarchive zur Verfügung.
3. Methodische Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher Mehrwert
Als Voraussetzung für qualitativ einheitliche Lexikoneintragungen wurde ein standardisierter Kriterienkatalog erstellt, mittels dessen die Recherche in Archiven, Nachlässen, in der Sekundärliteratur, den Fachzeitschriften u.ä. erfolgte. Zudem wurde eine lexikalische Matrix erarbeitet, in der die Rechercheergebnisse in schematisierten Abschnitten erfasst sind, sodass eine größtmögliche Übersichtlichkeit und Standardisierung hinsichtlich der wissenschaftlichen Auswertung der Quellen erzielt wurde.
Der historische Untersuchungszeitraum dieses Lexikons wurde ganz bewusst auf einen überschaubaren Radius eingegrenzt, da innerhalb von Lexika, die den Anspruch auf einen umfassenden zeitlichen oder internationalen Rahmen erheben, eine notgedrungen restriktive Auswahl wiederum zur Darstellung nur der bedeutendsten und meist ohnedies dokumentierten Künstler führt. Der gewählte zeitliche Bezugsrahmen von 1880 bis 1945 hat sich deshalb empfohlen, weil die Stadterweiterung in Wien im 19. Jahrhundert eine ungemein umfangreiche Bautätigkeit zur Folge hatte. Die frühe Moderne wiederum reicht nicht nur in ihren Ausprägungen und architektursoziologischen Konsequenzen bis in die Vierzigerjahre hinein, sondern auch personell werden die Entwicklungen vorwiegend von jenen Architekten getragen, die kurz nach der Jahrhundertwende mit ersten Studien und Arbeiten an die Öffentlichkeit traten.
Die räumliche Eingrenzung auf Wien erschien deswegen als sinnvoll, weil die ehemalige Donaumetropole und jetzige Bundeshauptstadt nicht nur auf Grund des Bauvolumens und der vielfältigen Aufgabenstellungen Architekten aus allen Regionen und Ländern der ehemaligen Monarchie anzog, sondern weil Wien als wichtige Universitätsstadt und Ort der Architektenausbildung auch Brennpunkt theoretischer Diskussionen und Auseinandersetzungen war und somit einen repräsentativen Querschnitt der architekturhistorischen Entwicklungen jener Zeit verkörpert. Mittelbar wird mit dem Architektenlexikon also auch die architekturhistorisch enge Beziehung Österreichs zu den Nachbarstaaten aufgehellt bzw. wird in weiten Bereichen eine Aufarbeitung dieser Verflechtungen damit überhaupt erst ermöglicht.
Auf Grund der neuartigen Qualität des Architektenlexikons ist nunmehr auch eine sukzessive Intensivierung des internationalen wissenschaftlichen Austausches und der wissenschaftlichen Kooperation (z.B. Kontakt zu Wissenschaftern in den USA, Frankreich, Deutschland, Schweiz) in diesem Forschungsfeld festzustellen. Insbesondere zu Wissenschaftern der ehemaligen „Kronländer“, d.h. den Ländern Osteuropas, entstanden enge Kontakte, und teilweise wurde auch eine Mitarbeit am Lexikon erzielt. So konnten etwa Jindrich Vybiral, Professor an der Kunstgewerbeschule Prag (zu Leopold Bauer), Marian Zgorniak und Tomasz Scybisty, beide von der Jagiellonen Universität in Krakau (zu Ignaz Sowinsky, Edgar Kovats und Karl Borkowski) als Gastautoren gewonnen werden. Darüber hinaus bestehen auch mit Institutionen im Inland, wie etwa dem Bundesdenkmalamt, fruchtbringende Wechselbeziehungen bei der Aufarbeitung spezifischer Fragen.
Zahlreiche Reaktionen aus dem In- und Ausland zeigen, dass das Lexikon mittlerweile auch international über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt und äußerst positiv aufgenommen wird. Diese positive Aufnahme half wiederum, neue, bislang unbekannte bzw. schwer zugängliche Quellen zu erschließen und die Wechselwirkung zwischen biographischer Forschung und Praxis damit qualitativ zu vertiefen. So verdankt das wissenschaftliche Team etwa Architekt Jan Schubert aus Krakau ergänzende Informationen zur Tätigkeit Hugo Mayrs in Westgalizien. Auch langten auf Grund der wachsenden Publizität des „Architektenlexikons“ neue und hilfreiche Informationen von noch lebenden – zum Teil jedoch weltweit verstreuten – Verwandten ein. Dem in Austin, USA, lebenden Physiker Franz Geyling sind nicht nur zahlreiche Informationen über seinen Vater Rolf Geyling zu verdanken. Er schenkte auch Originalpläne und sonstige Materialien seines Vaters dem Archiv des Architekturzentrum Wien. Aber auch Personen, die etwa über ein spezielles Werk eines Architekten forschten oder an einem Architekten in fachlich anderen Zusammenhängen interessiert waren, stellten mehrmals wertvolle ergänzende Hinweise zur Verfügung. Zum Beispiel forschte Maros Semancik speziell über ein Mausoleum von Emil Bressler in Horne Obdokovce, Slowakei, und es ergab sich in Folge ein interessanter Informationsaustausch.
Nicht zuletzt konnte mit dem Erscheinen und der kontinuierlichen Erweiterung des Architektenlexikons wohl auch das Kompetenzprofil des Architekturzentrum Wien als nationale sowie internationale Anlaufstelle für architekturgeschichtliche und architekturtheoretische Fragestellungen wesentlich gestärkt und erweitert werden. Dies zeigt sich in der stark zunehmenden Zahl an Anfragen, die das Az W auf Grund des Architektenlexikons als kompetente Auskunftsquelle erachten.
„Work in progess“
Seit Mai 2005 stehen die endredigierten Lexikoneintragungen auf der Homepage des Architekturzentrum Wien (www.azw.at oder www.architektenlexikon.at) kostenlos zur Verfügung. Als zusätzliches Service finden sich auf der Homepage neben der Auflistung sämtlicher Architekten, die in das Lexikon aufgenommen wurden, die Liste der Archive, Literaturlisten (Sekundärliteratur, Bildanthologien, Lexika, Nachschlagwerke, Fachzeitschriften) sowie die Geschichte der Wiener Ausbildungsstätten (z.B. Technische Hochschule, Staatsgewerbeschule).
Da das „Wiener Architektenlexikon 1880-1945“ als „work in progress“ konzipiert ist, werden die einzelnen Lexikoneintragungen durch ergänzende Forschungsergebnisse oder Falsifizierungen, die sich durch neue Informationen ergeben, fortlaufend auf den neuesten Wissensstand gebracht.
„Architektur“, so formuliert der Philosoph Jacques Derrida „ist die letzte Bastion der Metaphysik“. Mit dem „Wiener Architektenlexikon 1880 und 1945“ haben die Konstrukteure und Erbauer dieser „Bastionen“ zumindest eine Plattform erhalten, die sich ihren Biographien wissenschaftlich seriös und historisch exakt anzunähern sucht.Hintergrund, Mi., 2008.03.26
26. März 2008 Inge Scheidl