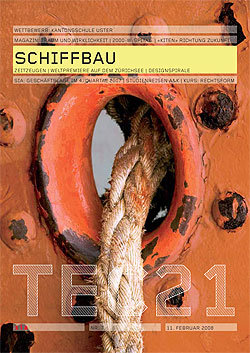Editorial
Kein Fahrzeug wird so stark personalisiert, ist emotional so stark aufgeladen wie Schiffe. Noch heute werden sie getauft, und vor nicht allzu langer Zeit trugen sie nicht nur individuelle Namen, sondern auch Galionsfiguren.
Schiffe werden nicht nur von klassischen Seefahrernationen gebaut. Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihre Leistungen im Schiffbau – vor allem, wenn es um Schiffsmotoren für Frachter und Tanker geht. 1889 wurde in Winterthur der erste Sulzer-Dieselmotor fertiggestellt. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Polytechnikum, der heutigen ETH Zürich, wurden in der Folge riesige Motoren entwickelt und weltweit exportiert. Seit 1992 werden unter dem traditionsreichen Namen Sulzer keine Motoren mehr gebaut. Ein Nachfolgeunternehmen führt die Produktion in Winterthur fort. An Schiffsantrieben geforscht und entwickelt wird weiterhin. Wichtige Innovationen kommen heute aus der Zulieferindustrie (Einspritzanlagen, Turbolader etc.).
Im vorliegenden Heft gibt Jürg Meister einen Überblick über die Geschichte des Schweizer Binnenfahrgastschiff-Baus. Lea Haller beschreibt eine historische Schweizer Innovation: die MS «Etzel» mit ihrem hydraulischen Verstellpropeller. Das Motorschiff wurde von Escher Wyss gebaut, die neben Motoren immer ganze Schiffe herstellten. Doch nach wie vor werden in der Schweiz neue Schiffe entwickelt – zwar nicht mehr in Zürich, aber in Luzern. Heute sind vor allem die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit ein wichtiger Faktor bei der Konstruktion, waren im Jahr 2007 doch insgesamt 13.6 Millionen Passagiere auf den Trinkwasserspeichern der Schweiz unterwegs – ein neuer Rekord. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) reagiert auf diese Entwicklung. Ihr «Kompetenzzentrum Schiffstechnik» will neue Schiffe für Kunden im In- und Ausland bauen. Der Leiter des Zentrums, Ruedi Stadelmann, beschreibt die spezielle Aufgabe des Schiffbauingenieurs, der von der Idee bis zur Probefahrt den Systemoptimierungsprozess leitet.
Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Kantonsschule Uster
12 MAGAZIN
Traum und Wirklichkeit | 2000-Watt-Spital mit Tiefgang | Basel fördert Gebäudesanierungen | «Kiten» Richtung Zukunft
18 ZEITZEUGEN
Jürg Meister
Viele schwimmende Zeitzeugen erzählen die Geschichte der maschinengetriebenen Schifffahrt in der Schweiz.
22 WELTPREMIERE AUF DEM ZÜRICHSEE
Lea Haller
Das Motorschiff «Etzel» war 1934 weltweit das erste Schiff mit einem hydraulischen Verstellpropeller. Es verkehrt auch heute noch auf dem Zürichsee.
25 DESIGNSPIRALE
Ruedi Stadelmann
Der Entstehungsprozess eines Schiffes ist komplex. Schiffbauingenieure suchen stets nach neuen Lösungen und orientieren sich dabei am Konzept der Designspirale.
32 SIA
Geschäftslage im 4. Quartal 2007 | Studienreisen A & K | Richtige Rechtsform
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Zeitzeugen
Die maschinengetriebene Schifffahrt in der Schweiz begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung lässt sich an vielen Zeitzeugen ablesen. Der Autor erzählt ihre Geschichte von 1823 bis heute.
Als Geburtsstunde der Dampfschifffahrt gilt – abgesehen von experimentellen Vorläufern und in Vereinfachung von gewissen historischen Detailversionen – das Jahr 1807. Damals wurde der noch krude, aber fahrtüchtige Raddampfer «Clermont» von Robert Fulton auf dem Hudson erfolgreich in Betrieb genommen. Dieses neue Verkehrsmittel hat sich in der Folge in den Vereinigten Staaten, vor dem Bau der Eisenbahnen, schnell weiterentwickelt. In Europa hat insbesondere das industriell weit fortgeschrittene Grossbritannien die neue Technologie übernommen und weiter perfektioniert. Bis zum ersten Dampfschiff in der Schweiz sollte es aber noch bis ins Jahr 1823 dauern.
Die Pioniere auf dem Genfer-, Neuenburger- und dem Bodensee
Der amerikanische Konsul in Frankreich, Robert Church, wunderte sich anlässlich eines Besuchs in Genf, dass auf dem Genfersee noch nichts von der Fulton’schen Errungenschaft zu sehen war. Er liess deshalb auf eigene Kosten bei der Firma Mauriac Père et Fils in Bordeaux ein hölzernes Schiff von rund 23 m Länge erbauen und bestellte in Liverpool eine passende Maschine. Das Schiff, der legendär gewordene Dampfer «Guillaume Tell» (der Name war wohl das Schweizerischste am ganzen Schiff), wurde am 18. Juni 1823 erfolgreich in Betrieb gesetzt (Bild 1). Der Durchbruch war geschafft. Diesem Pionierdampfer folgten in kurzen Abständen weitere, zunächst immer noch hölzerne Schiffe, die von Mal zu Mal etwas grösser, stärker und schneller waren. Die klassische Rivalität zwischen Genf und der Waadt trug das Ihre zur raschen Entwicklung der Dampfschifffahrt auf dem Genfersee bei, folgte doch einem Schiff des einen Heimathafens meistens unmittelbar ein anderes aus dem benachbarten Kanton. Nur wenig später hielt ein erstes hölzernes Dampfschiff mit dem Namen «Union» auf dem Neuenburgersee Einzug, und etwa gleichzeitig eroberte das neue Verkehrsmittel den Bodensee – dies allerdings hauptsächlich von der deutschen Seite her.
Eine erste einheimische Schiffbaufirma
Diese Pionierschiffe waren durchaus brauchbar und auf dem Genfer- und dem Bodensee mit Güter- und Personentransporten auch kommerziell erfolgreich, hatten aber infolge ihrer Holzbauweise immanente Nachteile, insbesondere eine kurze Lebensdauer. Sie wurden auf den beiden Grenzseen vorerst durch ebenso kurzlebige Nachfolger ersetzt. Eisernen Schiffen traute man zuerst nicht, und so dauerte es bis 1834, bis auf dem Neuenburgersee auf Initiative von Philippe Suchard das erste, von Cavé in Paris erbaute eiserne Schiff mit einer Maschine von der gleichen Firma in See stach. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Das erste, jetzt selbstverständlich eiserne Schiff auf dem Zürichsee wurde 1834/35 noch aus England geliefert (vgl. Kasten). Die feierliche Eröffnungsfahrt der «Minerva» fand am 19. Juli statt. Das zweite Zürichsee-Schiff wurde als Ganzes inkl. Kessel und Maschine von der Maschinenfabrik Caspar Escher (später Escher Wyss & Cie) in Zürich erbaut und im Spätsommer 1837 fertiggestellt. Unmittelbar danach gelangte das zweite Schiff von Caspar Escher als erstes Dampfschiff auf den Vierwaldstättersee, die erste «Stadt Luzern». In der Zwischenzeit wurde im Spätsommer 1836 die Schifffahrt auf dem Thunersee mit einem eisernen Schiff namens «Bellevue», noch von Cavé in Paris geliefert, eröffnet. Diesen nun entstehenden «Schiffbau-Boom» ordnet das Verkehrshaus der Schweiz der «mechanisierten Eroberung der Alpen» zu. Bis 1847 konkurrenzierte noch keine Bahnlinie die Schifffahrt auf den Schweizer Seen. Die entstehenden Schienenstränge wurden auch im nachfolgenden Jahrzehnt noch nicht an den Seen entlang geführt, sondern führten nur zu ihnen hin und wurden damit zu Zubringern zur Schifffahrt (typischerweise in Luzern, Thun, Yverdon). Damals gab es nur sogenannte Glattdeckschiffe (Bild 2), Eindecker ohne Salonaufbauten, ledi glich mit dunklen Kajüten in der Schiffschale. Als Zeuge jener Zeit wird gegenwärtig im Verkehrshaus in Luzern das Dampfschiff «Rigi» in einem historisch plausiblen Zustand aufbereitet.
Die Expansion der Schifffahrt
Bahn und Schiff begannen sich ab etwa 1855 zu ergänzen, was der Mobilität in der Schweiz bisher ungeahnte Dimensionen verlieh. Um 1870, am Vorabend des deutsch-französischen Konfl ikts, kumulierten sich die Entwicklungen: Die ersten Halbsalondampfer (mit halb ins Achterdeck eingelassenen Erstklass-Salons) wurden in Dienst gestellt (Bild 3), und die Firma Gebrüder Sulzer in Winterthur begann auf dem Gebiet des Schiffbaus tätig zu werden. Fortan lieferten sich Escher Wyss & Cie und Sulzer über Jahrzehnte einen intensiven, aber fruchtbaren Wettbewerb, der internationale Dimensionen annahmNach dem Rückschlag durch den deutsch-französischen Krieg begann der Tourismus in der Schweiz deutlich aufzublühen. Bergbahnen wurden gebaut, beispielsweise die Vitznau-Rigi-Bahn, und die Schifffahrt stand voll im Dienste dieser Entwicklungen. Gleichzeitig ging mit dem fortschreitenden Bau von Eisenbahnlinien jedoch der «Muss-Verkehr» (Nicht-Freizeit-Verkehr) zurück.
Die Belle Epoque
Ab der Jahrhundertwende erlebte der Fremdenverkehr in Europa und in der Schweiz einen starken Aufwärtstrend. Die Schifffahrt war einer der Träger der damit verbundenen Mobilitätsdienstleistungen. Den stark steigenden Frequenzen begegneten die Gesellschaften mit vielen Neubauten, in der Regel Salonbooten, wie wir sie heute als Zeitzeugen auf verschiedenen Seen noch bewundern können (Bild 4). Alle Schiffe jener Periode wurden entweder in Zürich bei Escher, Wyss & Cie oder in Winterthur bei den Gebrüdern Sulzer gebaut. Die meisten dieser prächtigen Einheiten wiesen luxuriöse, individuell gestaltete, oft historisierende Erstklass-Salons auf, die Kessel- und Maschinenanlagen jedoch genügten dem neuesten Stand der Technik: Bei den auch optisch ansprechend gestalteten und gut einsehbaren Anlagen handelte es sich in jener Epoche durchwegs um 2-Zylinder-Heissdampf-Verbundanlagen, die damals modernste Form der Dampfmaschine (Bild 7).
Vom Salondampfschiff zum Motorschiff
Der Erste Weltkrieg beendete die beinahe euphorische Entwicklung abrupt. Die Zwanzigerjahre begannen mit grosser Ernüchterung – sichtbar im gesellschaftlichen, aber auch im stilistischen Bereich. Auf dem Genfersee wurden ein noch 1914 in Bau gegangenes Gross dampfschiff (SS «Simplon») und ein als Ersatz für ein ausgebranntes älteres Schiff konzipierter Dampfer (SS «Rhone») vom Stapel gelassen. In der übrigen Schweiz wurde nach dem Krieg nur noch ein Raddampfschiff neu in Dienst gestellt: die aus Preisgründen in Deutschland von den Gebrüdern Sachsenberg gebaute «Stadt Luzern» (Bild 5). Das bereits dritte Schiff dieses Namens war der Stilrichtung des Art déco und gewissen maritimen Elementen verpfl ichtet und wirkt heute noch imposant. In der Zwischenzeit fand die Dampfmaschine dank dem Dieselmotor einen wesentlich effi zienteren Nachfolger, und das Schaufelrad wurde durch den Schraubenantrieb zunehmend verdrängt. Escher Wyss nahm nach der langen Pause seit 1914 den Schiffbau 1930 wieder auf und profi lierte sich mit kleineren, ökonomischen Dieselbooten. Mit der MS «Etzel» führte Escher Wyss im Frühsommer 1934 erfolgreich den Verstellpropeller auf dem Zürichsee ein (vgl. nächsten Artikel). Mit der etwas grösseren MS «Thun» für die Bahn- (und Schiffahrts-)Gesellschaft BLS schiedete sich Escher, Wyss & Cie 1940 aus dem Schiffbau. Sulzer hatte bereits 1935 mit der MS «Arenenberg» für den Untersee/Rhein das letzte Exemplar abgeliefert. Die schlechte Auftragslage und die ausländlische Konkurrenz zwangen die Schiffbetriebe zu diesem Schritt. Am Bodensee gelang indessen auf der deutschen und der österreichischen Seite der Bau imposanter Dreideck-Motorschiffe (Werften in Deggendorf, Kressbronn und Korneuburg), die heute bereits als «Klassiker» oder gar «Oldtimer» eingestuft werden.
Die funktionalen Motorschiffe der Nachkriegszeit
Die Nachkriegskonjunktur brachte der Schweizer Schifffahrt zwar erfreuliche Frequenzen, aber der Betrieb war durch grösstenteils schwerfällige, überalterte und damit teure Flotten eingeschränkt. Aus diesem Grund – und wohl auch ein Stück weit einfach im damaligen Zeitgeist – wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren zahlreiche kohlengefeuerte Dampfschiffe ausgemustert und durch eher nüchterne, schlicht gehaltene Motorschiffe teilweise ausgesprochen stattlicher Grösse ersetzt (Bild 6). Hauptlieferant in jener Zeit war die Bodanwerft in Kressbronn am Bodensee, später auch die Schiffswerft Linz an der Donau. In der Schweiz hat einzig die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees ihre Flottenverjüngung durch hauseigenen Schiffbau ermöglicht. Sie war auch der Pionier bei der Verwendung von Aluminium anstelle von Stahl für die Aufbauten, was die Schiffe leichter, stabiler, unterhaltsfreundlicher und letztlich auch ökonomischer machte als die Importe (Bild 8). Fast alle diese Schiffe sind heute noch vorhanden und wirken in ihrer Nüchternheit schon fast neonostalgisch.
Nostalgie versus Moderne, «designte» Schiffe
Im Zuge eines deutlichen Wertewandels – die Schifffahrt wurde zunehmend als Erlebnis und immer weniger als wassergebundene Beförderung wahrgenommen – stieg auch die Wertschätzung für schöne, interessante, die Sinne ansprechende Schiffe. Dies führte nicht nur dazu, dass die noch vorhandenen Dampfschiffe aufwändigen Revisionen unterzogen und als qualifi zierte Nostalgieangebote vermarktet wurden, sondern auch zu bewusst offener gestalteten Neubauten wie der MS «Waldstätter» des Vierwaldstättersees oder der MS «Zug» (Bild 9). Mit rund 12 Mio. beförderten Personen generiert die Schifffahrt in der Schweiz eine Wertschöpfung von über 300 Mio. Franken. Es handelt sich somit keineswegs um eine «idyllische Nische» im Verkehrssystem, die nur traditionell-emotionale Werte und Erholung vermittelt, sondern um einen respektablen Wirtschaftszweig mit hoher touristischer und technischer Kompetenz.
[ Jürg Meister, Verkehrs- und Logistikberatung ]TEC21, Mo., 2008.02.11
11. Februar 2008 Jürg Meister
Weltpremiere auf dem Zürichsee
1934 wurde auf dem Zürichsee ein komplett neuer Schiffstyp in Betrieb genommen. Das Motorschiff «Etzel» war weltweit das erste Schiff mit einem hydraulischen Verstellpropeller.
Das Motorschiff «Etzel», das im Juni 1934 in regelmässigen Betrieb genommen wurde, konnte in seiner Grösse und Form am ehesten mit den sogenannten Dampfschwalben verglichen werden, die damals auf dem Zürichsee verkehrten. Doch während bei den Dampfschwalben ein Maschinist bei jedem Anlegemanöver die Maschine auf «Vor» bzw. «Zurück» umsteuern musste, konnte der Antrieb der «Etzel» vom Steuerstand aus bedient werden; der Heizermaschinist war überfl üssig geworden. Grund dafür war einerseits der Dieselmotor, andererseits eine völlig neue Technologie im Schiffbau: der Verstell- oder Wendepropeller. Mit einem Hebel konnte der Schiffführer über eine Servosteuerung die drei Propellerblätter der Schiffsschraube anwinkeln und damit schnell, langsam, vorwärts und rückwärts fahren, ohne Drehzahl und Laufrichtung der Maschine zu ändern. «Irgendwelche Befürchtungen, dass die Steuerleute sich nicht für diesen Betrieb eignen, haben sich nicht bewahrheitet», schrieb der Aerodynamiker Jakob Ackeret, der massgeblich an der Entwicklung des neuartigen Propellerantriebs beteiligt war, in einem Bericht. «Die Steuerleute eignen sich in kurzer Zeit die Fähigkeit an, mit dem Boote mit Wendepropeller richtig zu fahren.»[1]
Was bewog die Dampfbootgesellschaft mitten in der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre dazu, mit relativ hohen Risiken ein teures Schiff bauen zu lassen, dessen Antrieb noch völlig unerprobt war? Der Bau der «Etzel» war ein Joint Venture der Zürcher Dampfbootgesellschaft mit der Escher Wyss AG und der ETH Zürich, wobei die Protagonisten ganz unterschiedliche Interessen hatten. Die Dampfbootgesellschaft wollte im Hinblick auf die Landesausstellung 1939 eine Publikumsattraktion präsentieren, die für Innovation und Moderne stand. Die Distinktion mittels Technik – alternativ hätte sie auch in ein Luxusinterieur investieren können – ist bezeichnend für die Zwischenkriegszeit, in der technische Innovation zum helvetischen Fortschrittssymbol par excellence wurde. Jakob Ackeret, der als Leiter des Labors für Hydraulik und Strömungsmaschinen bei der Escher Wyss AG gearbeitet hatte, war seit 1931 Professor für Aerodynamik an der ETH, wo er über die besten technischen Versuchsanlagen verfügte, insbesondere über einen Windkanal, in dem man Strömungsmessungen durchführen konnte.[2] Die 1934 zum Institut ausgebaute Professur war ein Produkt der in der Zwischenkriegszeit intensivierten forschungspolitischen Bemühungen, eine Arbeitsteilung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung zu institutionalisieren, staatliche und private Finanzierung zu koordinieren und damit technische Innovation zu steuern. Die Escher Wyss AG ihrerseits hatte bereits mit verstellbaren Schaufeln bei Niederdruckturbinen für Wasserkraftwerke, den sogenannten Kaplanturbinen, Erfahrungen gemacht. «Sollte es einer sowohl Schiffe wie Turbinen bauenden Firma nicht möglich sein, die im Turbinenbau gewonnenen Resultate auf die Schiffsschraube zu über - tragen und eine betriebstechnisch einwandfreie Lösung zu finden?»[3], fragte sich Ackeret. Die Idee der verstellbaren Schiffsschraube war nicht neu. 1852 hatte John Bourne eine grössere Abhandlung über Schiffspropeller publiziert mit zahlreichen Beispielen von regulierbaren Schubkonstruktionen, denen jedoch kein Erfolg beschieden war.[4] Erst nach guten Erfahrungen mit verstellbaren Propellern im Flugzeugbau wurden Verstellpropeller auch für die Schifffahrt wieder diskutiert. Besonders für Frachtschiffe, die einmal leer und einmal beladen fahren, für Schlepper oder Unterseeboote, bei denen die benötigte Schubkraft und der Widerstand variieren, schienen Verstellpropeller ideal. Als grösster Vorteil wurde aber immer wieder ins Feld geführt, dass es mit dem Verstellpropeller möglich werde, ohne Änderung des Drehsinns der Maschine das Schiff rückwärts laufen zu lassen. Das schonte das Getriebe und verkürzte den Bremsweg.
In den 1930er-Jahren kamen in Zürich Kapital, Infrastruktur, personelle Ressourcen und technologisches Know-how für ein Experiment zusammen. Im Windkanal des aerodynamischen Instituts konnte Ackeret mit seinem Team erstmals Messungen am Modell durchführen. Von besonderem Interesse war die Einwirkung des Nachstroms auf die Schraube, also des durch die Reibung an den Schiffswänden entstehenden Sogs, in dem die Schraube arbeitet. Die starke Ungleichmässigkeit des Nachstroms entlang dem Schraubenumfang stellte die Ingenieure vor die heikle Frage, mit welchem mittleren Wert sie rechnen sollten. «Beim festen Propeller in der Tat ein schwieriges Problem; beim Verstellpropeller aber ein Spiel. Wir berücksichtigen irgend eines der üblichen Mittel und dann – dann lassen wir den Steuermann am fertigen Schiff die Stellung der Schraube suchen, die mit genauester Berücksichtigung aller Einfl üsse ohne Integration und Kopfzerbrechen das wirkliche Vortriebsoptimum liefert.»[5] «Empirie in der Praxis!» hiess nun die Lösung für ein altes mathematisches Problem. Im Juni 1934 wurde die «Versuchsanlage Etzel» auf dem Zürichsee in Betrieb genommen. Der Verstellpropeller funktionierte einwandfrei. Durchgesetzt haben sich Verstellpropeller nicht für alle Schiffstypen; sie sind teuer, und die Hydrauliksteuerung ist wartungsintensiv. Bei grossen Schiffen, die tagelang mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts fahren, nimmt man einen etwas schlechteren Wirkungsgrad bei Manövern oder ein Vibrieren bei bestimmten Tourenzahlen in Kauf und baut fixe Propeller mit Wendegetriebe ein. Doch der erste Verstellpropeller tut auf dem Zürichsee bis heute seinen Dienst.TEC21, Mo., 2008.02.11
Anmerkungen / Literatur:
[1] ETH-Archiv, Nachlass Jakob Ackeret, Hs 552a: 36.
[2] www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/touren/vitrinen/forschungspfade/vitrine52
[3] Jakob Ackeret: Verstellpropeller für Schiffe. In: Escher Wyss Mitteilungen 8 (1935), S. 63.
[4] John Bourne: A treatise on the screw propeller with various suggestions of improvement. London 1852.
[5] ETH-Archiv, Nachlass Jakob Ackeret, Hs 552a: 40 (handschriftliches Manuskript).
11. Februar 2008 Lea Haller