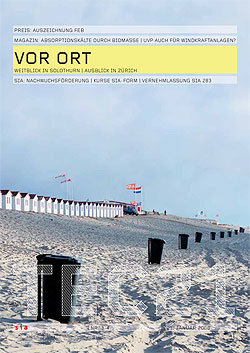Editorial
Die endlos scheinende Zahl von Strandhäuschen, die akkurat aneinandergereiht sind, ist das Ergebnis einer ebenso einfachen wie demokratischen Planung «vor Ort». Das Bedürfnis nach Stauraum und Rückzugsort wird adäquat befriedigt, und die Distanz zum Strand ist für alle Badegäste dieselbe. Man könnte die Häuschen mit dem idealisierten Topos der Urhütte assoziieren, dem von den «Primitiven» aus vier miteinander verbundenen Stützen errichteten Dach über dem Kopf, wie es Marc-Antoine Laugier (1713–1769) als Urform eines jeden architektonischen Bauwerks postulierte. Wären da nicht die ebenso präzis positionierten Mülltonnen, die sinnbildlich stehen für das Hereinbrechen der Zivilisation – das Fanal der Stadtplanung.
Die ist im 20. Jahrhundert zunehmend in Verruf geraten: «Die Illusion einer perfekten Stadt (ist) gescheitert. (...) Keine Planstadt ist jemals unverändert geblieben, keine Planung nicht über kurz oder lang modifi ziert worden. Allen Bestrebungen der Stadtkontrolle zum Trotz entwickeln sich Städte in unvorhergesehene Richtungen»[1], konstatiert Johan Holten, 2004 Kurator der Ausstellung «Non Standard Cities» in Berlin. Die Gründe dafür lokalisiert Philipp Oswalt in den «jenseits der Stadtplanung liegenden Kräften – ob es kriegerische oder ökonomische Entwicklungen, politische oder ideologische Ereignisse, Entwicklungen der Infrastruktur (...) sind» – und subsummiert sie unter dem Begriff «automatischer Urbanismus»[2].
Dem Unvorhersehbaren Raum zu geben ist die Strategie hinter dem Projekt «Weitblick», mit dem in Solothurn ein 25 Hektaren grosses Areal auf der grünen Wiese für die potenzielle Stadtentwicklung präpariert werden soll (Seite 22 ff.). Wie das Unvorhergesehene eine Planung drangsalieren kann, illustriert der zweite Artikel in diesem Heft. Und er zeigt auf, wie es – ebenfalls am Stadtrand – gelingt, die neuen Prämissen so zu handhaben, dass genug Raum für «soft factors» wie soziale Interaktion bleibt.
Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkungen:
[1] Non Standard Cities, Johan Holten, Vorwort Ausstellungskatalog, S. 5, 2004
[2] Philipp Oswalt, ibid., S. 13
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Auszeichnung FEB
16 MAGAZIN
Absorptionskälte durch Biomasse | UVP auch für Windkraftanlagen? | In Kürze
22 WEITBLICK IN SOLOTHURN
Rahel Hartmann Schweizer
Die Prämissen sind so naheliegend wie der Lösungsansatz weitsichtig: Mit der Westtangente bekommt Solothurn die Erschliessung eines 25 Hektaren grossen Gebiets. Um für Investoren gewappnet zu sein, schrieb die Stadt einen Wettbewerb aus. Den Lösungsansatz fanden die Planer im Repertoire der Natur.
28 AUSBLICK IN ZÜRICH
Hansjörg Gadient
Am nördlichen Stadtrand von Zürich ist ein neues Wohnquartier im Entstehen. In einer städtebaulichen Laborsituation experimentieren verschiedene Teams mit dem verdichteten Bauen – mit beschämendem Ergebnis die einen, überzeugend, vorbildlich, mit grossem Erfolg die anderen.
38 SIA
Nachwuchsförderung | Probleme bei Passbolzenverbindungen | Aktuelle Kurse SIA-Form | Vernehmlassung Norm SIA 283
43 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Ausblick in Zürich
(SUBTITLE) Am nördlichen Stadtrand von Zürich ist ein neues Wohnquartier im Entstehen.
In einer städtebaulichen Laborsituation experimentieren verschiedene Teams mit dem verdichteten Bauen – mit beschämendem Ergebnis die einen, mit grossem Erfolg die anderen. Ganz am Anfang, in Artikel 2, Absatz 2, erwähnt die Bundesverfassung1 das Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dies geschehe, so die Präambel, «im Bewusstsein (...) der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen».
In Artikel 75, Absatz 1, fordert sie eine Raumplanung, die «der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens » dient. Das Raumplanungsgesetz2 übernimmt in seinem Artikel 1, Absatz 1, dieses Ziel: «Bund, Kantone und Gemeinden sogen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt wird.» In Absatz 2 nennt es weitere Ziele, darunter dieses: «(...) wohnliche Siedlungen (...) zu schaffen und zu erhalten». Was «wohnlich» heisst und was «haushälterisch», ist nicht defi niert. Diese zwei Ziele sind in jeder Planung in Einklang zu bringen und den Verhältnissen vor Ort anzupassen. Dabei spielt die Dichte eine Schlüsselrolle. Anders gesagt: Wie «haushälterisch» kann im Sinne der Verfassung geplant werden, ohne dass dabei das gesetzliche Ziel der Wohnlichkeit im Speziellen und die ganzheitliche Sicht der Nachhaltigkeit im Allgemeinen aufgegeben wird?
Das Planungsgebiet «Ruggächern» an Zürichs Nordrand ist in dieser Frage zum Pilotprojekt geworden, nicht absichtlich, aber zunehmend sichtbar. Fast 1300 Wohnungen könnten Platz fi nden. Es darf mit einer Dichte von 1.3 und mit bis zu acht Geschossengebaut werden, in einem Fall werden diese Werte noch erheblich übeschritten. Drei grosse Projekte sind unlängst fertig gestellt und bezogen worden. Sie lohnen einen Blick auf ihre städtebaulichen und architektonischen Strategien im Umgang mit hoher Dichte und Wohnlichkeit. Zwei haben die Aufgabe bravourös gelöst, eines ist hoffnungslos gescheitert.
Cerv & Wachtl: Zu viel und zu wenig
Die Siedlung auf dem CeCe-Areal des Investors Leopold Bachmann ist die erste, die fertig gestellt wurde. Sie liegt nicht im Bereich des Quartierplans Ruggächern, grenzt aber direkt daran an und unterlag ähnlichen Planungsprozessen. Im angelsächsischen Raum gibt es einen treffenden Ausdruck, wie diese Aufgabe gelöst wurde: «quick and dirty». Fünf neungeschossige Zeilen drängen sich in der Westhälfte des Grundstücks zusammen, zufällig und hilfl os in ihrer Anordnung. Auf der Ostseite forderte die Stadt den Erhalt der denkmalgeschützten Industriehalle. Sie prägt den Ort und dient als Einkaufszentrum mit einem multifunktionalen Hallenteil für Veranstaltungen aller Art. Der Investor liess sich Erhalt und Sanierung der Halle mit einem Ausnutzungsbonus abgelten: Die Ausnutzung wurde auf die gesamte Grundstücksfl äche berechnet, so als ob die Halle nicht existierte. Die Dichte der Wohnbebauung selbst stieg dadurch auf über 1.5. Die langjährigen Architekten des Investors, Cerv und Wachtl, sind an diesem Zuviel gescheitert – und am Zuwenig der fi nanziellen Mittel.
Das Zuviel der Ausnutzung lässt sich nicht mit einer vermeintlich offenen Bebauung lösen, deren Abstandsfl ächen für die neun Geschosse hohen Zeilen absolut unzureichend sind. Das Zuwenig der fi nanziellen Mittel führt zu einer so billigen Materialisierung, dass die Probleme des Städtebaus in der architektonischen Umsetzung noch betont werden. Das Ziel, möglichst günstigen Wohnungsbau zu realisieren, verbliebe besser bei den Genossenschaften, die das seit Jahrzehnten bravourös erreichen; oder man wende die holländische Strategie des bewohnbaren Rohbaus in einem anständigen Städtebau an, die schneller und würdiger zum Ziel führt!
Ausser dem zurückhaltenden Farbkonzept und den verglasten Loggien, die einige Aufenthaltsqualität bieten und die Südfassaden ansprechend prägen, ist an den Blöcken und ihren erbärmlichen Zwischenräumen nichts zu loben. Zu anspruchslos, zu schnell, zu billig ist das alles.3 Das Projekt erreicht ein einziges Ziel: massenhaft billige Wohnungen. Der Boden ist zwar «haushälterisch» genutzt, aber mit Wohnlichkeit hat das wenig, mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun.
Programmiertes Scheitern
An diesem Problem und seiner Lösung zeigt sich, wes Geistes Kind ein Projekt ist. Beim CeCe-Areal sind in den Erdgeschossen durchgehend Wohnungen untergebracht. Keinerlei Vorkehrungen schützen sie vor unerwünschtem Einblick und Zugang. Die Erschliessungswege führen an den Zimmern vorbei. Die fehlende Privatheit führt dazu, dass blickdichte Vorhänge und geschlossene Jalousien Ein- und Ausblick verwehren. Bei den privaten Sitzfl ächen markiert einzig der Belagswechsel die Grenze zum gemeinschaftlichen Aussenraum. Notdürftig schützen sich einige Bewohner mit Topfpfl anzen, um wenigstens den Anschein von Geborgenheit aufrechtzuerhalten. Und die auf ihren Tiefgaragen-Hügelchen aufgesetzten Hainbuchengrüppchen betonen den Eindruck von Lieblosigkeit und Ärmlichkeit. Der Anblick beelendet. Wo mögen die Stadt und ihre gestalterischen Berater hingeschaut haben, als hier die Qualitäten diskutiert wurden?
Wer zu viel will, programmiert das Scheitern. Ausnutzungsziffern von über 1.5 überfordern primär am Preis interessierte Leute. Schon die Ausnutzung von 1.3 in den nachstehend geschilderten Siedlungen ist sehr hoch, aber nicht zu hoch, wenn Investoren und Planende umsichtig vorgehen.
POOL Architekten: Grossform
Im Raum Zürich hat sich in den letzten Jahren eine erfolgreiche Strategie etabliert, mit der sich Wohnungsbau in hoher Dichte realisieren lässt.4 pool Architekten haben mit ihrem Projekt in Leimbach den Erfolg dieses Ansatzes mitbegründet. Auch in Ruggächern haben sie sich damit gegen andere Bautypen des Studienauftrages durchgesetzt: mit grossen Baukörpern, die – meist am Rand des Grundstücks positioniert – zusammenhängende Freifl ächen schaffen und allen Wohnungen weite Blickbeziehungen ermöglichen. Die kompakten Baukörper mit ihrer geschlossenen Bauweise lassen sich wirtschaftlich realisieren. Das Vorbild dieser Strategie bietet der Schweizer Städtebau der 1960er-Jahre. Matthias Stocker, Partner bei pool Architekten, betont, dass das Büro an der Architektur dieser Zeit interessiert sei und versuche, deren Qualitäten wie Sparsamkeit und Weiträumigkeit in die Projekte einfl iessen zu lassen – ohne die Fehler eines funktionalistisch aufgefassten Städtebaus zu wiederholen. Aktuelle stadträumliche Überlegungen sollen dies vermeiden, unter anderem die Mischung von Wohnen und Arbeiten und die Schaffung von attraktiven Aussenräumen, die zu Begegnungen einladen. Weil sie im Quartierplan einen öffentlichen Stadtraum mit Platzqualitäten vermissten, wollten sie ein solches Angebot schaffen. Sie bildeten mit dem mäandrierenden Baukörper parallel zur Quartierstrasse eine dreiseitig gefasste Platzfi gur, die für das ganze Quartier zum Begegnungsort werden könnte.
Massstab und Dichte
Ein Kritikpunkt an den 1960er-Jahren ist, den grossen Massstab nicht immer bewältigt zu haben. Dem begegnen pool Architekten auf drei Ebenen. Erstens wird der Grossbaukörper penibel auf seine Proportionen und die der Aussenräume optimiert. Zweitens wird der Massstab der einzelnen Wohnung in der Fassade ablesbar gemacht, in dem der Wechsel von Zimmern und eingezogenen Loggien die Einheit der Wohnung aufzeigt. Horizontalität, stockwerksweiser Versatz der Loggien und Versprünge in den Brüstungsbändern ergeben ein ausbalanciertes Spiel von stehenden und liegenden Elementen. Drittens macht der den ganzen Bau regelnde Stützenraster im Abstand von 3.1 m den Massstab des Einzelnen,nämlich des Zimmers, in der Fassade sichtbar. Diese abgestuften Massstabsbezüge und die feine Tiefenschichtung der Fassade verdeutlichen die Abkehr vom Brutalismus der 1960er-Jahre und zeigen, wie mit Grossformen Wohnungsbau realisiert werden kann.
Lärm und Grundrisse
Die Grundrisse der Wohnungen sind stark von der Lärmproblematik der nahen Autobahn bestimmt. Aus dieser Not entstanden besondere Tugenden. Da in vielen Wohnungen nur die einseitige Lüftung von Wohn- und Schlafräumen zulässig war, entstand die Orientierung dieser Räume auf eine Seite und die Ausbildung eines Rückens aus Sanitärräumen auf der anderen. Die offene Küche mit ihrem dem Wohnraum zugeordneten Essplatz ist auf die offene Landschaft hin gerichtet und gibt einen fantastischen Weitblick frei. Auf der Gegenseite bietet sich die städtische Aussicht auf den Platz und die angrenzende Bebauung. Alle Wohnungen profi tieren von diesen Vorzügen, sodass sie trotz der hohen Dichte von 1.2 grosszügig und an keiner Stelle beengt wirken. Mit einem Kunstgriff lässt sich ein Zimmer auch auf die lärmexponierte Seite hin orientieren. Es wird auf der ruhigen Seite belüftet, wo ihm die raumtiefe Loggia zugeordnet ist. Die Lösung ist einfach und effi zient, ein Typ, der für vergleichbare Situationen Schule machen könnte.
Ursprünglich sollten im überhohen Erdgeschoss Läden, Dienstleistungs- und Gewerberäume entstehen – ein Beitrag zur Belebung des Platzes. Die wirtschaftliche Überprüfung zeigte, dass sie in den nächsten zehn Jahren nicht vermietbar sind. Daher mussten Wohnungen eingerichtet werden. Um eine spätere Umnutzung zu ermöglichen und die Proportionen des Baus zu erhalten, wurde die Raumhöhe beibehalten. Grundrissdisposition und Innenausbau machen eine spätere gewerbliche Nutzung leicht möglich. So besteht die Hoffnung, dass langfristig in dem Quartier ein urbaner Platz entsteht. Die Landschaftsarchitekten Kuhn Truninger reagieren auf die Wohnnutzung im Erdgeschoss. Sie legen leicht modulierte, mit Stauden und Sträuchern gestaltete Flächen vor den Wohnungen an, die einen attraktiven Ausblick erhalten und vor Einblicken geschützt sind. Sollte später eine gewerbliche Nutzung einziehen, lassen sich diese Flächen in städtischerer Art ausbilden.BAUMSCHLAGER EBERLE: TÜRME Seit Jahren erforscht das Büro Baumschlager Eberle zeitgemässen Wohnungsbau unter besonderer Berücksichtigung des nachhaltigen Handelns. Eine hohe Dichte gehört dabei oft zu dieser Herausforderung. Aufgrund seiner reichen Erfahrung wählte das Vaduzer Büro beim Projekt Ruggächern nicht wie pool Architekten die Strategie der Grossform. Die Aufgabe und die Situation waren hier zwar sehr ähnlich, aber Baumschlager Eberle zogen den Typus eines Stadtteils aus Punkt- und Zeilenbauten mit sechs bis sieben Geschossen in einem fl iessenden Aussenraum vor.
Gemäss den Vorgaben des Quartierplans war auch hier eine Ausnützung von bis zu 1.3 möglich. Obschon man in der Siedlung die hohe Dichte spürt, nimmt man sie nicht nachteilig wahr. Das Ensemble wirkt grosszügig und grossstädtisch. Es erinnert an die sechs- bis achtgeschossigen Wohnsiedlungen in Norditalien oder England und öffnet so den Horizont des Schweizer Wohnungsbaus weit über die Landesgrenzen hinaus. «Wir haben bei der Anordnung und der Gestaltung der Volumen im Ganzen äusserste Disziplin walten lassen und gleichzeitig versucht, durch Variieren Individualität herzustellen», so Sabrina Contratto, die Projektleiterin. Für die Siedlung sollte eine Form gefunden werden, die sowohl städtisch wirkt als auch zur Landschaft hin offen bleibt. Zur Bahn und zur Hauptstrasse schirmen fünf Längsbauten das Ensemble ab. Im Innern sind neun Punkthäuser in diagonal leicht verschobenen Reihen gruppiert, sodass aus jeder Wohnung weite Blicke in die Landschaft möglich sind.
Architektur und Dichte
Trotz der teilweise geringen Gebäudeabstände entsteht nirgends das Gefühl von Beengung. Woran liegt das? Ähnlich wie beim Projekt von pool Architekten sind die Proportionen der Bauten und ihrer Aussenräume ausschlaggebend. Sie sind präzis aufeinander abgestimmt. Die Volumen der Bauten, so Sabrina Contratto, seien absolut klar und wiesen keinerlei Vorsprünge auf. Ausserdem habe die Backsteinfassade eine grosse Tiefe. Die Fensterlaibungen bilden eine Raumschicht, die den Bewohnern ein Gefühl von Geborgenheitgebe. Das Gleiche gilt für die tiefen Loggien, in denen man sich draussen aufhalten kann, aber genauso vor Blicken geschützt ist wie im Inneren. Die Anordnung dieser Loggien an den Ecken der Bauten öffnet den Blick auf zwei Seiten und betont die diagonalen Sichtbeziehungen quer durch die ganze Siedlung. So entsteht trotz dichter Bebauung das Gefühl von grosszügiger Offenheit. Selbst die Wahl des Klinkerverbandes trägt zum Eindruck von klarer volumetrischer Begrenzung bei. Der wilde Verband lässt ihn fl ächig und hautartig erscheinen und betont die klare Defi nition der Zwischenräume und die Tiefenwirkung von Laibungen und Pilastern. Das Material selbst wirkt solide, edel und beständig. Die Projektleiterin spricht von einer burgartigen Anmutung, eine Metapher, die sowohl das Gefühl im Aussenraum als auch in der Wohnung treffend beschreibt: My home is my castle. Wenn immer möglich, vermeiden Baumschlager Eberle Wohnungen im Erdgeschoss. Beim Projekt Ruggächern war dies nicht durchgängig möglich, weil auch hier kein Bedarf für gewerbliche Nutzungen bestand. Das Problem wird auf zwei Arten angegangen. Zum einen stehen die Bauten teilweise auf der Tiefgarage und teilweise frei. Der frei stehende Teil ist grosszügigen Eingangsräumen und den gemeinschaftlichen Waschküchen vorbehalten. Beim anderen Teil sind die privaten Sitzplätze genau gleich wie die darüber liegenden Loggien gestaltet. Sie sind ganz in den Baukörper eingezogen; geschlossene Brüstungen schaffen eine klare Begrenzung. Nirgends grenzen diese Sitzplätze direkt an Durchgangszonen; so erhalten sie die grösstmögliche Privatheit.
Markus Weiss: Soziale Plastik
Wo endet der Städtebau? In diesem Projekt endet er in einer kleinen Kugel. In der Siedlung gibt es zwei Plätze. Der Zürcher Künstler Markus Weiss hat den Wettbewerb für eine Platzgestaltung mit einem künstlerisch und sozial überzeugenden Konzept gewonnen. Auf einem leicht angehobenen Sockel baut er unter dem Titel «Place de Gaulle 2» die Kopie des legendären Platzes von Saint-Paul de Vence in Südfrankreich, auf dem sich in den 1950erund 1960er-Jahren die Prominenz zum Spiel traf: Greta Garbo, Pablo Picasso und all die anderen. In denselben Ausmassen angelegt, mit Steinen aus dem gleichen Steinbruch inSüdfrankreich und mit den gleichen fünf Platanen wird das vergangene Idyll nachgebaut. Jeder Haushalt erhält beim Einzug einen Satz Boule-Kugeln. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich beim ungezwungenen Spiel treffen und sich kennen lernen. Auf den Seitenwänden des Podestes sind die Namen einiger der Berühmtheiten im Beton eingelassen: La Callas, Jean Cocteau, Simone de Beauvoir ... Ihr Klang beschwört die poetische Erinnerung an einen fernen Ort und eine vergangene Zeit. Mit dem Platz als möglichst getreuer Kopie seines Vorbildes und mit dem Zusammenführen der Bewohner hat der Künstler eine zeitgemässe Mischung von Installation und sozialer Plastik geschaffen – weit mehr als «Kunst am Bau».
Wohnlich!
Wenn am Anfang Verfassung und Gesetz stehen, stehen am Schluss Menschen, die mehr tun als Gewinn maximieren und Vorschriften erfüllen. Für sie hat das Verfassungsziel der nachhaltigen Entwicklung nicht nur mit Wirtschaft und Ökologie, sondern auch mit sozialen Aspekten zu tun. Sie denken weiter und verwandeln dünne Gesetzestexte in echte Bauten, gehen haushälterisch mit dem Boden um und schaffen wohnliche Stadtteile. Aber was heisst wohnlich? – Gern nach Hause gehen, sich auf die Wohnung freuen, auf ihre Ausblicke, die Nachbarn, das Kindergeschrei im Sommer, die Lichterketten im Dezember, die Kirschblüte im April – und die erste Partie Boules.
[ Hansjörg Gadient, Architekt, Publizist und Landschaftsarchitekt ]TEC21, Mo., 2008.01.21
Anmerkungen:
[1] Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand 8. Aug. 2006).
[2] Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)1 vom 22. Juni 1979 (Stand 1. Sept. 2007).
[3] Leopold Bachmanns Strategie, kenntnisreich erläutert: Billig als Prinzip. Andreas Hofer, in: TEC21, 13 / 2004. S. 6 ff.
[4] Grossform im genossenschaftlichen Wohnungsbau: Tendenz Grossform. Inge Beckel in: Wohnen 5, 2007, S. 65 ff.
21. Januar 2008 Hansjörg Gadient