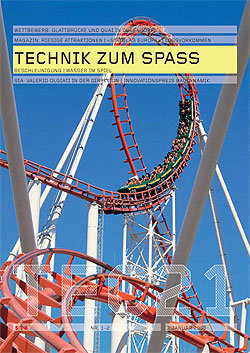Editorial
Seit über 100 Jahren unterhalten sich Menschen weltweit mit Schwindel erregenden Fahrten auf Achterbahnen. Sie lassen sich mit einem Mehrfachen ihres Eigengewichts in die Sitze pressen und Sekunden später ihren Körper im Zustand der Schwerelosigkeit schweben, und je nach Bahn werden sie dabei auch noch mit Wasser bespritzt. Trotz dieser unsanften Behandlung sind die Leute gerne bereit, dafür in die Brieftasche zu greifen, zumal sie wissen, dass das Ganze von kurzer Dauer ist und sanft und sicher ausläuft. Der Branche geht es gut, an den verschiedensten Orten werden neue Fahrgeschäfte gebaut oder geplant.
Mit Achterbahnen und verwandten Unterhaltungsgeräten befasst sich das vorliegende Heft zum Jahresanfang. Dieses durchaus technische, aber auch vergnügliche Thema soll sinnbildlich mithelfen, die Energie des Jahreswechsels möglichst weit ins neue Jahr und über viele Aufs und Abs zu transportieren. Der erste Artikel beschreibt die physikalischen und technischen Grundlagen moderner Achterbahnen und weist auf die ingenieurmässige Planung und die redundanten Sicherheitseinrichtungen dieser Anlagen hin. Die Grenzen der Belastbarkeit des menschlichen Körpers werden ebenfalls berücksichtigt, denn diese sind es, die dem Streben nach dem technisch Machbaren Einhalt gebieten.
Eine andere Entwicklungsrichtung als die klassischen Achterbahnen schlagen die im zweiten Beitrag vorgestellten Wasserbahnen ein. Auch hier steckt, neben Design und Show-Effekten, vor allem viel Technik hinter dem ultimativen Freizeitvergnügen, und es steht ebenfalls die Sicherheit der Fahrgäste an erster Stelle. Die Möglichkeiten sind offenbar noch lange nicht ausgereizt, denn die Hersteller haben etliche Projekte und Ideen in der Pipeline, um aus der Verbindung von Wasser- und Achterbahn neue Erlebnisse für das verwöhnte Publikum zu zaubern.
Illustriert werden die Fachartikel durch drei Doppelseiten eines Fotoessays über Schweizer Fahrgeschäfte. Zu sehen sind einerseits zerlegte klassische Achterbahnen im Winterlager und anderseits Impressionen vom Abbau verschiedener Bahnen nach einer traditionellen Chilbi in einer Ostschweizer Stadt. Die Bilder zeigen gebrauchte, sorgfältig unterhaltene, gepfl egte und rationell gelagerte Geräte und Bauteile, was im Übrigen für die gesamte Branche repräsentativ ist. Die Zirkus- oder Zigeunerromantik früherer Zeiten sucht man bei den heutigen Fahrgeschäften vergeblich. Ihr Betrieb ist eine technische und betriebswirtschaftliche Herausforderung: Die Konkurrenz ist aktiv, das Publikum wankelmütig und anspruchsvoll, und die Sicherheitsanforderungen sind in der Schweiz die weltweit strengsten. Man mag es bedauern, dass durch Rationalisierung und Professionalisierung der nostalgische Charme, gerade der klassischen Achterbahnen, verschwunden ist. In Anbetracht der real erreichten Geschwindigkeiten und Kräfte ist es aber doch beruhigend, von zeitgemässer Technik gesteuert und gesichert durchgeschüttelt zu werden.
Aldo Rota
Inhalt
WETTBEWERBE
Glattbrücke und Quai in Dübendorf
MAGAZIN
Riesige Attraktionen | «Stat@las Europa» | Europäische Lössvorkommen | Berner Minergiepreis 2007
BESCHLEUNIGUNG
Thomas Halama | Moderne Achterbahnen sind solide Ingenieurbauwerke. Sie werden am Computer entworfen und virtuell getestet, bevor sie die Fahrgäste das Fürchten lehren.
WASSER IM SPIEL
Daniela Dietsche | Wasser zieht Menschen an. Dank technischem Know-how kann das Abenteuer Wildwasser in künstlichen Wasserrinnen sicher genossen werden.
SIA
Valerio Olgiati in der Direktion | «Umsicht» im Tessin | Innovationspreis Baudynamik | Neue Redaktorin | SIA-Projekt Einstellhallen | Geosuisse wird SIA-Fachverein |
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Wasser im Spiel
Ob auf Jahrmärkten oder in Freizeitparks, Wildwasserbahnen sind Besuchermagneten. Diese Anlagen sind für die meisten Menschen körperlich unbedenklich, aber überraschen emotional. Hinter diesem besonderen Typ Fahrgeschäft steckt viel, auf den ersten Blick nicht sichtbares, technisches Know-how.
Als es zum Abtransport des geschlagenen Holzes aus dem Wald noch keine Strasse gab, wurden die Baumstämme auf Rutschen und Gleitbahnen aus dem Wald abtransportiert. In diesen «Riesen» glitten die Stämme durch die Schwerkraft ins Tal. Die Rinnen wurden mit Wasser feucht und glatt gehalten. Der österreichische Förster und Erfi nder Viktor Schauberger (1885–1958) verbesserte die Haltbarkeit und die Transporteigenschaften dieser «Wasserriesen» durch mäanderförmige Kurvenführung und gezielte Wasserverwirbelungen. Diese Art des Holztransports und vor allem die herabschiessenden Stämme in den Rinnen faszinierten die Betrachter schon immer. Heute stürzen Menschen in Baumstämmen nachempfundenen Booten durch künstliche Wasserrinnen – auf Jahrmärkten oder in Freizeitparks. Gesichert durch moderne Technik, geniessen sie dieses Abenteuer.
Bewegung in der Wasserrinne
Bei den Wildwasserbahnen und den «Super Splash» genannten Anlagen werden die unterschiedlich thematisierten Boote mit einem Lift oder einem Förderband nach oben gezogen. Die Fahrt kann nach Erreichen der Krone entweder direkt mit einer Schussfahrt beginnen, oder die Boote werden zuerst noch in einem oberen Wasserkreislauf geführt. Um Richtungswechsel zu ermöglichen, können die Boote auf einer Plattform gedreht werden. Dank diesen Drehstationen können Kurven vermieden werden, falls es die Platzverhältnisse erfordern, und es kann zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gewechselt werden. Bei der auf jeder Wildwasserbahn obligaten Schussfahrt werden die Boote durch Laufräder und seitlich angebrachte Räder sicher geführt. Im Kanal befi ndet sich Wasser, das mit Pumpen nach oben befördert wird und dann über die Auslegung der Kanäle zum nächsten defi nierten Punkt strömt, zum Beispiel zu einem weiteren Lift. Sobald die Besucher die Schussstrecke durchfahren haben, verlässt das Fahrwerk des Bootes die Führung, sodass es im Wasserkanal frei schwimmt. Diese Kanäle bestehen üblicherweise aus Beton oder Kunststoff. Das Strömungsverhalten wird in Verbindung mit dem Gefälle und der zu erwartenden Strömungsgeschwindigkeit im Vorfeld berechnet. Bei der Inbetriebnahme kann das Strömungsverhalten noch leicht beeinfl usst werden, sodass der Wasserstand bei unterschiedlich beladenen Booten ausreicht und die Boote durch ihr natürliches Auftriebsverhalten schwimmen.
Das Wasser verlassen
Die «Wasserachterbahn», eine Kombination aus Achterbahn und Wasserbahn, erlaubt, die Boote auch ausserhalb des Wassers zu führen. Der Schienenkontakt ist damit dem Achterbahnabschnitt vorbehalten. Die Konstruktion der Fahrzeuge ist in diesem Fall besonders aufwändig, weil die Mischung aus Boot und Achterbahnzug problematisch ist: Von der Achs- und Radanordnung her muss das Boot den Verdrehungen der Schiene wie eine Achterbahn folgen können; danach wird es im Wasser abgebremst und schwimmt weiter. Durch das Eintauchen in das Wasser mit hoher Geschwindigkeit werden an die Mechanik,insbesondere an die Lager und Lagerdichtungen, hohe konstruktive Anforderungen gestellt. Um den Benützern ein sicheres Ein- und Aussteigen zu ermöglichen, gibt es für die Wildwasserbahnen verschiedene Bahnhofsgestaltungen. Beim ältesten, inzwischen wenig gebräuchlichen Typ werden die Boote im Kanal von vorn unten mit einer Hydraulik- oder Pneumatikvorrichtung leicht angehoben und so angehalten. Heute werden die Boote in der Regel auf einem Förderband langsam vorwärtsbewegt, und die Fahrgäste steigen während der langsamen Fahrt ein. Bei Rundladestationen schwimmen die Boote synchron zu einer sich drehenden Scheibe, die auch dem Einsteigen dient.
Überraschungseffekte und Interaktivität
In den letzten Jahren hat ein Umdenken stattgefunden. Die Fahrgeschäftbetreiber setzen wieder vermehrt auf familienfreundliche Anlagen. Es ist nicht allein die Geschwindigkeit,die die Benutzer spüren, sondern die Kombination aus verschiedenen Fahreffekten, zum Beispiel Beschleunigungen bei plötzlichen Richtungs- oder Geschwindigkeitsänderungen.
Die Boote der Wasserbahnen bieten mehreren Personen Platz (etwa 16 Personen in Viererreihen oder sechs Personen hintereinander). Wasser spricht die Menschen an: Kleine Mädchen freuen sich über das ängstliche Gesicht ihrer Mutter und kleine Jungs über die nasse Hose des Vaters. Zusätzlich werden die Anlagen mit Sondereffekten attraktiv gestaltet. In den Booten oder auch am Ufer werden zum Beispiel Wasserspritzpistolen installiert, die den Spieltrieb wecken. Das Vergnügen steht jeder Altersklasse offen.
Module aus der Werkzeugkiste
In der Regel hat jeder Fahrgeschäftbetreiber seine eigenen Vorstellungen und Wünsche. In Verbindung mit den weltweit unterschiedlichen Normen und lokalen Vorschriften bringt dies diverse Anforderungen an die statische und die dynamische Berechnung und an die Betriebssicherheit mit sich. Ein Sortiment von Drehstationen, Stützenformen, Vertikalliften, Bahnhöfen, Rückwärtsschüssen, Weichen etc. erlaubt heute eine modulare Bauweise. Es werden Grundmodelle entwickelt, die aber so fl exibel sind, dass sie massgeschneidert angepasst werden können: Durch das Zusammensetzen verschiedener Module sollen die Wünsche der Betreiber individuell erfüllt werden. Der Betreiber legt die Eckdaten fest. Dabei spielt die Umgebung der Anlage – Topografi e, verfügbare Grundfl äche, Grad der Verbauung durch andere Anlagen – eine grosse Rolle. Zusätzlich werden die gewünschte Kapazität festgelegt sowie die Fahreffekte und Beschleunigungswerte ausgewählt. Aufgrund dieser Basisdaten erfolgt die statische und die dynamische Berechnung. Diese ist mit derjenigen der Achterbahnen vergleichbar (vgl. Artikel «Beschleunigung»), denn auch Wildwasserbahnen sind Schwingungen und Belastungen ausgesetzt. Zug, Druck, Schub, Torsion, Biegung wirken auf die Konstruktion ein. So muss beispielsweise das Verhalten von unterschiedlich besetzten Booten berücksichtigt werden.
Trotz einiger Zufälligkeiten, zum Beispiel die ungünstige Witterung oder der unberechenbare menschliche Faktor, wird durch den modularen Aufbau eine hohe Anlagensicherheit erreicht. Diese wird inzwischen von vielen Kunden vertraglich gefordert, da es sonst zu fi nanziellen Einbussen und unzufriedenen Besuchern kommen kann. Weitere entscheidende Vorteile für den Kunden sind die relativ hohe Kalkulationssicherheit und das Entfallen der Testaufbauten. Die Schienen werden mit Laser und Speziallinealen hergestellt, sodass lediglich Anlagenteile mit engen Kurven zum Test aufgebaut werden. So ergibt sich die Möglichkeit, schon frühzeitig mit dem Bau zu beginnen. Baugruben und Fundamente können erstellt werden, während die Produktion von Schienen, Steuerung etc. noch läuft. Bei den Booten ist das Vorgehen ähnlich: Das Grundmodul des Bootes, in seiner Form statisch und dynamisch defi niert, kann bereits gefertigt werden, während noch am Design gefeilt wird. Fehlerquellen lassen sich heute schon vor Baubeginn zum grossen Teil ausschliessen.
Wasser als Bremse
Die Wildwasserbahnen funktionieren wie die Eisenbahn oder die U-Bahn mit einem Blocksystem. Oben auf der Krone angekommen, wird das Boot erst freigegeben, wenn die installierte Sensorik die entsprechende Strecke als frei und sicher meldet. Das elektronische Blocksystem unterteilt die Strecke in einzelne Sicherheitsblöcke. Diese werden über ein redundantes Steuerungssystem überwacht. Treten Hindernisse auf, greift die Sicherheitsbremse regulierend ein. Die Steuerungen sind so konzipiert, dass alle sicherheitsrelevanten Schaltungen bei Stromausfall die erforderliche Zeit überbrücken können. Die Sicherheitsbremsen sind mit Federspeichern ausgestattet, sodass sie nicht auf eine Aufrechterhaltung der Energieversorgung angewiesen sind. Messsonden wachen darüber, dass der Wasserstand innerhalb gewisser vorgegebener Toleranzen liegt und nicht inkritische Bereiche abfällt. Eine Veränderung um wenige Zentimeter könnte die Sicherheit der Wildwasserbahn erheblich beeinfl ussen.
Ist die Schussfahrt überstanden und fotografi sch festgehalten, werden die Boote im Auslauf durch den Wasserwiderstand abgebremst. Dazu ist ein stabiler Wasserstand notwendig. Er muss so festgelegt werden, dass Spritzverhältnis und Verzögerung in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Durch die auftretende Wasserverdrängung spritzt das Wasser so hoch auf, dass die Insassen dabei nass werden können, dennoch wird die Attra k tivität der Bahn an einem möglichst intensiven «Splash» gemessen. Um möglichst viel Wasser von den Fahrgästen fernzuhalten und um eine optimale, nicht zu abrupt einsetzende Bremswirkung zu erhalten, ist der Bug des Bootes entscheidend. Er muss so geformt sein, dass er das Wasser aufspaltet und seitlich ableitet. Die Geschwindigkeit und damit die notwendige Bremskraft ergeben sich jeweils aus Höhe und Neigung der Abfahrt. Unterstützt wird die Bremswirkung durch berührungsfreie Magnetbremsen.Die Abnutzung der eingesetzten Bauteile ist stark frequenzabhängig. Ebenso der Rhythmus der Wartung, die nicht mit den regelmässigen Sicherheitschecks zu verwechseln ist. Wasserbahnen sind sehr betreuungsintensiv, für die Wartung der komplexen Baugruppen sind Fachkräfte notwendig.
Opferanoden helfen, die Anlagen zu schützen
Wasserbahnen werden entweder aus Naturseen gespeist, oder das Wasser wird in einem Reservoir gespeichert. Die benötigte Wassermenge wird täglich in den Anlagenkreislauf gepumpt. In vielen Parks wird aus ästhetischen Gründen grosser Wert auf klares Wasser gelegt. Bei Bedarf werden chemische Zusätze beigemischt, zum Beispiel, um Algenbefall zu verhindern, was das Material zusätzlich belastet. Doch auch bei der Verwendung von Trinkwasser werden die Mechanik und das Material stark beansprucht. Die Betreiber wünschten lange Zeit tauchverzinkte Bauteile, da diese während der Lebensdauer der Beschichtung resistent gegen Korrosion sind. Werden diese Bauteile jedoch aus ästhetischen Gründen lackiert, können Probleme auftreten. Daher werden die Bauteile teilweise durch Opferanoden vor Korrosion geschützt.
Die Vision einer anderen Produktfamilie
«Stellen Sie sich ein Fahrzeug vor, das gelenkig mit dem Fahrgestell verbunden ist. Das heisst, das Boot folgt seinem natürlichen Schwimmverhalten. Es schaukelt und schwankt abhängig von Wind und Wellen. Jede Fahrt wird einzigartig sein. Das war bisher in dieser Form nicht möglich.» So stellt Günter Burger, Leiter des Technischen Büros der Firma Mack Rides in Waldkirch (D), in knappen Worten die Vision einer neuen Produktfamilie vor. Das europäische Patentamt beurkundete im Sommer dieses Jahres diese neue Form eines Wasserfahrgeschäfts, in den USA steht es kurz vor der Erteilung. Ähnlich wie bei einem Auto, dessen Bewegungen durch die Federung aufgefangen werden, soll das Wasser diese Aufgabe erfüllen, um den Benützern ein möglichst realistisches Gefühl einer Bootsfahrt zu vermitteln. Die Position des Bootes ist gegenüber dem Fahrwerk in Längs- und Querrichtung sowie in der Höhe veränderbar. Die Auslenkung gegen Kippen muss begrenzt werden, die Boote wären damit kentersicher. Das Fahrwerk wird auf Schienen, zum Beispiel auf einer Eisenbahnschwellen-ähnlichen, verdichteten Grundlage, unter Wasser geführt und angetrieben. Das scheinbar instabile Boot kann sich unterschiedlichen Wasserständen anpassen und ist dennoch jederzeit sicher geführt. Ein statischer Wasserkreislauf ist nicht mehr notwendig. Da das Wasserfahrzeug mit einem achterbahntypischen Fahrwerk ausgestattet sein kann, auf das es abgesenkt wird, wird es trotz der Eigenschaften eines im offenen Gewässer frei schwimmenden Bootes Achterbahnelemente wie Schüsse oder Horse-Shoe-Kurven befahren können. Wichtig wird hierbei eine sichere Verriegelung der Kupplungselemente sein. Die interaktive Einfl ussnahme der Fahrgäste auf Fahrgeschwindigkeit und Wellenbildung könnte das Erlebnis vervollständigen.
Neue Möglichkeiten eröffnen sich bei dieser Konstruktion für die Gestaltung. Bisher wurden die Kanalwände statisch durch das Gelände geführt, was für die Designer eine erhebliche Einschränkung der Ästhetik bedeutete. Nun wären weder für Kanäle noch Seen zwingend Betonarbeiten erforderlich. Die Ufer könnten frei gestaltet werden. Wie lange sich die Liebhaber der Wasserbahnen noch gedulden müssen, bis sie beispielsweise mit 100 km/h in einem Speedboot bei hohem Wellengang übers Wasser rasen, nach einer Fahrt übers «Festland» und einem Absturz über einen Wasserfall wieder vom Wasserwiderstand gebremst werden, ist noch offen.TEC21, Mo., 2008.01.07
07. Januar 2008 Daniela Dietsche