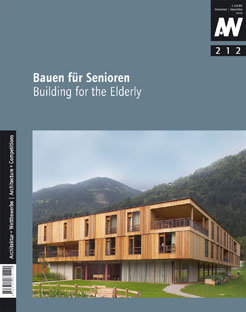Editorial
Durch das anhaltende Geburtendefizit und die steigende Lebenserwartung altert die Bevölkerung Deutschlands und der meisten Nachbarländer immer stärker. Unsere Gesellschaft sieht sich einem demographischen Wandel gegenüber, der in Zukunft nahezu alle Bereiche beeinflussen wird. Während Branchen wie etwa Finanzdienstleister, Reiseveranstalter oder Bildungsträger das Potential dieser Entwicklung längst erkannt haben und ihre Produkte und Angebote schon jetzt gezielt auf die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen zuschneiden, sind in der Bau- und Immobilienbranche derartige Konzepte bislang leider oft noch Mangelware. Sicher ist aber, dass statt Kindergärten und Schulen künftig verstärkt Alten- und Pflegeheime sowie Wohngebäude beziehungsweise -anlagen für Senioren gebaut werden. Als Wohnform und Versorgungskonzept der Zukunft gilt dabei das »Betreute Wohnen im Alter«: Die älteren Menschen sollen möglichst lange selbständig in den eigenen vier Wänden wohnen und Betreuung, Versorgung, Hilfe und Pflege nur nach Bedarf in Anspruch nehmen – entweder in organisatorischer Verbindung mit einem Pflegeheim, in Kombination mit teilstationären Angeboten oder durch die häusliche Versorgung durch ambulante Dienste. Voraussetzungen für ein eigenständiges Wohnen bis ins hohe Alter sind jedoch eine barrierefreie und Kommunikation fördernde Gestaltung und Ausstattung der Wohnungen und des Wohnumfelds sowie die Einbindung der Wohnungen in vorhandene städtebauliche und räumliche Strukturen, damit die Senioren auf ein funktionierendes soziales Netzwerk zurückgreifen können und Versorgungseinrichtungen für den täglichen Bedarf in der unmittelbaren Nähe haben. Bei der Entwicklung von zukunftsfähigen Konzepten für »Betreutes Wohnen« sind in einem ganz besonderen Maße auch die Architekten gefragt. Die in dieser AW-Ausgabe dokumentierten Beispiele, Projekte und aktuellen Wettbewerbsentscheidungen sollen Anregungen zu dieser interessanten und überaus wichtigen Bautypologie geben.
Inhalt
Zum Thema
Herausforderung »Social Design« | Sibylle Heeg
Beispiele
Seniorenwohnanlage in Rotterdam | Arons en Gelauff architecten
Betreute Altenwohnanlage und Tagesstätte in San Vicente del Raspeig | Javier García-Solera Vera
Altenwohnanlage in Kopenhagen | Frederiksen & Knudsen Arkitekter
Betreute Altenwohnanlage in Diemen | Dick van Gameren architecten
Soziales Zentrum mit Seniorenwohnungen in Düren | JSWD Architekten
Seniorenresidenz in Muri | Burkhalter Sumi Architekten
Pfarrzentrum mit Seniorenwohnungen in Wipperfürth | Martini Architekten
Altenwohn- und Pflegeheim in Steinfeld | Dietger Wissounig
Altenpflegeheim in Dornbirn| Johannes Kaufmann Architektur / Riepl Riepl Architekten
Altenheim in Azmoos | Hubert Bischoff
Hospiz in Stuttgart | Aldinger & Aldinger
Seniorenwohnungen in Langnau im Emmental | Jörg Sturm Architekten
Altenpflegeheim in Hüfingen | GSP Gesellschaft für Soziales Planen mbH
Projekte
Wohnstift für Senioren in Stuttgart | Wulf Partner
Seniorenwohnanlage in Zürich | pool Architekten
Alterszentrum in Frauensteinmatt | Michael Meier und Marius Hug Architekten
Wettbewerbe
Seniorenwohnen am Marktplatz in Borken
Altersheim »Trotte« in Zürich
Demenzhaus »Jungerhalde-Nord« in Konstanz
Begegnungsstätte und Seniorentreff in Reinbek
Herausforderung »Social Design«
Nein, es geht nicht um ein neues Interior Design Konzept – der Begriff Social Design wurde in den 1980er Jahren von Robert Sommer, einem amerikanischen Umweltpsychologen geprägt, und meint eine bestimmte Grundhaltung beim Entwerfen, eine stärkere Priorität für die Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse im Gegensatz zu mehr formalistischen Ansätzen in der Architektur. Social Design bedeutet »Creating buildings with people in mind« und erfordert Wissen über den Zusammenhang von physischer Umgebung einerseits und Befinden und Verhalten andererseits. Es bezieht die Nutzer bei der Planung ein, erforscht deren Reaktionen in konkreten Umgebungen, beispielsweise in Altenpflegeheimen mit sozialwissenschaftlichen Methoden. Es ist nahe liegend, sich beim Thema »Bauen für Senioren« mit der Frage der Grundhaltung, der ethischen Basis unseres Tuns als Architekten zu befassen, die ja im Laufe der letzten Jahrzehnte ja deutlichen Schwankungen unterworfen war.
Es ist noch nicht so lange her, da konnten wir es uns leisten, eine solche Grundhaltung, die den Bedürfnissen der Nutzer einen großen Stellenwert einräumt, abzuwerten, als kaum vereinbar anzusehen mit »guter« oder innovativer Architektur. Aber die Zeiten, in denen ambitionierte Architekturbüros sich dem Bau eines Pflegeheims am liebsten verweigert hätten, weil sie sich nicht in mit den Niederungen einer solchen Bauaufgabe beschäftigen wollten oder in sozial
reformerischer Attitude die Notwendigkeit solcher Einrichtungen bezweifelten, sind schon lange vorbei.
Im Jahre 2000 waren etwa 25 Prozent unserer Bevölkerung über 65 Jahre alt und im Jahre 2040 werden es an die 50 Prozent sein. Ältere Menschen werden dann die Hauptnutzergruppe unserer gebauten Umwelt sein. Die Bauaufgaben in diesem Bereich, seien es Seniorenwohnanlagen, Altenpflegeheime, Spezialeinrichtungen für Demenz oder Sterbehospize häufen sich schon jetzt, die Architektenschaft hat die Notwendigkeit erkannt, sich fortzubilden; man besucht Vorträge, bewirbt sich um Preise und versucht, trotz der vielen Einschränkungen durch Vorschriften und Notwendigkeiten »gute Architektur« zu machen. Wenn man realisierte und auch preisgekrönte Projekte aber kritisch ansieht und sich fragt, ob auf diese neue Herausforderung wirklich angemessen reagiert wird, kommen Zweifel auf, vor allem, wenn man nicht nur auf die »architektonische Qualität« sondern auf ihre Tauglichkeit im Sinne eines Social Design schaut.
Oft entscheiden sich bei ambitionierten Projekten Architekten wie Bauherren im – vermeintlichen – Konflikt zwischen anspruchsvoller und innovativer Architektursprache und Tauglichkeit für die spezifische Nutzergruppe für den eigenen Geschmack oder das gerade aktuelle ästhetische Repertoire, nicht wissend oder nicht wissen wollend, welche Nachteile damit für die Lebensqualität von älteren Menschen verbunden sein können.
Offenbar hat sich das bauliche Lösungsrepertoire noch nicht ausreichend auf die besondere Verwundbarkeit älterer Menschen eingestellt. Besonders gravierend ist dies, wenn sie körperlich hinfällig sind oder ihr Geist verwirrt ist. Andere Länder, wie zum Beispiel Schweden scheinen die Belange einer alternden Gesellschaft bereits viel weitergehend berücksichtigt zu haben, als wir. Ein Indiz dafür ist die Schwierigkeit, hierzulande zu erschwinglichem Preis für Senioren taugliche technische Produkte ohne stigmatisierende Anmutung zu bekommen.
Es scheint von den Planungsverantwortlichen noch nicht deutlich genug wahrgenommen zu werden, welche Dimension der Wandel zu einer von Älteren dominierten Gesellschaft hat. Die Wichtigkeit von Barrierefreiheit ist Dank der intensiven Lobbyarbeit der Behindertenverbände ins Bewusstsein gedrungen und in Vorschriften verankert, darüber hinaus ist aber nur bei einer kleinen Gruppe von Architekten eine Sensibilisierung für die besonderen Bedürfnisse Älterer erfolgt oder gar Handlungssicherheit entwickelt. Der notwendige Paradigmenwechsel hin zu Social Design, ist offenbar noch nicht ausreichend vollzogen. Noch ist nicht bewusst, welche immense Einschränkung von Lebensqualität durch eine nicht angemessene bauliche Umgebung verursacht werden kann, wie verwundbar eine Abnahme der altersbedingten Kompetenz machen kann. Vom amerikanischen Umweltpsychologen Powell Lawton geprägt wurde das gedankliche Modell der notwendigen Passung zwischen den Fähigkeiten der Menschen, mit Umwelt kompetent umzugehen und den Anforderungen, die Umwelt an sie stellt (»person-environment-fit«). Das heißt für Architekten und Bauherrn von Senioreneinrichtungen, dass es darum geht, sich sehr genau mit den Fähigkeiten und Grenzen der künftigen Nutzer zu befassen, um eine bauliche Umwelt zu schaffen, die weder über- noch unterfordert.
Eigentlich wissen wir es ja: Im Alter nimmt die Reichweite der Aktivitäten eher ab, das verfügbare Territorium schrumpft, und ist im schlimmsten Fall bis auf ein Bett in Pflegeheim reduziert. Wenn in dieser klein gewordenen Welt keine Rücksicht genommen wird auf altersbedingte Veränderungen wie beispielsweise die Sehschwäche, die Blendempfindlichkeit, das schlechtere Hören und die damit verbundene Schwierigkeit, sich bei lauten Hintergrundgeräuschen in halligen Räumen noch zu verständigen. Wenn die eingeschränkte Mobilität, die verlangsamte Reaktionsfähigkeit, das erhöhte Sicherheitsbedürfnis oder sogar der Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit durch Demenz einfach ignoriert wird, dann wird der Begriff des »Brutalismus« in der Architektur mit einem ganz neuen Sinn erfüllt und man muss sich ernsthaft fragen, ob wir als Architekten unserer sozialen Verantwortung noch gerecht werden.
Wenn sich (so geschehen vor einigen Jahren bei einem Pflegeheimprojekt in Berlin), ein Star-Architekt aus städtebaulichen Gründen erfolgreich weigern kann, zwei Teile einer Pflegeeinrichtung ebenerdig miteinander zu verbinden und schwer verwirrten Menschen damit zumutet, ihren Weg von einem Haus ins andere durch den Keller zu suchen, dann stimmt etwas nicht mit der Ethik dieses Berufs.
Es ist möglich – und der geneigte Leser möge die in diesem Heft dokumentierten Projekte daraufhin kritisch prüfen – ambitionierte Architektur und Verantwortung für verwundbare Menschen miteinander zu verbinden. Es ist möglich, eine Architektursprache zu entwickeln, die auf unauffällige, nicht stigmatisierende Weise die altersbedingt reduzierte Leistungsfähigkeit kompensiert und Sicherheit vermittelt, und gleichzeitig eine Fülle von Anregungen ohne Überforderung bietet.
Es wird dann allerdings nötig, ein Gebäude so auszubilden, dass Orientierung leicht fällt. Dies führt nicht zwangsläufig zu sturen, undifferenzierten Grundrissen, sondern kann durch unterschwellig wirkende räumliche Führung, besonders gestaltete Orte, die als »Landmarken« wirken und durch Blickbezüge zu Referenzpunkten nach außen erreicht werden. Hinweistafeln sind nur dann hilfreich, wenn auf den so elegant wirkenden »Silber auf Glas-Look« verzichtet wird und stattdessen große, kontrastreiche, gut lesbare Schilder in Augenhöhe angebracht werden.
Es wird auch immer wichtiger, bei der Licht- und Farbgestaltung die altersbedingten Einschränkungen des Sehens zu berücksichtigen und nicht nur den Geschmack des Architekten oder Bauherrn. Dann würden die beliebten Allzwecklösungen mit »Down-Lights« abgelöst werden von einer differenzierten Lichtgestaltung mit hohem Anteil an blendfreiem indirekten Licht, ergänzt um eine Modulation der Lichtfarbe und Intensität, die sich auf die Stimmung und den Tag-Nacht Rhythmus von Pflegeheimbewohnern positiv auswirkt.
Es würden kräftige Farben eingesetzt werden, die auch vom gealterten Auge noch gut wahrgenommen werden können, mit Farb- und Helligkeitskontrasten, wo etwas gut erkennbar sein soll. Der Architekt würde mit Tränen in den Augen, aber mit gutem Gewissen auf voll verglaste Türen verzichten, an die der verzweifelte Nutzer später neckische Scherenschnitte kleben muss, um Unfälle zu verhindern.
Es würde in Pflegeheimen auch keine Flure mit Verglasungen bis zum Boden mehr geben, die für viele Ältere eher Unsicherheit erzeugen, als Geborgenheit vermitteln und in denen bei Nacht von der Straße aus demenzkranke Menschen im Nachhemd besichtigt werden können. Treppen in Pflegeheimen hätten Setzstufen und sicher anmutende Geländer – nicht nur dünne Stahlseile –, sie würden an einer Wand entlang geführt werden und Sicherheit vermitteln – und nicht wie eine Flugzeugtreppe frei in den Raum ragen.
Bei der Innenraumgestaltung insbesondere der Materialwahl würde nicht nur die visuelle Wirkung eine Rolle spielen, sondern auch die anderen Sinne angesprochen werden und bei der Materialwahl würde auch der haptische Reiz oder – wie exotisch – der Geruch eine Rolle spielen.
Ein Flur im Pflegeheim wäre dann nicht von einer kafkaesk anmutenden, monotonen Ansammlung von Türen geprägt – die vom Personal in seiner Hilflosigkeit mit Ährenkränzen geschmückt wird – sondern ein räumliches Erlebnis, weil zum Beispiel die Form der Wände das Ausschreiten dynamisch begleiten, den Raum mit Farbe und Licht strukturieren und sich immer wieder Ruhepunkte mit attraktiven Blickbezügen anbieten.
Bei Preisgerichten würden nicht nur Sach- und Fachpreisrichter, sondern auch Senioren als Interessenvertreter der künftigen Nutzer mitreden, für die es eine wesentliche Rolle spielen dürfte, ob die Architektur für das neue Pflegeheim irgendeine Assoziation zu einem Wohnhaus zulässt, in dem man den Rest seiner Tage verbringen möchte. Dann wäre auch wichtig, ob die Innenraumgestaltung so offen ist, dass ein Stückchen persönlicher Aneignung möglich ist oder sogar nahe gelegt wird, und sei es durch ein Hirschgeweih am Lieblingsplatz des passionierten Jägers.
Die Architektur von Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen würde dann mehr Bezug nehmen zu aktuellen fachlichen Entwicklungen in der Altenhilfe, die schon lange von den institutionell geprägten Konzepten weg gekommen sind und kleinräumige Wohnformen bevorzugen. Es würde sich eine Typologie entwickeln, die weniger spektakulär, weniger von architektonischen Leitkonzepten geprägt ist und es würde das Bemühungen deutlicher werden, Wohnorte für ältere Menschen zu einem ganz normalen Stück Heimat zu machen.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2007.12.17
17. Dezember 2007 Sibylle Heeg
Altenwohnanlage in Kopenhagen
Die Stadtverwaltung von Frederiksberg in Kopenhagen hatte einen Wettbewerb für den Neubau einer Altenwohnanlage ausgelobt, die als »Altenhotel« genutzt werden soll, während andere städtische Altenwohnungen saniert werden. Das zentral gelegene, aber recht kleine Baugrundstück befindet sich im Blockinneren eines Stadtentwicklungsgebietes auf dem Gelände einer ehemaligen Industriebrache. Im Zuge einer Stadtteilerneuerung soll diese von einer unregelmäßigen Blockrandbebauung ersetzt werden. Die Altenwohnanlage präsentiert sich dabei als Solitär im geplanten städtischen Park im Inneren dieses Blockes. Der Solitär enthält ein Sockelgeschoss mit Gemeinschaftseinrichtungen und Büros sowie vier Obergeschosse mit insgesamt 50 Wohnungen.
Um die Rahmenbedingungen des Bebauungsplanes zu erfüllen, liegt das Sockelgeschoss einen Meter unter Geländeniveau. Daher betritt man das Gebäude über einen leicht geneigten Vorplatz und gelangt in das große Foyer im Zentrum des ellipsenförmigen Grundrisses. Sämtliche Funktionsräume sind in einem Ring um dieses Foyer organisiert, wodurch das Foyer zum Drehpunkt des Hauses wird. Dem Mehrzwecksaal ist im Südwesten eine große geschützte Gemeinschaftsterrasse vorgelagert, die durch eine Rampe mit dem Park verbunden ist.
Die vier Wohngruppen in den Obergeschossen sind mit Aufzügen vom Sockelgeschoss zu erreichen. Jede Wohngruppe besteht aus 12 bis 13 Wohnungen verschiedener Größe sowie Gemeinschaftseinrichtungen. Erfahrungen aus ähnlichen Einrichtungen zeigen, dass die meist alten und schwachen Bewohner einen Grossteil ihres aktiven Tagesverlaufes in den Gemeinschaftsbereichen verbringen. Hier können sie ihre Nachbarn treffen, hier wird das Essen in der offenen Küche zubereitet und serviert und hier ist das Pflegepersonal immer in der Nähe. Das Leben findet in den Gemeinschaftsbereichen statt und daher war das Motto für die Grundrisslösung »Gemeinschaft im Zentrum«: Im Innenbereich der Ellipse befinden sich sämtliche Gemeinschaftsflächen. Von hier kommt man direkt in die privaten Wohnungen, die sich im Außenring der Ellipse befinden.
Jeder Bewohner verfügt über eine Wohnung, die aus einem Schlafraum in direkter Verbindung mit dem behindertengerechten Bad sowie einem Wohnraum mit integrierter Teeküche und Einbauschränken besteht. Alle Wohnungen haben geschosshohe Fensteröffnungen mit Ausblick in den städtischen Park. Der Außenring ist an zwei Stellen durch gebäudehohe »Lichtspalten« unterbrochen, die Tageslicht in die zentralen Gemeinschaftsbereiche bringen. In diesen Lichtspalten befinden sich die Gemeinschaftsbalkone der einzelnen Wohngruppen.
Die Verteilung der unterschiedlichen Wohnungsgrößen war durch den Auslober verbindlich vorgegeben und ergab eine ungleiche Anzahl und Größe der Wohnungen in den einzelnen Geschossen. Diese Vorgabe wurde zum architektonischen Motiv in Form einer geneigten Außenwand, die den breiten Lichtspalt seitlich begrenzt. Dadurch wurde gleichzeitig die abnehmende Intensität des Tageslichts in den unteren Geschossen kompensiert.
Die Fassade des Gebäudes ist mit geschosshohen Fensteröffnungen unterschiedlicher Breite im Wechsel mit geschlossenen Wandabschnitten rhythmisiert, die mit anthrazitgrauen Schieferplatten bekleidet wurden. Das Sockelgeschoss wurde mit einer Putzfassade ausgeführt. Dadurch wirkt das Gebäude aus der Entfernung als homogenes Volumen, das durch die markanten Lichtspalte akzentuiert wird und auf einem visuell niedrigen Sockelgeschoss ruht. Die anthrazitgraue Fassade steht in spannungsvollem Kontrast zur grünen Umgebung.
Die Konstruktion des Gebäudes wurde in der in Dänemark üblichen Bauweise aus vorgefertigten Leichtbeton-Wandelementen und vorgespannten Beton-Deckenelementen ausgeführt. Aufgrund der besonderen Gebäudeform mit gekrümmter Fassade wurden die Wohnungstrennwände als tragende Schotten ausgeführt und die Fassaden als leichte Vorhangkonstruktion in Form geschosshoher gekrümmter Holzrahmenelemente. Für die Fenster wurden industriell hergestellte Holz-Aluminium-Elemente mit eloxierter Oberfläche verwendet. In dieser Bauweise war es möglich, das ungewöhnliche Gebäudevolumen mit langlebiger Fassade innerhalb des üblichen Budgets für öffentlich geförderten Wohnungsbau auszuführen.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2007.12.17
17. Dezember 2007
verknüpfte Bauwerke
Altenwohnanlage
Hospiz in Stuttgart
Für die Katholische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart entstand ein Gebäudekomplex, der ein stationäres Hospiz mit acht Pflegebetten für schwerkranke »Gäste« und die Referate Trauerpastoral und Sterbepastoral sowie die ambulante Hospizarbeit beherbergt. Zusätzlich entstand ein neuer Stützpunkt für die katholische Sozialstation. Gruppenräume stehen für eine vielseitige Nutzung zur Verfügung und sind für Veranstaltungen mit unterschiedlichen räumlichen und technischen Anforderungen flexibel ausgestattet. So sind sowohl gut ausgeleuchtete Schulungsveranstaltungen, medienunterstützte Vorträge als auch kleine Feiern oder Trauerfeiern mit behaglicher Stimmung möglich. Diese drei eigenständigen Nutzungen bilden gemeinsam ein umfassendes Angebot nicht nur für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. Weiterhin befinden sich im Gebäude eine Wohnung für vier im Haus tätige Ordensschwestern und eine Mitarbeiterwohnung.
Ein geometrischer Quader setzt die Gebäudelinie an der Jahnstraße fort. Er wurde in der Diagonalen »aufgeschnitten« und in einen Ost- und einen Westtrakt geteilt. Die beiden Gebäudeteile sind im Gartengeschoss und im 1.Obergeschoss miteinander verbunden. Nach außen zeigt der kantige Baukörper eine rauhe, ziegelfarbige, schützende Haut und stellt damit Bezüge zum Ort her, während im Hofbereich helle, glatte Wände in weichen Formen einen Filter zwischen Innen und Außen formen. Der Hof verbindet nicht nur die eng miteinander korrespondierenden Nutzungen des Hauses, sondern lädt auch die Öffentlichkeit zum Durchlaufen und zum Verweilen ein. Er bildet somit funktional eine Art »Foyer« unter freiem Himmel, in dem Begegnung und Austausch stattfinden können. Der tragende Gedanke einer christlichen Gemeinschaft wird durch die räumliche Struktur der Verflechtung der internen und externen Erschließungsflächen gelebt. Auf eine Einfriedung des Geländes wurde bewusst verzichtet.
Die Hauptzugänge für das Hospiz, die Sozialstation und die Gruppenräume befinden sich im hellen Innenhof auf der Ebene der Jahnstraße. Die Freitreppe in der Innenzone überbrückt das Gefälle zur Reutlinger Straße. Stellplätze sind ausschließlich entlang der Reutlinger Straße zu finden. An der Jahnstraße befindet sich eine Zufahrt für Krankentransporte, so dass der Einzug für die Gäste unkompliziert über die Haustüre erfolgen kann. Die Wohnung im 2.Obergeschoss hat einen separaten Zugang von Osten. Die Schwesternwohnung im Gartengeschoss ist von Süden ebenfalls separat erschlossen.
Die Baukörper sind in konventioneller Stahlbetonbauweise erstellt. Die Gebäudehülle mit verputztem Vollwärmeschutz, Lochfassade mit Holzfenstern und extensiver Begrünung des Flachdachs ermöglichte eine wirtschaftliche Erstellung und verspricht die Nachhaltigkeit der Gebäudesubstanz sowie niedrige Unterhaltskosten. Der Innenausbau erfolgte klassisch mit verputztem nichttragendem Mauerwerk und Gipskartonwänden. Das Hospiz als Ort der Begegnung und des Rückzugs bietet auch im Innern Bereiche mit unterschiedlicher Aufenthaltsqualität. Orte der Begegnung und des Austauschs und Orte des Rückzugs sind für alle Nutzer zugänglich und frei wählbar. Das Leben im Gastzimmer bietet eine individuelle Regelung des Maßes der Einbindung in die Gemeinschaft. Unterschiedliche Stellungsmöglichkeiten des Bettes lassen die Gäste gleichzeitig oder ausschließlich den Blick in die Landschaft oder in den Wohnbereich der Gemeinschaft wählen.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2007.12.17
17. Dezember 2007
verknüpfte Bauwerke
Hospiz
Seniorenwohnanlage in Zürich
Entlang der Wehntalerstrasse bildet die neue Siedlung mit Alterswohnungen, Kinderkrippe und Eltern-Kind-Zentrum ein lokales Zentrum in der Mitte von Affoltern. Aufgrund der lockeren Bebauungsstruktur und der starken Durchgrünung besteht ein einer Gartenstadt ähnliches Raumgefüge. Dieser Aspekt wird von drei in der Höhe abgestuften Baukörpern aufgenommen, welche zueinander versetzt sind und so in alle Richtungen freie Durchblicke erlauben. Die Sockel nehmen die publikumsnahen Nutzungen auf. Sie sind so zueinander angeordnet, dass im Erdgeschoss klar definierte Freiräume unterschieden werden können: Zum Park hin ein öffentlicher Platz unter einem Baumdach, zu den niedrigen Doppeleinfamilienhäusern im ruhigen und geschützten Bereich hin die Spielwiese der Kinderkrippe, an der Neuwiesenstrasse die Parkplätze. Der Gemeinschaftsraum, der Treffpunkt im Eltern-Kind-Zentrum und der Eingang der Kinderkrippe sind übereck zueinander angeordnet und bilden so im Zentrum der Siedlung einen wichtigen Begegnungsort. Die Eingänge der Wohnhäuser sind an den publikumsnahen Rändern der Siedlung positioniert, um eine gute Auffindbarkeit und Übersichtlichkeit zu garantieren. So bleibt den Bewohnern freigestellt ob sie am gemeinschaftlichen Leben der Siedlung teilhaben wollen oder nicht.
Durch die Anordnung der Wohnungen in den Gebäudeecken profitiert jede Einheit von der Eckposition und dem Ausblick in verschiedene Richtungen. Die längs der Fassaden organisierten Wohnungen erlauben eine optimale Belichtung der Räume. Die Wohnungen werden jeweils über eine räumlich abgetrennte Garderobe betreten. Von der Garderobe öffnet sich der Blick über die Raumdiagonale des Wohnraumes zur Fassade und der Aussicht. Ein zweiseitig zugängliches Schrankmöbel dient der Raumabtrennung, integrierte Schiebetüren erlauben es, den Wohnraum über die Fassade mit dem Schlafzimmer zu verbinden. Alternativ lässt sich anstelle der Schiebetüre auch eine Flügeltüre einsetzen. Die Küche ist in einer Raumnische eingefügt und kann mit einer Faltwand vom Wohnraum abgetrennt und unabhängig benutzt werden. Die Bäder sind behindertengerecht. Mit diesen Maßnahmen wird die Wohnlichkeit (helle Räume, Nischen, Holzschränke) mit einer größtmöglichen räumlichen Flexibilität kombiniert. Die durch Seitenwände von Wind und Lärm geschützten Balkone können jeweils vom Schlafzimmer wie auch dem Wohnzimmer begangen werden. Die Balkone sind geschossweise zueinander versetzt, so dass ein geschützter wie auch ein offener zweigeschossiger Außenraum mit guter Besonnung entsteht. Der gewünschte Wohnungsmix aus Zweizimmerwohnungen und kleinen Dreizimmerwohnungen wird auf jedem Geschoss angeboten. Durch den geschossweisen Wechsel der Wohnungen können die einzelnen Wohnungstypen mit unterschiedlichen Orientierungen angeboten werden.
Aufgrund der einfachen und über alle Geschosse gleich bleibenden statischen Grundstruktur, lassen sich die Baukörper auch in Zukunft neuen Wohnvorstellungen anpassen. Die mittig liegenden Sanitärkerne und die Fassade sind tragend ausgebildet, dazwischen werden die Räume frei eingeteilt.Architektur + Wettbewerbe, Mo., 2007.12.17
17. Dezember 2007
verknüpfte Bauwerke
Siedlung Frieden