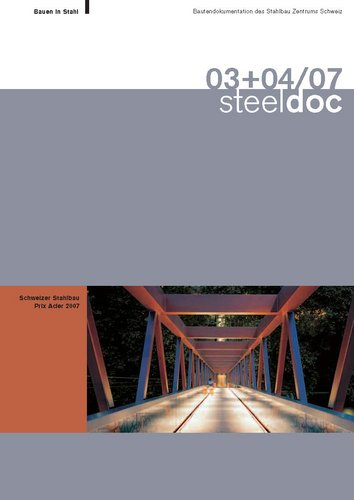Editorial
Der Schweizer Stahlbaupreis Prix Acier wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. Ins Leben gerufen wurde diese Auszeichnung im Jahre 2005, als mehrere bedeutende Schweizer Stahlbauten entstanden waren und sich eine Fachjury aus Architekten und Ingenieuren der schwierigen Frage gegenüber sah, eines der Projekte für den Europäischen Stahlbaupreis zu nominieren. Dass die Schweiz eine eigene Auszeichnung für herausragende Bauwerke in Stahl verdient hat, zeigt sich auch dieses Jahr. Von 22 eingereichten Projekten wurden vier prämiert und vier weitere wurden mit einer «Anerkennung» bedacht. Auch in Zukunft soll der Prix Acier alle zwei Jahre an Bauwerke vergeben werden, bei denen Stahl als architektonisches Ausdrucksmittel in besonders sorgfältiger Weise zur Anwendung kam. Ziel ist die Förderung der Schweizer Stahlbaukompetenz und die Sensibilisierung für das technische Potenzial und die architektonische Ausdrucksstärke des Stahlbaus.
Im vorliegenden Steeldoc stellen wir die vier Preisträger und die vier Anerkennungen des Prix Acier 2007 vor. Das wohl grösste Projekt und jenes mit der grössten Publikumswirkung ist das Stadion Letzigrund in Zürich. «Das schönste Stahldach der Welt» titulierte die Zeitschrift Hochparterre das schwebende Atoll im Stadtraum. Was so leicht und mühelos auf tanzenden Stützen schwebt, ist ein Meisterwerk an Präzisionsarbeit. Dieser Stahlbau wird wohl als eine der grossen konstruktiven Herausforderungen der Epoche in die Geschichte eingehen. Wie man die Überwindung des Limmatgrabens in Baden zu einer poetischen Wegfigur moduliert, zeigt das Ensemble Limmatsteg mit Promenadenlift in Baden. Lautlos gleitet der Promeneur durch ein räumliches Fachwerk aus Stahl mit Blick auf die hohen Stämme der Platanen und findet sich auf dem Niveau des Wassers vor einer lichten, liegenden Stahlskulptur wieder, deren Durchquerung zu einem Naturerlebnis wird.
Der Bushof der Reisefirma Twerenbold taucht den Reisenden schon vor seiner Abfahrt in ein lichtes, südliches Ambiente. Sechzig Meter überspannt eine drei Meter hohe räumliche Stahlstruktur mit einer magischen Leichtigkeit. Stahl und Holz ergänzen sich ideal im Competence Centre des Lifestile-Konzerns Hugo Boss in Coldrerio. Der Verbund der beiden Materialien kam dem Wunsch der Bauherrschaft nach einer Bauweise entgegen, die edles Design, optimales Arbeitsklima und nachhaltiges Energiekonzept vereint. Dann werden die vier Anerkennungen des Prix Acier dokumentiert: die Aussichtsplattform Conn in Flims, der Bushof in Meilen, das Vordach der Gemeindeverwaltung Affoltern am Albis und die Markthalle auf dem Kirchplatz von Dietikon.
Wie immer wird bei der Darstellung der Projekte Wert aufs Detail gelegt. Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium der nachfolgenden Seiten von Steeldoc und gratulieren den Preisträgern zu ihrer herausragenden Leistung.
Inhalt
03 Editorial
04 Stadion Letzigrund, Zürich
Fliegendes Atoll im Stadtraum
12 Limmatsteg mit Promenadenlift, Baden/Ennetbaden
Wegfigur zwischen den Elementen
18 Busterminal Twerenbold, Baden
Hommage ans Reisen
24 Hugo Boss Competence Centre, Coldrerio
Hybridwerk aus Stahl und Holz
30 Aussichtsplattform Conn, Flims
Segler über der Ruin Aulta
34 Vordach Gemeindezentrum, Affoltern am Albis
Lichter Farbraum aus Stahl und Glas
38 Bushof, Meilen
Kubische Skulptur
42 Markthalle Kirchplatz, Dietikon
Klassischer Typus – zeitgemäss interpretiert
46 Prix Acier 2005/2007 – die Ausstellung
47 Impressum
Stadion Letzigrund, Zürich
(SUBTITLE) Fliegendes Atoll im Stadtraum
Das schwebende, weit auskragende Stahldach des Stadion Letzigrund wird von tanzenden Stützenpaaren getragen. Ein breiter, leicht ansteigender Umgang lässt sowohl den offenen Stadionraum als auch die Stadt erfahren. Hinter der Poesie und Leichtigkeit der Form steckt ein Höchstmass an anspruchsvoller Präzisionsarbeit.
Jedes Stadion ist ein Koloss im Stadtgefüge. Der Massstabssprung zwischen der urbanen Bebauung und einem Schiff, das bis zu 30000 Menschen fasst, ist zwangsläufig gigantisch. Gegen aussen schotten sich die meisten Stadien mit einer abweisenden, geschlossenen Hülle ab – denn alle Blicke richten sich aufs Spielfeld. Für die Stadt Zürich war dieser Aspekt einer der neuralgischen Punkte. Denn das neue Stadion Letzigrund sollte in einem Stadtteil errichtet werden, wo sich im Laufe der Stadtentwicklung Wohn- und Geschäftsquartiere dicht aneinander fügten. Die Anwohner fürchteten den starren Koloss, der mit Ausnahme einiger fulminanter Stunden pro Woche die meiste Zeit über menschenleer, teilnahms- und nutzlos den wertvollen Lebensraum besetzt. Die Architekten entwickelten also ein Konzept für das neue Stadion, das dieses Teil des Stadtgefüges werden lässt. Einmal durch die räumliche Einbindung und Gestaltung, dann durch eine lebendige Nutzung des Areals und der Infrastruktur ausserhalb der Spielzeiten.
Städtebauliche Einbindung
Die Topographie des Ortes kam dieser Idee entgegen. Unter dem bestehenden alten Stadion befand sich nämlich eine ehemalige Kiesgrube, die den Beweis lieferte, dass hier ohne weiteres in den Boden gegraben werden konnte. Als positiver Nebeneffekt wurde das Aushubmaterial auch gleich für die Betonarbeiten der Stadionfundamente verwendet. Analogien fanden die Architekten in antiken Stadien, wie beispielsweise dem Amphitheater von Syrakus, dessen Spielfeld ebenfalls tiefer liegt als die Stadtebene. So kommt es, dass das Stadion sich gegenüber der Stadt lediglich um maximal 14 Meter erhebt, das Spielfeld aber 7 Meter unter dem Stadtniveau liegt. Vom Haupteingang her betritt man das Stadion sogar ebenerdig und flaniert mit einer quasi unbemerkten Steigung von 2 Prozent leicht aufwärts auf einer breiten Promenade mit Blick sowohl auf die Stadt wie in den sich absenkenden Stadionraum. So schiebt sich der Stadionkörper so leise in die Höhe, dass sich das Volumen eher als gebaute Topographie ausnimmt. Die höchste Stelle befindet sich an der dem Eingang gegenüberliegenden Längsseite des Ovals, und von dort aus geht die Neigung wieder abwärts und das Oval schliesst sich. Man muss sich diese Geometrie vorstellen, als liege ein ovaler Suppenteller in leichter Schieflage in einem Sandbett.
Fliegendes Atoll und tanzende Stützen
Das Dach ist ein schützender Baldachin und schwebt wie ein ringförmiges Atoll über der oval geschwungenen Promenade und den Zuschauertribünen. Dieses Dach verkörpert die Dynamik des Geschehens. Seine Untersicht ist glatt und wie mit einem Pinselstrich um die Arena gezogen – zum Spielfeld und zur Stadt hin leicht aufgeworfen. Um diesen schwebenden Effekt zu erreichen, wird das Dach von tanzenden Stützenpaaren getragen, so dass sich der weitläufige Raum unter dem Dach ungerichtet auszudehnen scheint und sich die Dachkante mit dem Himmel verwebt. Diese Stützenpaare stehen nicht nur schräg, wobei jede in eine andere Richtung zeigt, sie sind auch noch in sich verdreht. Die architektonische Idee dahinter ist die Ausblendung ihrer Funktionalität – obwohl diese nicht von der Hand zu weisen ist – zugunsten der visuellen Autonomie des schwebenden Daches. Die Verdrehung ist aber auch das Resultat der unterschiedlichen Geometrien des Tribünenkörpers und des Daches, die auf verschiedenen Radien und Zentren basieren. Die Stützen als Verbindungsstück der beiden Ebenen passen sich an den Stützenfüssen der Geometrie der Tribünen an, an den Stützenköpfen der Geometrie des Daches.
Komplexe Geometrie
Ein Aspekt der geometrischen Eigenheit des Daches ist die Anordnung der innen liegenden, 20 Meter hohen Flutlicht-Masten, welche ein massgebender Faktor der Nachtinszenierung des Stadions sind. Diese Masten sind leicht nach aussen geneigt und säumen in absolut gleichmässigen Abständen den inneren Ring der Dachkante. Das bedeutet, dass die tragenden Achsen des Stadiondaches nicht auf ein gemeinsames Zentrum laufen, was ja sonst in den inneren Kurven des Ovals engere Abstände zur Folge hätte. Zudem ist das Dach auf der Seite der Haupttribüne tiefer, und das Oval selbst ist nicht symmetrisch, sondern hat eine längere grade Längsseite - wegen der Laufbahn für die Leichtathletik- Wettkämpfe - und damit zwei verschiedene Kurvenachsen, nämlich eine engere und eine weitere.
So hat jedes Segment des Daches andere Abmessungen und natürlich auch andere Krafteinwirkungen. Das Stahldach des Stadion Letzigrund hat eine der bisher grössten Auskragungen eines Bauwerks in der Schweiz, nämlich bis zu 33 Meter gegen das Stadioninnere. Insbesondere im Verhältnis zu der Grösse des Daches sind die Stützen überaus filigran. Weit auskragendes Dachtragwerk Haupttragelemente des Stahldaches sind insgesamt 31 Vollwandbinder mit einer maximalen Länge von 40 Metern, die jeweils auf einem Stützenpaar aufliegen. Während die Auskragung über der Haupttribüne 33 Meter beträgt, sind es an der gegenüberliegenden Seite knapp über 20 Meter. Die Träger haben eine variable Höhe zwischen 1.10 und 3.45 Meter, bei einer Länge zwischen 29 und 43 Meter. Auch die Materialdicke der Stahlbleche variiert zwischen 20 bis 100 mm. Das maximale Gewicht eines Trägers liegt bei 52 Tonnen.
Die Binder wurden vorverformt gefertigt, damit sie unter ihrem Eigengewicht die gewünschte Form erhalten. Die Überhöhung an der Spitze des Binders mit der grössten Auskragung beträgt 34 Zentimeter, um nebst der Auskragung auch die Last der daran montierten Lichtmasten zu tragen. Die Felder zwischen den Dachbindern werden von Pfetten überspannt, welche als Durchlaufträger mit Spannweiten bis zu 24 Meter wirken. Die Trägerhöhe der Pfetten ist, bis auf die der innersten Pfette, konstant 60 Zentimeter. Den Dachabschluss am Innenrand bildet ein Profil HEA 700, das über den Stadionkurven um die schwache Achse gebogen ist und sich dem Grundriss der darunter liegenden Laufbahn anpasst. In jedem dritten Dachfeld sind Dilatationsfugen in den Pfetten angeordnet, welche temperaturbedingte Bewegungen zulassen.
Die tanzenden Stützenpaare
Die Stützen sind im Raum geneigt und haben einen sich stetig verjüngenden Querschnitt, wobei Kopfund Fussplatte ausserdem noch zueinander verdreht sind. Die Verdrehung beruht auf der unterschiedlichen radialen Achsenlegung der Tribünengeometrie und der Dachgeometrie. Der Winkel dieser Verdrehung bestimmt auch dieVerdrehung des jeweiligen Stützenquerschnitts und beträgt im Maximum 19 Grad. Weil das Dach über der Haupttribüne höher ist als auf der Gegenseite, haben die Stützen unterschiedliche Längen. Daraus folgt, dass jede Stütze ihre eigene Geometrie und Belastung hat, was für die Berechnung und für die Ausführungsplanung einen grossen Aufwand bedeutete.
Die Stützen bestehen aus kastenförmig geschweissten, tragenden Stahlblechen mit einem inneren Vollstahlkern und wurden nach der Bewehrung mit Beton ausgegossen. Im sichtbaren Bereich wurde wetterfester Stahl verwendet, der eine durch den Rostprozess entstandene rötlich-braune Färbung annimmt, die paradoxerweise gleichzeitig den Korrosionsschutz bildet. Da die Stützen bei der Herstellung im Werk um den entsprechenden Winkel (bis 19 Grad) verdreht werden sollten, musste deren Materialstärke auf maximal 20mm begrenzt werden, damit die Verdrillung überhaupt möglich war. Hülle und Kern Aufgrund der asymmetrischen Auskragung des Daches besteht das Stützenpaar aus einer Zugstütze und einer Druckstütze. Die Druckstützen haben einen grösseren Querschnitt und sind mit Längseisen bewehrt. Zusätzlich verläuft ein runder Vollstahlkern von der Kopfplatte der Stütze in die untere Ecke, wo die grössten Druckspannungen auftreten. Kopfbolzendübel an den Mantelblechen tragen zur Verbundwirkung bei und verhindern das Ausbeulen des Stützenmantels. Im Innern der Druckstützen sind ausserdem Rohre für Elektroleitungen und die Abführung des Dachwassers untergebracht. Die Druckstützen wurden im Werk auf dem Kopf stehend im oberen Teil ausbetoniert und nach dem Aushärten auf die Baustelle geliefert. Zum Zeitpunkt der Montage betrug das Stützengewicht bis zu 18 Tonnen, die fast vollständig in der oberen Stützenhälfte konzentriert waren, während die untere Hälfte zugleich den Bewehrungskorb für die Einspannung in die Auflagerwand bildet und erst nach dem genauen Einpassen ins Fundament einbetoniert wurde.
Die Zugstützen haben einen Zugstützenkern, der aus H-förmig verbundenen Blechen zusammengesetzt ist. Zudem befinden sich um den Stützenkern herum Längseisen. Die Zugkräfte des Kerns werden über Kopfbolzendübel, jene im Stützenmantel über Bewehrungseisen in die Auflagerwand eingeleitet. Am Stützenkopf verbindet ein 650 kg schwerer Doppelbolzen die Zugstütze mit dem Dach. Die Krux der Montage Grundvoraussetzung für das Gelingen dieser überaus komplexen und anspruchsvollen Stahlkonstruktion war natürlich auch eine äusserst genaue Montage, insbesondere der Stützen. Denn eine Abweichung der Stützenköpfe aus ihren Sollpunkten hätte zu einer 10-fach grösseren Abweichung am Innenrand des Stadiondaches geführt. Die Stützen wurden deshalb mit Hilfsstützen und Schablonen in die richtige Position gebracht und erst dann ins Fundament einbetoniert. Die Produktion der Träger erfolgte in zwei eigens dafür eingerichteten temporären Werkstätten in der Nähe der Baustelle. Für den Nachttransport der bis zu 40 Meter langen und 52 Tonnen schweren Träger wurde eine spezielle Auflagerkonstruktion erfunden. Dank einem hydraulischen Raupenkran, der auch eine Neigungskorrektur der Träger in ihrer Längsachse erlaubte, waren Montagezeiten von unter 2 Stunden pro Träger erzielt worden.
Laudatio der Jury
Das Stadion Letzigrund ist der grösste und bedeutendste Schweizer Stahlbau des Jahres 2007. Die anspruchvolle Berechnung und Ausführung der komplexen Dachform erforderte von allen Beteiligten ein Höchstmass an Kreativität und Präzision, welche zudem unter starkem Kosten- und Termindruck geleistet wurden. Das Stadion zeugt von einer poetischen, als städtischer Raum erfahrbaren Sportarchitektur und von der Effizienz und Professionalität der Planung und Ausführung.Steeldoc, Mo., 2007.12.10
10. Dezember 2007 Evelyn C. Frisch
verknüpfte Bauwerke
Stadion Letzigrund
Limmatsteg mit Promenadenlift, Baden/Ennetbaden
(SUBTITLE) Wegfigur zwischen den Elementen
Wo früher noch eine Seilfähre die beiden Gemeinden Baden und Ennetbaden verband, gibt es heute eine neue Wegverbindung aus einer Brücke und einem Turm. Die Raumskulptur aus einem liegenden und einem stehenden Stahlfachwerk markiert urbane Präsenz und fügt sich stimmungsvoll in die wilde Flusslandschaft ein.
Wo früher noch eine Seilfähre die beiden Gemeinden Baden und Ennetbaden verband, gibt es heute eine neue Wegverbindung aus einer Brücke und einem Turm. Die Raumskulptur aus einem liegenden und einem stehenden Stahlfachwerk markiert urbane Präsenz und fügt sich stimmungsvoll in die wilde Flusslandschaft ein. Das Ensemble ist eine Wegfigur – eine begehbare Skulptur aus einem liegenden und einem stehenden Element des gleichen Typus. Stahl und die filigrane Fachwerkstruktur nehmen Bezug auf die Geschichte Badens als frühe Industriestadt und erste Eisenbahnstation der Schweiz. Das dichte Laub der alten Platanen hängt tief über das grünblaue fliessende Wasser und reicht in der Baumkrone praktisch bis hinauf auf die Stadtterrasse. Die beiden Fachwerkkörper inszenieren diese Bewegung, indem sie die Verbindung über das Wasser und durch die Baumkronen hinauf in die Stadt begehbar und erlebbar machen. Nicht umsonst ist diese Wegpassage seit dem Tag ihrer Eröffnung zur attraktivsten und meistbegangenen Promenade für die Badener und Ennetbadener geworden. Horizontale und vertikale Bewegung Das konstruktive Prinzip des Brücken- und des Turmkörpers ist dasselbe. Über dem Wasser liegt ein räumliches Fachwerk; die beiden Seiten bilden sich aus filigranen raumhohen Fachwerkbindern (Warren- Fachwerk), deren Ober- und Untergurte zusammen mit den Querträgern zu Vierendeelträgern verbunden sind. Dadurch bildet sich quasi ein offener Hohlraum. Dieser Aufbau wiederholt sich im Turm so, als wäre die Brücke lediglich aufgestellt worden. In der Vertikalen wird das Fachwerk jedoch immer körperhafter. Der stehende Fachwerkbinder nimmt zur Hangseite hin skulpturale Masse an und bildet sich oben zu einem geschlossenen Turmkopf aus. Die Passerelle, die vom Turmkopf auf die Stadtterrasse führt, hat zwar noch den Vierendeelträger als Gehweg, doch die tragenden, seitlichen Teile sind als geschlossene Kastenträger ausgebildet. Diese materielle Verdichtung verankert den Turm und die Stadt-Passerelle im Hang und spielt mit Stämmen und dem Geäst des üppigen Baumbestandes.
Die glimmende Farbigkeit
Farblich spielt die Brücke mit dem archaischen Farbton von wetterfestem Stahl (Corten-Stahl). Dieser «Naturton» kontrastiert als Komplementärfarbe mit dem grünen Laub und dem blau-grünen Wasser. Je nach Tageslicht verändert die Brücke ihre Leuchtkraft. Nachts kommt sie durch eine wunderbar inszenierte indirekte Beleuchtung zum Erstrahlen. Die Gehwege sind mit linear geführten Lichtbändern untermalt. Der Widerschein vom engmaschigen Gitterrost der Gehfläche erhellt wiederum indirekt das ganze Stahlskelett und bringt dieses zum Glimmen. Ebenfalls wird die Panorama-Aufzugkabine als vertikale Verbindung mit einem vollflächigen Deckenlicht erhellt. Mit punktuellem Licht wurden die «Orte» markiert, das heisst Vorplätze, Podeste der Evakuationszone, die Schachtgrube des Aufzuges sowie der Aufzugsmaschinenraum.
Aufgelöste Strukturen
Der Brückenkörper ist als aufgelöster Kasten ausgebildet. Läuft man über den Gehweg aus Gitterrost, bemerkt man die Verjüngung der Querschnitte der Ober- und Untergurtprofile. Diese «Ausdünnung» ergibt sich durch die geringere statische Anforderung in der Brückenmitte und führt zu einer höheren Filigranität und Leichtigkeit der Struktur. Auch die Profile des Aufzugsturmes verjüngen sich mit zunehmender Höhe stufenweise, so dass sie der Perspektive entgegenwirken und den Turm optisch verkürzen. So gleicht der Turm in der Ansicht einer Jakobsleiter – aus der Sicht der Aufzugskabine gleicht die Limmatbrücke in analoger Weise einer Wasserleiter, deren verstärkte Enden und die schlanke Mitte den Kräfteverlauf in der Horizontalen abbilden. Hochtransparente Verglasungen trennen beim Turm den eigentlichen Aufzugsschacht von der Evakuationszone. Die lautlose Fahrt durch die Turmstruktur von der Stadtterrasse über den Ölrainhang hinunter zur Limmatpromenade hat etwas Befreiendes und eröffnet dem Betrachter verschiedene Perspektiven auf den Flussraum, die üppige Vegetation und die Konstruktion selbst. Bei der Brücke bilden die gleichen Verglasungen die Geländerbrüstungen. Das Glas wurde zum Schutz der Vögel mit Ornamenten bedruckt – ein Beitrag des Künstlers Beat Zoderer an die «Kunst am Bau». Durch die Gitterroste des Gehbelags sieht man das Wasser fliessen.
Spektakuläre Montage
Der Einsatz von Stahl ermöglichte die Vorfabrikation der Bauteile in der Werkstatt, was den beengten Platzverhältnissen und der schützenswerten Umgebung Rechnung trug. Durch die gewählten Querschnittsabmessungen konnte beim Steg auf einen Mittelpfeiler in der Limmat verzichtet werden. Der Steg wie auch der Liftturm wurden in je zwei Teilen mit Spezialtransporten auf die Baustelle gebracht. Die zwei Teile des Steges wurden auf dem Montageplatz auf Ennetbadener Seite verschweisst. Dann erfolgte die Montage des 52 Tonnen schweren Steges mit Hilfe eines 500-t-Raupenkranes. Dank dem Einsatz eines so grossen Kranes konnte auf ein Hilfsjoch in der Limmat verzichtet werden. Die beiden Teile des Liftturmes (je 24 Tonnen schwer) wurden ebenfalls von der Ennetbadener Seite aus versetzt und erst in ihrer endgültigen Lage miteinander verschweisst. Das Versetzen der 12 Tonnen schweren Passerelle erfolgte mit einem 120-t- Pneukran von der Oelrainstrasse aus.
Laudatio der Jury
Von der Jury gewürdigt wurde die Angemessenheit des Eingriffs in einem sensiblen Gefüge aus Urbanität und Naturlandschaft. Die Wahl des Tragsystems, die Materialisierung sowie die sorgfältige und detailgenaue Ausformulierung der architektonischen und strukturellen Idee trägt dieser Lage Rechnung. Die Vorfertigung im Werk und die spektakuläre Montage am Stück zeigen die Qualitäten des klassischen Stahlbaus auf, die jedoch zu einer eigenständigen, bewegenden Interpretation des Ortes und seiner Erschliessung geführt haben.Steeldoc, Mo., 2007.12.10
10. Dezember 2007 Evelyn C. Frisch