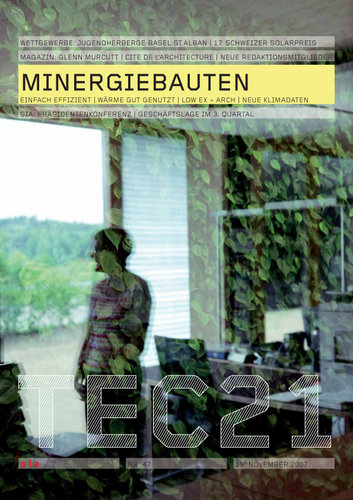Editorial
Dem Bauen kommt beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu, denn der Gebäudebestand in der Schweiz ist für rund 50% unseres gesamten Energieverbrauchs verantwortlich.[1] Die Konstruktion von sparsameren Häusern ist deshalb eine nahe liegende und Erfolg versprechende Strategie, um den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren. Der 1998 eingeführte Minergiestandard senkt den Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Gebäuden um rund zwei Drittel bei Mehrkosten von nur 3 bis maximal 10 %. Er hat sich mittlerweile gut etabliert. Bei den Neubauten beträgt der Anteil der Minergiegebäude etwa 15%. Zählt man die «minergieähnlichen» Gebäude hinzu, ist der Anteil noch einiges höher. Von verschiedenen Seiten wird auch bereits die Forderung laut, den Minergiestandard bzw. vergleichbare Anforderungen als Obligatorium einzuführen. Noch weit von einem derartigen Durchbruch entfernt ist der Minergie-P-Eco-Standard, der den Energieverbrauch gegenüber dem Minergiestandard nochmals um die Hälfte reduziert und zusätzlich eine ökologische und gesunde Bauweise garantiert. Bisher gibt es erst 5 Minergie-P-Eco-Gebäude in der Schweiz – zwei davon stellen wir in diesem Heft vor. Das neue Verwaltungsgebäude der Restaurantkette «Mövenpick Marché» in Kemptthal zeigt eindrücklich, dass energieeffizientes Bauen auch bei knappem Budget möglich ist. Und auch in der neuen Wohnüberbauung «Eulachhof» in Winterthur rechnen die Investoren trotz moderater Mieten mit üblichen Renditen. Beide Gebäude produzieren einen grossen Teil des benötigten Stroms mit Solarzellen auf dem Dach und nutzen zusätzlich Erdwärme bzw. Abwärme aus Abluft und Abwasser.
Dieses Konzept propagiert auch Andrea Deplazes, Professor für Architektur und Konstruktion an der ETH Zürich, im Interview mit TEC21. Denn gute Wärmedämmung und die Einführung des Minergiestandards gehen seiner Meinung nach zwar in die richtige Richtung, müssten aber ergänzt werden durch ein Umdenken bei den genutzten Energieträgern. Es mache wenig Sinn, hochwertige Energie (so genannte Exergie) wie beispielsweise Elektrizität oder Erdöl für die Wärmeerzeugung zu verbrauchen. Statt dessen müsse hauptsächlich die auf dem Grundstück vorhandene Erdwärme
bzw. Abwärme dafür genutzt werden. Dieses Konzept bezeichnet Deplazes als «Low Ex Arch» – niedrige Exergie in Kombination mit energieeffizienter Architektur.
Eine wichtige Grundlage für energie- und gebäudetechnische sowie bauphysikalische Berechnungen und Nachweise sind Klimadaten. Das neue Merkblatt 2028, das wir in unserem vierten Fachartikel vorstellen, fasst die bisher auf einzelne Normen verteilten Daten zusammen und vereinheitlicht sie. Ein Vergleich der aktuellen Messdaten aus den Jahren 1984 bis 2003 mit den alten Daten der Periode 1961 bis 1980 zeigt deutlich zunehmende Temperaturen – höchste Zeit also, mit allen verfügbaren Strategien dem Klimawandel entgegen zu wirken.
Claudia Carle
[1] Bundesamt für Energie: Konzept der Energieforschung des Bundes 2008–2011, 2007
Inhalt
Wettbewerbe
Jugendherberge Basel St.Alban | 17. Schweizer Solarpreis
Magazin
Luxuriöse Monografie zu Glenn Murcutt | Cité de l’architecture, Paris | Neue Redaktionsmitglieder TEC21 | Kurzmeldungen
Einfach effizient
Daniel Engler
Das neue Bürogebäude von Mövenpick Marché entstand innerhalb eines engen Kosten- und Zeitrahmens. Das Ergebnis ist sowohl aus ästhetischer als auch aus energetischer Sicht bemerkenswert.
Wärme gut genutzt
Lukas Denzler
Die Wohnüberbauung «Eulachhof» in Oberwinterthur setzt auf erneuerbare Energie sowie eine konsequente Wärmerückgewinnung aus Abluft und Abwasser.
Low ex arch
Judit Solt
Andrea Deplazes im Gespräch: Gedanken zu Sinn oder Unsinn von Energiestandards, aktuellen Sparbemühungen und innovativen Energiemodellen im Bauwesen
Neue Klimadaten
Gerhard Zweifel
Das neue SIA-Merkblatt 2028 liefert neue Klimadaten für bauphysikalische, energie- und gebäudetechnische Berechnungen.
SIA
Präsidentenkonferenz | Geschäftslage im 3. Quartal
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Einfach effizient
Vor zwei Jahren entschied die Restaurantkette Mövenpick Marché, dass ihre Verwaltung näher bei den zu Verwaltenden platziert werden sollte. So entstand an der Autobahn A1, direkt bei der Raststätte Kemptthal, ein bemerkenswertes Bürogebäude. Es wurde unter anderem mit dem diesjährigen Solarpreis ausgezeichnet.
Die Anlage des Gebäudes ist überaus einfach: Ein lang gestreckter, dreigeschossiger Baukörper, je ein Treppenhaus an beiden Enden. An der exakt nach Süden geöffneten, vollverglasten Längsseite befinden sich die Grossraumbüros mit davorliegenden Balkonen bzw. einer Terrasse im Erdgeschoss. Ein Bauherrenanspruch – direkter Ausgang ins Freie für jeden Arbeitsplatz – deckte sich hier mit der energetisch und raumklimatisch sinnvollen Abschattung der hoch stehenden Sommersonne. Der zwischen den beiden Treppenhauskernen liegende Raum auf der Nordseite nimmt Sitzungszimmer und Nebenräume sowie einige wenige Einzelbüros auf. Im Erdgeschoss werden in diesem Bereich Akten gelagert, da es keinen Keller gibt. Im angedockten und auch in der Fassadengestaltung speziell behandelten Eingangsbaukörper schliesslich befinden sich das Café, die Entsorgungsstation sowie drei Studios für übernachtende Besucher (Bilder 1 bis 4).
Einfaches Konzept – sorgfältige Gestaltung
Der grosse Termindruck – zwölf Monate von Planungsbeginn bis Einzug – erforderte gleich zu Beginn zwei Grundsatzentscheide: Massivbauweise kam nur punktuell in Frage, und auf einen Keller musste verzichtet werden. Davon und vom sehr engen Kostenrahmen haben sich die Architekten offensichtlich eher inspirieren denn einengen lassen. Ihre Strategie war, die Konzepte auf allen Ebenen (Statik, Konstruktion, Installation, Ausbau) absolut einfach zu halten. Als Gegengewicht dazu wurde auf eine sorgfältige Gestaltung Wert gelegt. Zudem wählte man einige wenige Elemente aus, die, wenn man so will, luxuriös, also mehr als das unbedingt Notwendige sein durften. Die Pflanzenwände für ein angenehmes Raumklima sind ein solches Beispiel, die Solarglas-Fassadenelemente, die rund das Doppelte eines normalen Fensterelementes kosten, ein anderes. Ansonsten wurde aus wenig sehr viel gemacht. Die Ausschreibung der Betontreppenhäuser zum Beispiel erfolgte ohne jede Anforderung an die Schalung. Da habe er, als er das Ergebnis zum ersten Mal erblickte, schon einmal leer schlucken müssen, gesteht der Architekt. Heute aber, im Licht der sehr einfachen, aber raffinierten Beleuchtung und unter einer dunkelroten Lasur, erscheint die grobe und unregelmässige Betonoberfläche überhaupt nicht billig (siehe inneres Titelbild).
Verteilung auf dem Dachboden
Weitere Kostendrücker: Wasser gibt es nur gerade im vorderen Treppenhaus sowie in den daran unmittelbar anschliessenden Räumen des Eingangsbaukörpers. Die Zentrale für Heizung, Warmwasser und Lüftung sowie die Solarstromsteuerung befinden sich im Dachraum über dem Treppenhaus, zugänglich lediglich über eine Standard-Auszugestrichtreppe. Auch das Konzept der Verteilung von Luft, Wärme und Medien ist von verblüffender Einfachheit. Die horizontale Verteilung erfolgt auf dem Boden des unbeheizten Dachraums. Und der Clou: Der gesamte Dachboden mitsamt den darauf verlegten Lüftungskanälen und Heizungsleitungen (Strom und Netzwerk liegen in aufgeständerten Trassen) wurde am Schluss knapp 30cm hoch mit Zelluloseflocken zugeschüttet. Müssen diese Installationen einmal gewartet werden, legt man sie frei und deckt sie anschliessend wieder zu. Die Weiterverteilung nach unten geschieht dann in Wandaussparungen (in der Nordwand) und in den voluminösen Stützen (Bild 5). Die Geschossböden selbst sind von der Medienverteilung (ausgenommen Bodenheizung) befreit, was neben einer Kostenersparnis auch die Flexibilität für die Nutzer erhöht.
Das Raster der Tragkonstruktion orientiert sich am Platzbedarf zweier Arbeitsplätze. Zusammen mit der Längserschliessung ergeben sich auf der Südseite 6.5 m × 4.0 m, auf der Nordseite 5.0 m × 4.0 m. Die eher geschlossenen Nord-, Ost- und Westfassaden sind tragend und steifen den Bau aus. Die beiden Treppenhäuser sind zwar in Beton erstellt, was aber auf den Anforderungen der Brandsicherheit und nicht auf statischer Notwendigkeit beruht. Im Gegenteil, aus akustischen Gründen sind sie von der Holzkonstruktion vollständig entkoppelt. Als Geschossdecken dienen Hohlkastenelemente, die wiederum zum Schallschutz mit Split beschwert sind.
Pflanzenwand und massgefertigte Möbel
Gleich beim Eintritt vom Treppenhaus in die Büroräume steht man neben einer grünen Pflanzenwand (Bild 6). Die 12 m² in jedem Geschoss verdunsten pro Tag etwa 30l Wasser – insbesondere im Winter ein willkommener Beitrag zu einem angenehmen Raumklima. Die Irritation, in einem Bürohaus ganz von Holzoberflächen umgegeben zu sein, hält nicht lange an. Zu wohl fühlt man sich in den unkompliziert wirkenden Räumen. Für die Auswahl der Materialien waren neben den Kosten ebenso ökologische und baubiologische Kriterien ausschlaggebend. Wände und Decken zeigen direkt die innerste Lage der Konstruktion (Dreischichtplatten). Der Boden hingegen ist in grossflächigen, dunkel geölten Duripanelplatten ausgeführt. Dieser Entscheid ist wie so viele andere auf die Budgetrestriktionen zurückzuführen. Er hat gewiss auch ein wenig experimentellen Charakter und wird sich im Alltag noch bewähren müssen. Für den Autor absolut erstaunlich: Obwohl die Bauherrschaft nicht bereit war, für die Einrichtung mehr auszugeben als für günstige Büromöbel ab Stange, schafften die Architekten das Kunststück, innerhalb dieses Budgets modulare, flexible und schöne Möbel in Buchensperrholz bei einem lokalen Schreiner anfertigen zu lassen. Sogar ein nützliches Extra lag noch drin: Die Rückwände der Schränke und Bücherwände wurden als Schallabsorber ausgebildet. Einige wenige Trennwände erhielten dieselbe Behandlung, und schliesslich tragen auch die jeweils oberhalb der individuellen Stehlampen angebrachten Reflexionsschirme zu einer angenehmen Akustik bei. Im Pausenraum gaben die Architekten dann noch einen drauf: Boden, Wände, Küchenkombination und Möbel sind alle aus Holz gefertigt und so stellt sich hier eine Art Schmuckkästchen-Effekt ein (Bild 7).
Energiekonzept
Das Gebäude ist Minergie-P-Eco-zertifiziert, es geht aber noch einen Schritt weiter. Die Urheber bezeichnen es als «bilanziertes Nullenergiehaus». Damit ist gemeint, dass die auf dem Dach installierten Solarzellen übers Jahr gesehen gleich viel Strom produzieren wie Heizung, Warmwasser und Lüftung sowie alle anderen Verbraucher (Beleuchtung, EDV, etc.) im selben Zeitraum benötigen. Der Strom wird ins allgemeine Netz eingespeist und der Verbraucherstrom wiederum von dort bezogen. Die Pufferfunktion des Elektrizitätswerks macht damit noch den Unterschied zu einem energetisch vollständig autarken Gebäude aus. Die amorphen Solarzellen (sog. Dünnfilmzellen) sind zwischen zwei Glasscheiben eingebettet und bilden eine grossflächig geschuppte Dachhaut, die elegant detailliert ist und die Schutzfunktion einer konventionellen Dacheindeckung übernimmt. Finanziert und betrieben wird die Anlage vom Elektrizitätswerk des Kantons Zürich (EKZ). Marché verpflichtete sich im Gegenzug, einen Viertel der produzierten Strommenge zum Solarstromtarif selber zu beziehen, der Rest wird über die Solarstrombörse weiterverkauft. Damit konnte die Bauherrschaft trotz der ökologischen Energieproduktion ihre Investitionsrechnung entlasten, sie musste sich lediglich im Umfang der Kosten einer konventionellen Dacheindeckung beteiligen.
Weiter gibt es die für ein Minergie-P-Haus selbstverständlichen Einrichtungen wie kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Erdsondenwärmepumpe. Die U-Werte der opaken Hülle betragen zwischen 0.084 und 0.104W / m2*K. Die Fenster sind dreifachverglast, besitzen allerdings statt (teurer) hochgedämmter Passivhausprofile lediglich normale Holzrahmen. Ein relativ kleiner Rahmenanteil und die ansonsten optimalen Dämmwerte ermöglichten diese Einsparung. Rund die Hälfte der Südfassade ist mit GlassX-Elementen bestückt (siehe nachfolgender Artikel). Um trotz der Holzbauweise genügend Speichermasse anbieten zu können, wurde ein 80mm dicker Zement-Unterlagsboden eingezogen, der auch die Heizleitungen enthält. Darin lag ein weiteres Argument für den Bodenbelag in Duripanel: Die Wärmeübertragung zur darunterliegenden Speichermasse funktioniert besser als z. B. mit einem Parkett. Im Sommer können die Leitungen der Bodenheizung über die Erdsonde mit kühlem Wasser (minimal 18°C) gespeist werden.TEC21, Mo., 2007.11.19
19. November 2007 Daniel Engler