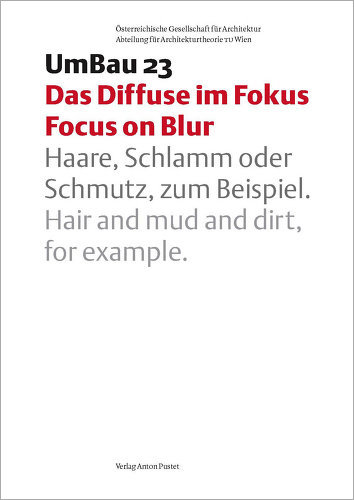Editorial
Als wir den Call for Papers für die vorliegende Ausgabe des UmBau formulierten, gab es unterschiedliche Auffassungen über die Frage, worauf das Phänomen „Unschärfe“ in der Architektur zurückzuführen sei. Die heftigsten Diskussionen entstanden um die These, es handle sich um eine Flucht in den Ästhetizismus, also um die eskapistische Abwendung von einer Welt, in der gerade heute immer mehr klare Fronten sichtbar und wirksam würden. Welchen anderen Sinn hätte die Anrufung des Diffusen sonst in einem geistigen Umfeld, das mit der Einteilung der Welt in die Achsen „Gut“ und „Böse“ zu entschlossenem Handeln gefunden hat? Wo politische Allianzen nach dem Motto „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ geschmiedet werden, ist wohl kein Platz für das Diffuse.
Inzwischen hat sich die politische Großwetterlage etwas geändert. Von einer neuen Ordnung der Welt ist trotz gegenteiliger Rhetorik nichts zu spüren. Und fast scheint es, als hätte die Politik einen kurzen eskapistischen Ausflug in eine Welt der klaren Fronten unternommen, während die Architektur der Unschärfe den Komplexitäten und inneren Widersprüchen der Welt eher gerecht wird, wenn auch primär mit ästhetischen Mitteln.
Es ist also durchaus passend, wenn wir ein Interview mit Robert Venturi und Denise Scott Brown an den Anfang der vorliegenden Ausgabe stellen. Lässt man Mehrdeutigkeit als eine Form des Diffusen gelten, hat sich die Architektur schon seit bald 50 Jahren mit diesem Phänomen beschäftigt. Dass Unschärfe in der Architektur keine primär formale Frage ist, zeigt der Europan-Beitrag von Wolfgang Kölbl für Waidhofen an der Ybbs, ein „Entwurfs-Prolog“, der bewusst ein diffuses, teilweise ironisch vermintes Planungsfeld aufspannt, anstatt eine klare Lösung anzubieten. Der Fotoessay von Gisela Erlacher führt scheinbar in die Antithese des Diffusen, in die engen Räume von Bunkern und Haftanstalten. Aber auch hier lauert in der Abfolge der Bilder, wenn der Unterschied zwischen Schutzraum und Gefängnis zu verschwimmen beginnt, ein Moment der Unschärfe.
Der wissenschaftliche Teil bringt diesmal 9 Beiträge, die von Kari Jormakka ab Seite 52 eingeleitet werden. Wir hoffen, dass die vorliegende Ausgabe in aller gebotenen Klarheit dem Thema gerecht wird. Christian Kühn
Inhalt
10 Vorwort | Christian Kühn
12 In Memoriam Ernst Hiesmayr | Christian Kühn
14 Signs and Systems | Robert Venturi and Denise Scott Brown talking with Dörte Kuhlmann
19 Übereifrige Aufklärung | Christian Kühn
22 Ende der Illusionsarchitektur | Wolfgang Koelbl
46 Keine Angst vorm Ornament | Anita Aigner
52 Unbrauchbar: Ein Lexikon als „Ansatzpunkt für weitere Recherchen“ | Tatiana Winkelmann
56 10 Jahre nextroom | Christian Kühn
58 Nachrufe | Christian Kühn
FotoEssay
64 UnterGrund | Gisela Erlacher
98 Schutzraum und Zelle. Der Augenblick der Freiheit | Gabriele Ruff
Focus on Blur
100 Foreword: Blur Blur Blur | Kari Jormakka
104 The Spheres of Peter Sloterdijk | Andreas Leo Findeisen
111 Erosion der Erinnerung | Arne Winkelmann
129 Architektur ohne Architekten | Christian Junge
140 Cultural Blur and the Return of Minor Languages | Philip Loskant
148 The Blurred Inframince of Exteriority | Thomas Mical
160 R&Sie reading Bataille’s „Formless“ | Ingrid Böck
173 Das Entgleiten der Form | Manfred Russo
189 Als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären | Wulf Walter Böttger
202 The Production of Diffuse Spaces | Markus Jatsch
Blur Blur Blur
While the Summa Theologica counts clarity as one of three conditions of beauty, the Protrepticus tells us that beauty depends on blurred vision: „For if one were able to see as keenly as they say Lynceus did, who saw through walls and trees, how could one ever stand to look at people if one saw of what sort of bad things they are composed?“[1] Perhaps Aristotle was the first theorist of the „blur“, a concept that entered architecture theory about a decade ago.
Before that time, the American avantgarde of deconstructivism was obsessed with the hyperarticulation of form and the European neominimalists with simple Platonic solids. Today, former deconstructivist Peter Eisenman blurs the conditions of the object and landscape into one heterogeneous space in his cultural center in Santiago de Compostela while Diller Scofidio, other exponents of „critical practice“ who in the past explored vision with Cartesian clarity, opted for invisibility in their Blur building in Switzerland. Post-neomodernist Jean Nouvel explores the de-definition of form in the Tokyo Guggenheim, which resembles a hill made of leaves, while one-time „minimalists“ Herzog & De Meuron built a translucent amoeba-shaped library in Cottbus, Germany.
Appropriately enough, the architecture of the blurred informe does not derive from a unified, well-articulated theory. A variety of philosophical influences and parallels could be identified, however. Like the „Weather projects“ by Olafur Eliasson, Peter Sloterdijk’s theory of „foam“ investigates atmospheric conditions, proposing a sort of expanded meteorology. Skins, spheres, networks, ambiance and air-conditioning replace the old focus on things, gravity, solidity and matter. The Blur building or the Biospheres would appear as perfect illustrations of Sloterdijk’s thesis, but does the concept of foam have broader implications for architecture? This is the question posed by Andreas Leo Findeisen in his paper below; he cautions against a too direct application of the foam theory as a formal recipe for making architecture.
In American architecture, the notion of the blur emerged from a reading of Jacques Derrida and Gilles Deleuze.[2] Derrida’s critique of the Kantian concept of parergon in the Truth in Painting destabilized the status of limit and form by showing that the idea of an organic unity is contradictory. With his concepts of the rhizome and the fold, Deleuze provided an alternative to linear, hierarchical thinking and the possibility of dealing with complex and supple systems. Arne Winkelmann examines a project coming out of this discourse, Eisenman’s Jewish Memorial in Berlin, in detail. With reference to Deleuze’s notion of a-signifying diagram, Eisenman avoided symbolism and concentrated on the scaling and displacement of various topographical grids. The result is an amorphous field of stelae which, despite its rational appearance, exemplifies the potential in every closed system for instability and chaos. Winkelmann interprets the monument iconographically and finds it an apt symbol for the erosion of memory.
Eisenman’s formless field condition is a logical development from his earlier work which sought to displace authorship through algorithmic design processes that combined aleatorism with extreme determinism. In his contribution, Christian Junge looks at the desire not to design, arguing with reference to Georges Bataille and Rudolf Arnheim that it is incoherent to an architect or artist to attempt to produce something without form and concluding that the deterministic algorithms function best as investigative tools for a homo ludens.
Focusing on a different aspect of the same discourse, Philip Loskant observes that the fragmentation and collage, typical of deconstructivist architecture, echo the social and political tensions of the 1980s, while the more relaxed, „non-dialectical“ society of the 1990s is reflected in blurred designs. What is post-9/11 architecture, then, going to be? Instead of accepting the political, social, religious and ethnic polarization that seems to be getting more and more extreme, Loskant argues for a more extended blurring, one that is not limited to form but blurs diverse „minor languages“ into a culturally relevant hybrid.
Deleuze and Guattari’s notion of minor languages was drawn from a diary entry by Franz Kafka, and this is not the only issue in the blur discourse that harks back to the classical avantgarde. The papers by Ingrid Böck and Thomas Mical relate the notion of diffuse form to Marcel Duchamp, the surrealists and the Bataillean informe.[3] Mical claims that of all that is concealed within representations of architecture, the condition of exteriority is the most difficult even though (or perhaps because) architecture is ultimately about the separation of a stable inside from an originary formless outside. He compares this always already blurred separation to the elusive border between being-in-itself and being-for-itself in Sartrean existentialism as well as the concept of the inframince in Duchamp’s theory. In this context, he analyzes works by Mark Rothko, Francis Bacon, Gerhard Richter and Thomas Ruff, as well as architectural concepts of Diller Scofidio and Toyo Ito.
Böck, by contrast, concentrates on the work of one office, R&Sie, which she reads through Bataille’s concept of the informe and Deleuze and Guattari’s concept of BwO, or body without organs. In their design for a Contemporary Art Museum in Bangkok, for example, R&Sie start with the local pollution problem, proposing a structure with an electrostatically charged facade that collects dust from the air. The pollution collected will change the appearance of the building constantly, filter the light in the interior and even modify local climate. For Böck, such projects are examples of how formless, highly sensual material operates across and through a surface, disabling the imposition of form.
In an even broader historical perspective, the contemporary concern with the blur, with diffusity and formlessness can be set in a context reaching even further back than Bataille. In his paper, Manfred Russo traces an evolutionary line from Hegel via Wölfflin and Riegl to Boccioni, and then to Giedion and Benjamin, and finally to Sloterdijk’s foam and Lyotard’s postmodern sublime. Of course, even the original conceptions of the sublime, as defined by Edmund Burke, Immanuel Kant and others in the eighteenth century, already operate beyond the formal, providing a basis for Romanticism. Wulf Walter Böttger sketches out some main themes in the aesthetic theories of the Romantics, including Schelling, Caspar David Friedrich and Novalis, in order to analyse contemporary projects by Olafur Eliasson and Jun Aoki. In the Snow Foundation building (1999) in Yasuduka, Niigata, for example, Aoki turns the building itself into a large container, a third of which is filled in the wintertime with snow that then cools the air in the summer. Here, architecture functions less as a formal composition than as climatic mechanism that also produces unique visual experiences.
In the paper that closes this issue of UmBau, Markus Jatsch looks into the psychological conditions of perception to better understand the impact of the work by artists James Turrell, Dan Graham, Heinz Mack and others. Basing his theoretical arguments on Roman Ingarden, Nelson Goodman and Franz Xaver Baier, Jatsch predicts that in the future architecture will no longer be judged by its aesthetic appearance but by the measure to which it opens up new reality. He expects architecture to become more of an „anarchitecture“ which instead of constructing isolated, self-sufficient objects will concentrate on the production of semi-finished structures that are more about the constitution of their environment and viewers than about their own definition.
The editors thank Andreas Leo Findeisen (Academy of Fine Arts, Vienna), Jeffrey Kipnis (The Knowlton School of Architecture, Ohio State University), Martin Prinzhorn (University of Vienna) and Andreas Ruby (textbild, Cologne) for their cooperation on the review board for this issue.UmBau, Do., 2008.01.24
[1] S. Thomas Aquinas, Summa Theologica I, 39,8c, 91, 3, 2; Aristotle, Protrepticus.
[2] Sloterdijk, Peter, Sphären III: Schäume. Frankfurt: Suhrkamp, 2004; Deleuze, Gilles, The Fold. Leibniz and the Baroque. Tr. Tom Comley. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993; Derrida, Jacques, Truth in Painting, tr. Geoff Bennington and Ian McLeod, Chicago: University of Chicago Press, 1987.
[3] For a discussion, see Bois, Yve-Alain, and Krauss, Rosalind E., Formless, A User's Guide, New York: Zone Books, 1997.
24. Januar 2008 Kari Jormakka
Signs and Systems
(SUBTITLE) Robert Venturi and Denise Scott Brown talking with Dörte Kuhlmann
Dörte Kuhlmann: Asked to give students of architecture the best advice they could think of, the four architects of alles wird gut, a successful young Viennese office, had this to say: „Go to Vegas.“ Since the eighteenth century, people have said that you are not an architect if you haven’t been to Rome, but now Las Vegas is apparently where you have to go.
Denise Scott Brown: That’s probably our fault.
Robert Venturi: We were using Las Vegas as an extreme example of the automobile city, which planners and architects despised and considered irrelevant.
DK: Back in 1972, in Learning from Las Vegas, you said: „Perhaps the most tyrannical element today in our architecture is space!“ Do you still feel the same way in 2005?
RV: Over the years I became irritated by the over-emphasis on space as the essential element of architecture. I think it has been used by architects and theorists to promote abstraction as the ideal aesthetic of the Modernist 20th century. It is ironic that, on the one hand, the early Modernists loved abstraction yet, on the other, they promoted symbolism, via the industrial architectural vocabulary they employed. But the main point is that they emphasized space as a way of keeping architecture abstract and of keeping out the traditional element of symbolism and iconography, which horrified them because they were connected with the idea of style. So space became the enemy of iconography and symbolism.
DSB: Today, the Neomodernists are again very interested in space (and in structure, though not in function). But their spaces are what I call „swoop“. They swoop this way and that, often for reasons that are hard to decipher. Neomodernists are also very against an idea that interests us considerably: the notion of the processional—the street through the building, the way through the building—thought of as a positive and usable element in itself. You could interpret much of Peter Eisenman’s work, for example, as deliberately obfuscating the processional, starting with the front door, which he obliterates by including a great many entrances into the building.
DK: While your Complexity and Contradiction and Learning from Las Vegas sponsored much of the theoretical discussion on meaning, symbolism or iconography in architecture in the seventies and eighties, in the last decade, the younger generation started talking about a-signifying signs and refusing everything that has to do with representational meaning of any kind as a part of their rejection of postmodernism as well as deconstruction.
DSB: If they think they can escape symbolism, they are falling into the same trap that the Modernists did, the trap we described in Learning from Las Vegas. When they say „Remove the reference!“ they’re like the politicians who say, „Let’s take it out of politics!“ What they really mean is, „let’s take it into another politics, the politics I control.“ The Neomodernists take architecture away from the general symbolism, only to situate it within their own symbolism—the symbolism of „no symbolism“. They need to look at what happened to the early Modernists. In the end they themselves tired of plain white walls; they produced the flowery Late Modernist style that we criticized in the 1960s. If today’s Neomodernists think they are free of symbolism, they will be more tyrannized by it than if they had consciously realized that they are using it.
RV: In Learning from Las Vegas and in the first part of our new book Architecture as Signs and Systems for a Mannerist Time we argue that architecture should no longer deal in abstract expressionism. It should reassess what has been vivid and valid within the many traditions of the past: Egyptian temples with hieroglyphics, Gothic stained glass windows, Byzantine mosaics, frescos in Italian palazzi, and on and on. As well as searching for symbolism in Las Vegas, we should go back to the tradition of iconography that has been essential to all architecture of the past.
DSB: In my chapters of the book, I discuss how architecture may be evolved from an understanding of different kinds of urban and social systems—some, for example, economic systems, are not physical.
The work of the most recent Pritzker recipient, Thom Mayne, concerns „urban mapping“, which seems to be in vogue now. Thom uses it as a base for Neomodern shape-making. I’ve worked with urban mapping since 1960. I use it to learn about patterns of relationships within and around our projects and as a conceptual model to help us achieve reality-based design. We have evolved ways of designing using mapping techniques and mapped information that derive from the social sciences, particularly economics. I think our methods give us an opportunity to take account of aspects of architecture that are difficult to consider in design.
DK: I can see how architectural signs can be manipulated in a mannerist way, but can such systems also be mannerist?
DSB: Mannerism applies to both signs and systems. At the end of Bob’s section there is a chapter on mannerism and at the end of mine there is another. In 1960, when we met, we were both independently interested in mannerism. Since then, we’ve built on this interest together, and in so doing we have come to define it a little differently from how it’s normally defined. The German historians who „discovered“ Mannerism (with a big M), the historical movement in art and architecture, related it to decadence and neurosis. In the 1950s, the New Brutalists, coached by English and European architectural historians, became extremely interested in Mannerism. They had been reassessing early Modernism and, in the process, rediscovered the Neue Sachlichkeit of the 1920s, which they named „the new objectivity“. From it, they derived a precept: „Look very straight at a problem and face its real issues, whether you like them or not, for these will give you a direct solution to your problem. Don’t worry if the design you find isn’t beautiful; it may be beautiful one day.“ Le Corbusier too: his „eyes that will not see“, meant, „We have discovered real, strong solutions to modern problems. If they look ugly to you, it’s because your eyes are unaccustomed to them.“
But, having followed the Neue Sachlichkeit toward ugly architecture, the Brutalists found it easy to go, from the shock value of breaking the rules for good reason, to enjoying architecture that broke the rules for no real reason—to Mannerism. I think this was probably why the Brutalists started liking the Mannerists.
RV: In 1966, in Complexity and Contradiction, I explicitly described Mannerism as being very significant. The concepts of complexity and contradiction were very much a parallel to Mannerism. In this regard, my favorites in Italy are Palladio and Michelangelo, even Borromini. Michelangelo is not really known as a Mannerist architect, but take a look at the rear facade of St. Peter’s. You’ll see a giant-order column with a small window set right beside its capital. The window is the same size as the capital. I love that contradiction of scales. And if you consider mannerism with a small „m“, not the Renaissance style, you can find it in many places. For example, you could think of Luigi Moretti or Armando Brasini as mannerists. And that’s also why I so very much love English historical architecture, especially Elizabethan and Jacobean. But I think there is a flow of mannerism, with a small „m“, through the whole of English architectural history. John Soane, for example, is full of mannerism.
DSB: The original Mannerists were Renaissance architects who knew the rules superbly well—so well that they could break them, cunningly, cleverly, and amusingly. But they didn’t break them all over or all the time. That would produce dullness! We feel that there must be good reason—not just fun—to break the rules today. We have built this idea into our discussions and definitions of mannerism for now.
DK: Many young architects today look at architecture neither as an issue of communication nor as one of style or even formal coherence; instead, they go to Vegas to „architainment“, theming and scripted spaces, branding, profit-making and other basically economic issues. Can they also learn from mannerism?
DSB: In today’s cities, many systems come together, and you can’t simply follow all the rules of all them, because they are frequently in conflict. You have to have a philosophy and strategy of bending the rules to make all work together. That is a modern reason for mannerism.
Rem Koolhaas, for one, likes this Promethean environment. He likes to swing where the great systems clash, up there with the gods on Mount Olympus. The notion of an architect’s trying to survive the clashes of larger-than-life urban systems was very pertinent while I was writing the chapter on mannerism, because the World Trade Center crisis was upon us. I wished the Libeskinds good luck!
RV: There’s also an interest now in multiculturalism. And mannerism accommodates multiculturalism and the complexities and contradiction that it involves. Pop culture and indigenous culture are both acknowledged now and both should come together. In vital cities, such as Shanghai and Tokyo, the cultural mix comes together very beautifully.
DSB: Returning to the issue of architecture and economics: my half of Architecture as Signs and Systems covers many kinds of systems, including economic ones. It talks about the patterns that systems make on the land. Look at the patterns of Paul Klee’s line drawings and watercolors; then look at the diagrams and maps of the regional economists, Johann Heinrich von Thünen, Walter Christaller or August Lösch. They all have a similar evocative beauty. They should serve as muse to urban designers.
In our projects we apply economic disciplines, not only at an urban level but also at the level of the building. We say that we do land-use and transportation planning inside buildings. And we do so in relation to the processional through the building. In a town, where two main streets meet, there is a market place. So where is the market place inside the building? In our Hôtel du Département in Toulouse, at the meeting points between major corridors, there are „coins cafés“. In our laboratory buildings we place a lounge on every floor, where the vertical and horizontal circulation meet. People from different labs or different disciplines may meet and start to exchange ideas. Then where will the next research breakthrough occur? At the lab bench or in the coffee lounge? In this way, the urban planners’ question, „How can urban systems and relationships be arranged to support urban community?“ can be answered within buildings as well as in cities.UmBau, Do., 2008.01.24
24. Januar 2008 Dörte Kuhlmann
R&Sie reading Bataille’s „Formless“
(SUBTITLE) Architecture as Operational Force
Inspired by a rather surrealist imagination to represent the uncanny, hidden aspects of the real, Francois Roche, of R&Sie Architects, proposes that “architecture can only be negotiated live, in its contingency on a situation … This ambiguity gives rise to our unstable and unique scenarios.”[1] An example is provided by their project for an extension of the School of Architecture in Venice, titled Aspiration Aqua Alta (1998):
Scenario 1
1 Destruction of the existing cement warehouses (preserving a virtual ghost-print of the old building).
2 Digitized representation of water being sucked up into this imprint.
3 Making internal and external PVC membranes.
4 Lagoon water vegetation infuses membranes through capillary action (into transparent plastic walls for an aqua alta exacerbation).[2]
As the Lagoon water slowly creeps up the Aqua Alta building, into the cavity between two transparent plastic foils, the liquid is sucked up with its saltwater odor, a sea-green plastic matrix colonized by residue and foam. This project expresses processes of capillary action and sedimentation—when the raw material of the city, stagnant water and algae, increasingly becomes the true material of the building envelope. Architecture exaggerates the future threat of the final Aqua Alta outside of the regular and temporary occurrence, the rise of the water level above of the city: “Venice thus anticipates a general liquefaction of the earth … the melting of the polar ice caps, the rise of the level of the oceans, the flooding of entire island groups … it is impossible to reverse this disappearing process, even if we put an instant stop [to it].”[3] It is the simulation of the bygone culture of Venice finally dissolving in the Lagoon.
Another scenario relates to a project called Dusty Relief/B-mu (2002), the design of a Contemporary Art Museum in Bangkok:
Scenario 2
1 Random relief calculated by pixelization of aleatory particles for a pure gray ectoplasm under the lightning-gray sky of Bangkok.
2 Collecting the city’s dust (Duchamp’s Dust Breeding) on the surface of aluminum latticework using an electrostatic system.
3 Exacerbating schizophrenic climate between the interior (white cube and labyrinth in Euclidean geometry) and the exterior (dust relief on topologic geometry), and using this sun-protection monolithic interface for an in/outdoor exhibition.[4]
Now that the pollution cloud envelopes the luminous city of Bangkok, the ever-changing shape of the Dusty Relief/B-mu is generated by the dust in the city’s air, which is attracted by an electrostatically charged metal façade. The intoxicating environment not only filters the light with gray spectral frequencies, but even goes so far as to modify the local climate. R&Sie propose two different structures: an „aseptic and deterritorialized universe plunged in an intoxicating urban chaos“.[5] It exaggerates the threatening environment through concentration on the exterior, leaving the pure and sober interior of the museum deprived of any contextual issue. This creates an interior which is „a deterritorialized volume imprisoned between white windowless walls“, while the exterior gives „the white cube what it so clearly negates: its relationship to its concrete reality, its context, its territory“.[6]
For unfolding their dramatic scenarios, the envelopes of both Aqua Alta and Dusty Relief/B-mu deploy substances—the water of the Lagoon and the dust in the air of Bangkok—which refer to the future threat or the intoxicating situation of the particular place.
A form of waste
In their obsession with filthy and even dangerous materials which are usually considered to be waste matter, provoking disapproval, even disgust, R&Sie may be following Georges Bataille. For Bataille, that which appears as unseemliness, as unassimilable waste, is the realm of the formless.
Though it has been over half a century since Bataille developed his notion of l’informe, the idea has only recently been deployed in the field of architecture. One of the reasons for this relatively late popularity is that the formless can be understood as a third term standing outside binary thinking, outside the battle between form and content, and the ground for thematizing this third or in-between condition was prepared by deconstructivism in the 1980s. But the formless promises a much more radical assault on the tradition of Western art and architecture than merely the notion of a third condition.
For architects such as R&Sie, the formless is neither surface nor depth; rather, it is the cunning of what has been suppressed in our common notion of reality. In Spoiled Climate R&Sie present their recent work, projects which escape the fossilizing effect of architecture and explore its operational conditions. It is a case of architecture becoming a tool for manipulating our reality and initiating processes of transformation, transgression, or disappearance.
Instead of refusing waste because it is impure, Bataille speaks of a moral devastation resulting from our ideal notion of matter.[7] For matter is not formulable in terms of idea; it is inequality, even to itself. That which is ineradicably idealist cannot be put into an equation with matter. In this way, the materialism is inconceivable as a system of equal exchange, because this neglects the sacrificial nature of expenditure: „There is lost time and there are waste lands, unproductive expenditures, things one never gets over, sins that cannot be redeemed, garbage that cannot be recycled.“[8]
Bataille describes the death of the Minotaur as an act which brings society out of the archaic, labyrinthine age by means of a final bloody sacrifice; the killing of the hybrid creature and the liberation of the inhabitants of Crete from its monstrous animality give birth to Athens. For Bataille, the real victims of this original murder are the individuals of the society cleansed of unseemliness, uncleanliness, and waste. By eliminating any trace of animality, homological theory glazes the world over with the clean and ideal, repressing any difference that cannot be formulated in comprehensible terms. Once the waste matter has disappeared, there is no trace of anything absent, a consumption with no remains, a total sacrifice, an initially bloody process that in the end does not leave any stain. Where the beast once lived, no emptiness remains, as if there were no loss. Nothing is lacking on the bloodless surface as if nothing had been eliminated.
Reading Marcel Mauss’s The Gift enabled Bataille to develop his notion of expenditure (dépense). Mauss explored the ritual of the potlatch among the North American Indians. It is not only a tribal feast at which presents are given and received, but also an excessive „throwing away of possessions to enhance one’s prestige or establish one’s position“.[9] In this sense, the potlatch is a way of acquiring power by recklessly squandering and, in some cases, actually destroying vital resources.
For Mauss, gift-giving involves circularity in the return of that which the other owes me, whether this exchange is immediate or deferred. In this way, the gift deals with raising the stakes, economy, counter-gift and the annulment of the gift—in short, everything which brings about once again the circle of necessities and interests. While for Mauss the gift is a profane transaction that can be understood in terms of its social function, for Bataille, the gift as revealed in the potlatch seems to belong to the realm of the sacred. Its idea cannot be reduced to the Western conception of social utility, but it is a transgressive experience of non-functional, senseless destruction. After accumulation there is always a need for expenditure liberated of utilitarian purpose. Bataille claims that the ritual of potlatch saves the material things from mere utility and thereby, restores the sacredness of the world.[10]
In light of Bataille’s dépense theory, the bloody madness of pre-Columbian Mexico represents a society openly acknowledging the sacrifice demanded of its members. In Extinct America he describes the pyramids the Aztecs left behind after Cortez’s arrival: they had been the site of the spectacle, where the priests had performed the ritual killing of the victims before the eyes of all citizens. For Bataille, the Aztec ritual of human sacrifice restores the victims to the sacred world, wrenching them from the grasp of the profane and the utilitarian. After the servile use has degraded them, the sacrifice releases them into the realm of the divine.[11]
In The Accursed Share Bataille attempts to subvert conventional models of political economy grounded in utility, and replace them by his theory of „general economy“, involving unproductive modes of expenditure and excess, the consumption of the superfluous, and the sacrifice as the accursed share.
Either the accursed share is spent knowingly without gain in the arts, eroticism, sumptuary monuments, and spectacles, or, if repressed, it obliviously leads to a catastrophic outpouring in war. Bataille argues that „human activity is not entirely reducible to processes of production and conservation, and consumption must be divided into two distinct parts“.[12] While the first part is represented by the necessary activity for the conservation of life, the second part is defined by unproductive expenditure and „activities which, at least in primitive circumstances, have no end beyond themselves.“
Smooth operation
In his Documents’ „critical dictionary“ Bataille suggests that the power of formless is the slippage and the effect of shocked surprise that it produces, and its value as an operation.[13] According to his definition, “„formless“ is not only an adjective having a given meaning, but a term that serves to bring things down in the world, generally requiring that each thing have its form. What it designates has no rights in any sense and gets itself squashed everywhere, like a spider or an earthworm. In fact, for academic men to be happy, the universe would have to take shape. All of philosophy has no other goal: it is a matter of giving a frock coat to what is, a mathematical frock coat. On the other hand, affirming that the universe resembles nothing and is only formless amounts to saying that the universe is something like a spider or spit.”[14]
Even the last proposition has to be modified, though, since neither the spider nor spit really are as alien as Bataille would have the formless be. In order to characterize that which by definition must remain outside of linguistic categories, he continues to describe how the formless escapes geometry, morphology, or the idea; it does not resemble anything; it cannot be gathered into the unity of any concept. This escape is unbearable to reason, because it makes no sense and hence, has no rights. Bataille assesses the contrast between the rational, utilitarian nature of form and shape, which are equated with content, and the operational, performative force of the formless. The formless is a device for any kind of alteration, a practice of dismembering conventional structures. Hence, the operational force of the formless proposes „to break up the subject and re-establish it on a different basis is not to neglect the subject; so it is in a sacrifice, which takes liberties with the victim and even kills it, but cannot be said to neglect it.“[15]
Bataille’s dictionary as a whole can be seen as gambling with the contrast between the very use of the conventional form of the dictionary, the implicit idea of totality, and the operational moment of surprise and disgust of the single categories. Seemingly a set of fragments of alphabetical arbitrariness, the entries include items such as camel, man, dust, reptiles, and shellfish.
As Carl Einstein in a Nietzschean mood claims in his contribution to the Documents dictionary, „Words are, for the most part, petrifications that elicit mechanical reactions in us.“[16] In the article on the rossignol (nightingale), Einstein describes the forces of repression, arguing that „Nightingales can be replaced: (a) by rose, (b) by breasts, but never by legs, because the nightingale’s role is precisely to avoid designating this aspect.“ For Einstein, the operation of the formless is like revealing the legs under the skirt.
The issue of the formless is already inscribed in Plato’s dialogue Parmenides. Socrates asserts that there are forms (or ideas) themselves-by-themselves of the just, the beautiful, and the good, but under Parmenides’ questioning he is undecided as to whether there are also separate forms of the human being, fire, or water.[17] But the elder philosopher goes on to inquire whether there are forms for things that are ignoble and base: “And what about these, Socrates—they would really seem ridiculous—hair and mud and dirt, for example, or anything else which is utterly worthless and trivial. Are you perplexed whether one should say that there is a separate form for each of them too, a form that again is other than the object we handle?”[18]
Parmenides evokes hair, mud, and dirt, as Bataille evokes spit or spiders as a counterexample to the theory of forms. These other, formless objects are connected with laughter and touch, they are ridiculous, worthless, and trivial in relation to the realm of ideas that for Plato are always related to the good. In the Platonic conception, forms are ontologically the formal causes of things as well as paradigms, and epistemologically the objects of knowledge as thoughts, concepts and universals. All of these implications of the theory of forms come to bear on the famous parable of the cave in Plato’s subsequent dialogue Republic. Plato explains that our perception of the world is like that of prisoners in an underground cave, chained since birth at the leg and the neck. Unable to move their heads, the prisoners stare at the back wall of the cave with the only source of light, a fire, behind them. Between the fire and the prisoners there is a road cutting across the cave, and on the road there are people carrying statues of living things. The light from the fire projects shadows of the things onto the wall in front of the captives, but the people carrying the things are hidden by the walls along the road. For the captives of this remarkable cave, then, the shadows of the real objects in the world are all that they can ever see. Hence, Socrates points out, “In every way, then, such prisoners would recognize as reality nothing but the shadows of … artificial objects.”[19] The task of the philosopher is to liberate himself from the fetters and darkness of the physical world of the senses and escape to the freedom and radiance of the world of the mind, from mere appearances to pure forms. In this way, the theory of purity always leads away from the immediate perception of the material world and the realm of the senses. Only pure intuition and contemplation enable the free vision of the ideal world beyond the reach of the treacherous senses.
Both Parmenides and Bataille attempt to determine the limits of the theory of forms, exploring that which is incapable of being reduced to logical forms, and that which escapes idealization in Plato’s sense. For both, only something with an operational existence, like base matter or an obscene word that derives its force from the very act of delivery, transcends the logic of idea, for it is (worth) nothing in itself.
Since in the essentialist notion purity was initially defined as immaterial, the material existence of a work of art creates tension. Yet it cannot exist without involving materiality and sensuality. Instead of the notion of idealizing matter, Rosalind Krauss emphasizes the phenomenological reading that complicates the purity of conception with the contingency of perception. She argues that “in the age of post-medium condition … [even the term] „medium“ seemed too contaminated, too ideologically, too dogmatically, too discursively loaded”.[20] Rather, Krauss insists on the inseparability of the temporal and the spatial conditions of objects in a particular situation and thus, rethinks the artistic medium in a long passage „from a static, idealized medium to a temporal and material one“.[21]
Inaugural event
Scenario 3
1 Construction of an inflatable mattress floating inside the art center.
2 Moving up and down like a jellyfish.[22]
R&Sie, Floating Carpet (1996), Reopening of the Art Center in Grenoble, Inaugural event
As the principal weapon against the idealizing and fetishizing of matter Rosalind Krauss proposes four basic categories of the „use value“ of formless (alluding to Bataille’s „The Use Value of de Sade“): base materialism, horizontality, pulse and entropy.[23]
The concept of base materialism, as represented in Robert Rauschenberg’s early works such as the Dirt Paintings and Gold Paintings (1953) mingling precious materials with waste. He operates with value-loaded substances, such as gold leaf, sometimes a bit of silver, using it to cover a sheet of newspaper or other ignoble materials. Since materialism basically tends to idealize matter through setting up hierarchical relationships between the elements, Bataille claims that filth/waste is the type of matter that has no idea, no form, that „has no rights in any sense and gets itself squashed everywhere“. In this way, base materialism of filth/waste serves to eliminate all spiritual entities and the obsession with an ideal form of matter, because only what is formless cannot be draped with a „mathematical frock coat“ of science.
Referring to her second category of formless, Krauss claims that horizontality is another powerful means of the formless. This idea can be related to Bataille’s paper, „Big Toe“, an entry in the Documents proclaiming that man is proud of being erect and thus emerges from the horizontal and animal axis, although this upright posture is founded on repression of vital needs, leading to all kinds of sublimatory activities.[24] Thus, Bataille refers to Sigmund Freud’s analysis in Civilization and Its Discontents, suggesting that there are two different axes in the human body. On the one hand, arts and culture address the human as an erect and therefore mental being, because our upright posture promotes the supremacy of vision, which represents the height of reason. In this sense, pictures are conceived as a vertical section through the „purely visual“, separating the perceiver from his feet still standing in the dirt. [25] On the other hand, the horizontal axis governs the life of animal as well as of human activities relating to mere biological functions. For Bataille, the strict demarcation of the verticality of the visual field (the realm of the mental) and the horizontality of the carnal (the literal space of our body) is a fiction. Thus, he claims that „the big toe is the most human part of the human body“.[26]
According to Krauss, horizontality as the rotation of the image out of the axis of the vertical and onto the horizontal is the „literalness of formlessness“. She cites Pollock’s „drip paintings“ as the literal subversion and eliminating the prevailing hierarchical relationships and therefore, a strike against the vertical, „cultural“ axis, and equally against form.
Although the remaining two terms (pulse and entropy) are not part of Bataille’s vocabulary, pulse figures as a category that attacks the purely optical conception excluding any temporal aspects. Duchamp’s Rotoreliefs (1935) consist of a variety of spirals which alternate with eccentrically organized visual patterns. As if in motion, they create the illusion of swelling and retreating and hence, the rhythm of a pulse or beat. This pulsation is distinct from literal movement, involving an endless beat, an irruption and punctuation of the visual field. Following Krauss, this engages precisely the aspect of pulse that furthers erotic associations and „produces the intrusion of desire“.
The final category entropy, as constant and irreversible degradation of energy ultimately leads to disorder and non-differentiation within matter. Entropy is the negation of any movement, the loss of energy through heat without any performed motion. Melting is an entropic process par excellence, since it means yielding to indifference.
The operational mode of entropy relates to Gilles Deleuze and Félix Guattari’s conception of the Body without Organs (BwO), where “only intensities pass and circulate … It is not space, nor is it in space.”[27] Rather than identifying the BwO with any medium that is in a state of matter provided with a particular amount of internal structure, it defines a limit in the process of destratification. One way of imagining the BwO is as the „glacial“ level of matter/energy/information resulting from bringing the structure-generating process beyond a de-stratifying limit.[28]
In terms of dynamics the (provisional) hardening crust of appearances may be the least important component of the interacting organization. The genesis of form does not relate to any divine realm of Platonic ideas, but is rather an immanent property of the unformed flow of matter/energy/information.[29] If there appears a totality among the heterogeneous components anywhere in the process of stratification, „It is a whole of these particular parts but does not totalize them; it is a unity of all those particular parts but does not unify them.“[30]
In his Documents article „Architecture“ Bataille argues that philosophy, mathematics, and architecture have generated a system of petrification that cancels the individual perception through becoming a unified whole of fixed determinations of what was initially concrete, sensuous, and liquefied. In this way, scientific theories are attempts at „depriving, as far as possible, the universe in which we live of every source of stimulation“.[31] Bataille concludes that “it is obvious, that mathematical organization imposed on stone is none other than the completion of an evolution of earthly forms … In morphological progress men apparently represent only an intermediate stage between monkeys and great edifices. Forms have become more and more static, more and more dominant.”[32]
This tendency of the individual to disappear in a „disproportionate superiority“—and the threat to social freedom that this entails—is described by Theodor W. Adorno and Max Horkheimer as „the self-destruction of the Enlightenment“.[33] In Dialectic of Enlightenment they argue that while magic is an attempt to imitate nature preconceptually, myth firstly seeks to separate the self from amorphous nature and secondly names, classifies, rationalizes and thus subordinates nature under human control. This turn to the „blindly objective and natural“ is intensified by the birth of scientific rationalism and empiricism.[34] When nature is no longer seen as possessing secret powers, the reification and total domination of nature, and subsequently of other people, becomes possible. Thus, the Enlightenment project of separating or purifying the self from any traces of amorphous nature necessarily lead to a dissolution of the abstracted self, a condition characteristic of the totalitarian society. Adorno and Horkheimer argue that in its final stage these tendencies of the Enlightenment led to German fascism culminating in the Holocaust.
The rationalistic spirit that Horkheimer and Adorno attack can certainly be detected in most modernist architects. For example, Le Corbusier, Bataille’s contemporary, described the city as „the grip of man on nature. It is a human operation directed against nature.“[35] In a Pythagorean manner, Le Corbusier considered man essentially a geometric animal, creating pure geometry when allowed to express himself freely. Thus he could interpret culture as opposed to nature as „an orthogonal state of mind“.[36]
Le Corbusier’s Villa Savoye provides a case in point, claiming to be „the most rational of buildings“, both for its pure geometry and functionalism. In Advertisements for Architecture, no. 4 („eROTic, where glass meets mould“) Bernard Tschumi proposes yet another quality opposed to its proclaimed rationality, namely the sensuality of the ruinous state of the villa (adding a photograph of its decayed condition in 1965).[37] Tschumi connects sensuality to decay, which suggests further that „The contradiction between architectural concept and sensual experience of space resolves itself at one point of tangency: the rotten point, the very point that taboos and culture have always rejected. This metaphorical rot is where architecture lies.“[38] As Kari Jormakka notes, the point of Tschumi’s writing of „eROTic“ is that only desire „seems to involve the synthesis of opposites: the favorite material of the modernists, glass, is inorganic, pure, crystalline and seemingly timeless while mould is an organic informe growing without a specific shape“.[39]
Similar to Tschumi’s notion of architecture, R&Sie’s projects are examples of how formless, highly sensual material operates across and through a surface, disabling the imposition of form. In a recent lecture Francois Roche described his fascination with the advanced geometries of disciplines such as mathematics or physics—whether non-Euclidean, anexact or computational—for generating complex, changeable, and formless shapes.[40] For Roche, this rethinking of form has gained increasing attention in architecture largely due to the advancements of the new digital technologies for modeling on the one hand, and the innovations in fabrication and specific material performances on the other.
One of his favorite projects, Roche stated, is the house for an art collector in Trinidad, titled Mosquito Bottleneck (2003). Lurking amidst the paradisiacal environment of the tropic island are two threads of different scales: the hurricane and the mosquito-borne West Nile Fever virus. By constructing the surface of the house like a Klein-bottle-twist, R&Sie attempts „mixing this objective paranoia with a desire for safety“.[41] Mosquito Bottleneck and the project for the Contemporary Art Museum, the Dusty Relief/B-mu in Bangkok, both deal with nearly invisible perils, their powerful exaggeration, concentration (mosquito) and simulation (hurricane) on the exterior surface in order to gain a purified, safe interior space.[42] Thus, R&Sie’s use of formless bridges reason and irrational, intoxicating, even threatening situations. Instead of reducing architecture to „a highly equipped safety bunker“, Roche proposes that „What is needed therefore, is a new kind of angst-management that frames the dangers instead of blocking them out, not to senselessly offer us up as victims but in order to accept their presence and get used to them.“[43]
For surrealist thought, and by extension surrealist architecture, offers an experience of space that is grounded in individual, theatrical, even repelling, uncanny, or coarse perception. Or as Breton describes the surrealist ability to produce „uninterrupted successions of latencies“, „delirious associations and interpretations“—desire unbound. Bataille’s formless is the slippage (lapsus), while further continuing that by etymology falling due (cadentia) has the same origins as chance: it is the chance of how the dice fall[.[44] The operation of the formless challenges the rational model of the subject: it is the chance, the luck of the fall.UmBau, Do., 2008.01.24
[1] Andreas Ruby, Benoît Durandin (Eds.), Spoiled Climate, R&Sie Architects (Basel Boston Berlin: Birkhäuser, 2004), pp. 56–57.
[2] ibid., p. 107.
[3] ibid.
[4] ibid., p. 137.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] Georges Bataille, „The Notion of Expenditure“, reprinted in: Allan Stoekl (Ed.), Visions of Excess: Selected Writings 1927–1939 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985), p. 118.
[8] Denis Hollier, Against Architecture, The Writings of Georges Bataille (Cambridge/MA: An October Book, MIT Press, 1989), p. xiv.
[9] Marcel Mauss, The Gift, The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies (New York: W. W. Norton, 1990), p. 6.
[10] Georges Bataille, The Accursed Share (New York: Zone Books, [1949] 1988), cited in: Louise Tythacott, Surrealism and the Exotic (London, New York: Routledge, 2003), p. 215f.
[11] vid. Georges Bataille, Extinct America [1928], in: October (1985), reprinted in: Allan Stoekl (1985).
[12] Georges Bataille, „The Notion of Expenditure“ (1985), p. 118.
[13] Georges Bataille, Manet (New York: Rizzoli, 1983), p. 76f.
[14] Allan Stoekl (1985), p. 31.
[15] Georges Bataille (1983), p. 95.
[16] Carl Einstein, „Rossignol“ (Nightingale), in: Documents, vol 1 (critical dictionary) (Paris, 1929), p. 117.
[17] vid. Plato, „Parmenides“ 130b–c, in: Cratylus, Parmenides, Greater Hippias, Lesser Hippias, transl. by H.N. Fowler (Cambridge/MA: Harvard University Press, [1926] 1996).
[18] vid. Plato, „Parmenides“ 130c (1996); see also R.E. Allen, Plato's Parmenides, Translation and Analysis (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983).
[19] Plato, Republic VII (Republic 514a–515c) (Oxford, Oxford University Press, 1941), p. 514.
[20] Rosalind Krauss, A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition (New York: Thames & Hudson, 1999), p. 5.
[21] Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (Cambridge/MA: MIT Press, 1977), p. 292.
[22] Andreas Ruby, Benoît Durandin (2004), p. 97.
[23] Yve-Alain Bois, Rosalind E. Krauss, Formless: A User's Guide (New York: Zone Books, 1997), p. 21.
[24] vid. Georges Bataille, „The Big Toe“, reprinted in: Allan Stoekl (1985).
[25] vid. Sigmund Freud, „Civilization and Its Discontents“, in: The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud XXI, New York: Norton, 1981.
[26] Georges Bataille, „The Big Toe“, reprinted in: Allan Stoekl (1985), p. 20.
[27] Gilles Deleuze, Félix Guattari, A Thousand Plateaus (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), p. 153, (italics added).
[28] Gilles Deleuze, Félix Guattari (1987), p. 159.
[29] The term „Body without Organs“ is borrowed from Antonin Artaud and, although not exactly coinciding in meaning, BwO belongs to Deleuze’s set of overlapping theories of diagrams or abstract machines, of „smooth space“ or the „rhizome“.
[30] Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (London: Athlone, 1984), p. 42.
[31] vid. Georges Bataille, „The Use Value of de Sade“, reprinted in: Allan Stoekl (1985).
[32] vid. Georges Bataille, „Architecture“, reprinted in: Allan Stoekl (1985).
[33] Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (London: Verso, 1979), p. xiii.
[34] Theodor W. Adorno, Max Horkheimer (1979), p. xvi.
[35] Le Corbusier, The City of To-morrow and its Planning, Tr. from the 8th edition of Urbanisme by Frederick Etchells (London: The Architectural Press, 1971), pp. xxi, l.
[36] Le Corbusier, Urbanisme (Paris: Les Éditions Crés et Cie, 1925), pp. 19, 22, 35: „La culture est un état d'esprit orthogonal.“
[37] Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction (Cambridge/MA: MIT Press, 1994), p. 76.
[38] Bernard Tschumi (1994), p. 75f.
[39] Kari Jormakka, „The most architectural thing“, in: Thomas Mical (Ed.), Surrealism and Architecture (London New York: Routledge, 2004), p. 296.
[40] Francois Roche, „Rethinking Geometry“, Lecture, Academy of Fine Arts, Vienna, January 17, 2006.
[41] Andreas Ruby, Benoît Durandin (2004), p. 140.
[42] Andre Breton, „Crisis of the Object“, in: Patrick Waldburg, Surrealism (London: Thames and Hudson, 1965), p. 86.
[43] Andreas Ruby, Benoît Durandin (2004), p. 142.
[44] vid. Georges Bataille, „On Nietzsche“, in: Allan Stoekl (1985).
24. Januar 2008 Ingrid Böck
Das Entgleiten der Form
(SUBTITLE) Über das Diffuse in der Architektur
Ist die Tendenz zur Diffusität in der Gegenwartsarchitektur als Anzeichen eines pathologischen Symptoms, eines neosurrealistischen Revivals, einer unkontrollierbaren Generierung des architektonischen Schaumes zu sehen oder sogar als ein Schritt in die Richtung einer Ontologie des Nichts? Dieser Text versucht eine Erklärung dieser Tendenzen, wonach Diffusität in ihrem allgemeinsten Sinn als eine Unklarheit der Form ein zentrales Thema der Kunst- und Architekturgeschichte darstellt, das in unregelmäßigen Rhythmen auftaucht und sich auf eine Grundfrage im künstlerischen Kontinuum der Formenvielfalt bezieht, die unterschiedlich formuliert werden kann.
Diffusität kann unterschiedlich verstanden werden: Schon Hegel hat die Kunst der Antike innerhalb seines geschichtsphilosophischen Systems im Sinne einer Aufstiegs- und Verfallslogik aufgefasst, wonach sich im griechischen Tempel das Heraustreten aus der Diffusität gezeigt hat, ehe sich der Geist überhaupt aus der Kunst zurückgezogen hat und in die Sphäre der Religion übergewechselt ist. Sie kann auch im Sinne einer Öffnung und Schließung der Form verstanden werden, wie von Wölfflin anhand seiner Analyse des barocken Bauwerkes und der dort beobachteten Zunahme an Atektonik festgestellt worden ist, was in weiterer Folge sogar auf den Gegensatz zwischen dem Dionysischen und Apollinischen zurückgeführt werden kann. Neben Hegel, Winckelmann, Wölfflin und Riegl kündigt sich im 20. Jahrhundert das Thema der Vermischung und Auflösung der Form bis hin zur Dematerialisierung, in immer dichter werdenden Wellen an. Auch gilt bei vielen Autoren mit einer Präferenz für das Diffuse nun der urbane Kontext als der bestimmende Rahmen der Architektur. Texte von Benjamin, Giedion, Constant und Lyotard werden als Zeugen dafür angeführt.
Am Begriff des Diffusen wird auch deutlich, dass Architektur durch die Begriffe einer Geschichte des Stils nicht erschöpfend erklärt werden kann. Sie ist immer auch Ausdruck eines Zeitgeistes, der durch bestimmte, schwer zu ergründende kulturelle und soziale Kräfte hervorgerufen wird und sich in der Kunst in besonderer Weise manifestiert. Der Status der Diffusität entspricht daher auch der Mischung der kulturellen Explosion, die seit der Postmoderne im Gange ist und den ganzen Fundus der Kunstgeschichte in Stellung gegen die lange dominierende und kontrollierende Haltung der klassischen Moderne bringt. Daher soll der Versuch einer Darstellung und Erklärung verschiedener Typen des Diffusen in der Architektur zunächst mit einer einfachen Analyse dieses Begriffes angestellt werden.
Architektur in der Antike nach Hegel
Wenn wir bei unserem Erklärungsversuch das Diffuse als das Ergebnis einer Ergießung oder Ausstrahlung einer uns weit entfernten oder unbekannten Lichtquelle sehen und das universelle metaphysische Bild einer Kongruenz von Licht und Idee beibehalten, haben wir uns einen Leitfaden zur Hand gegeben, der noch Nützliches zu leisten vermag. Wenn wir ihn auf die Philosophie Hegels anwenden, so müssen wir festhalten, dass für seine Theorie der Ästhetik das Schöne im Zentrum der Manifestation eines sinnlichen Scheinens der Idee steht.(1) Da die Idee mit der Wahrheit identisch ist, ist auch das Schöne mit dem Wahren gleichzusetzen. Die Diaphanie der Idee im Kunstwerk entspricht daher einer Vermutung der Abnahme der Diffusität, da dieses Durchscheinen des absoluten Geistes nichts anderes als eine zunehmende Gottesnähe bedeuten kann.(2) Der Grad der Diffusität meint hier den Grad der Ergießung des Geistes in der Form des Durchleuchtens der Idee im Kunstwerk, wobei hier im Begriff des Diffusen selbst eine Widersprüchlichkeit sichtbar wird.
Kunst ist für Hegel eine Gestaltung des absoluten Geistes, der auf dem Weg des Sichselbstverstehens die Stationen der Kunst über die Religion zur Philosophie durchläuft, wo sich die Reinheit der Idee durch den wahren Begriff verwirklichen sollte. Kunst ist daher eine Bewusstseinsform der Idee, die noch nicht den höheren Status einer Vorstellung des Geistes wie die Religion und des Wissens wie die Philosophie erreicht hat, sie kann nur eine Darstellung oder ein Scheinen der Idee in sinnlicher Gestalt vermitteln.(3) Wenn wir diesen Sachverhalt in unseren Arbeitsbegriff des Diffusen übertragen, können wir der Kunst nach Hegels Logik prinzipiell nur den Status wachsender oder sich verringernder Diffusität verleihen.
Die Anwendung von Hegels geschichtsphilosophischem Ansatz auf die Ästhetik folgt dieser Logik und sieht in der Architektur eine komplizierte Entwicklung, die von den organischen Wurzeln der ägyptischen Bauwerke eine Entwicklung zu einer idealen Form des griechischen Tempels und der Statue hin vollzieht, ehe sie wieder in die kreatürliche Dimension der Natur zurückfällt, die mit der Desintegration der Form einhergeht. Hier verläuft die Entwicklung grob vereinfacht so: diffus – ideal – diffus, oder Aufstieg – Höhepunkt – Verfall.
Wenn die Sphinx die Urform des ägyptischen Symbols war(4), ein Wesen halb Tier und halb Mensch, so erkennt sich der griechische Geist erstmals in der Gestalt des Menschen, der das Animalische völlig abgelegt hat. Wenn die Pyramide die wesentliche architektonische Form Ägyptens war, ein von Hegel als misslungenes Symbol des erlösenden Aufstiegs in den Himmel zur Begegnung mit den Göttern gedeutetes Bauwerk, das sich durch gigantische stereometrische Formen ohne Fenster und Türen auszeichnete, aufgrund dieses Umstandes keinen Austausch zwischen dem Außen und Innen zuließ und nur die Mumie als Zentrum des Totenkultes barg, so war der griechische Tempel das charakteristische Bauwerk der Griechen, die ihn als die erste perfekte Form humaner Architektur im Sinne der Naturüberwindung durch Tektonik hervorbrachten. Darin manifestierte sich die Fähigkeit zur Überlistung der Schwerkraft, die auf fundamentalen Naturgesetzen beruhte und den Kosmos zusammenhielt. Daher galt Hegel die Säule als das Grundelement architektonischer Zweckmäßigkeit und Schönheit, die beim Tempel das Dach des beherbergten Gottes trug.
Trotzdem ist die Idealform des Gebäudes, der Tempel, nicht nur durch Tektonik, sondern auch durch eine bestimmte Form der Offenheit gekennzeichnet, die sich wiederum durch den Charakter der Säule ergibt. „In diesen Prostylen und Amphiprostylen, diesen einfachen und doppelten Säulengängen, die unmittelbar ins Freie führen, sehen wir die Menschen offen, frei umherwandeln, zerstreut, zufällig sich gruppieren; denn die Säulen sind überhaupt nichts einschließendes, sondern eine Begrenzung, die schlechthin durchgängig bleibt, so daß man halb innen, halb außen ist und wenigstens überall unmittelbar ins Freie treten kann.“(5)
Für Hegel entsprach der griechische Tempel dem klassischen Ideal der Architektur als Inbegriff der Mitte, der Peripteros war von keiner Wand umgeben, der Säulenumgang machte das Gebäude durchlässig und ohne feste Begrenzung. Hier kann der einmalige Fall einer Öffentlichkeit, die mit einer inneren Geborgenheit einhergeht, eintreten, hier kommt es zum Paradox einer geschlossenen Form, die nach außen hin offen ist, denn sie bedeutet die Versöhnung des Allgemeinen mit dem Besonderen.
Doch diese ideale Situation ist nur von kurzer Dauer. Mit der Mauer, die den Raum abschließt, lässt sich das Ideal der Baukunst nicht mehr aufrechterhalten, denn sie bringt eine Trennung von außen und innen mit sich. Mauern waren „Sache der Not und des Bedürfnisses, nicht aber der freien architektonischen Schönheit, weil es in der klassischen Baukunst zum Tragen keiner Wände und Mauern bedarf“(6). Der Schutz der privaten Besitztümer war nicht mit Poesie und sinnlicher Schönheit zu vereinbaren. Damit bricht dieser einmalige Balanceakt der Griechen, in dem sie den Geist mit der Natur verbunden haben, ab und die Geltung der Formel Winckelmanns von der edlen Einfalt und stillen Größe der Griechen geht verloren. Sie spielten jenes Spiel, das nach Hegel einen höheren Ernst als das Leben besaß, da seine Regeln nicht von den niederen Bedürfnissen des Lebens abgeleitet waren.
Erst der Einbruch der Natur des bürgerlichen Subjektes erzeugte auch in der Architektur eine neue Diffusität, die sich aus der Einsicht in die Notwendigkeit der Bekleidung ergab, da die Ära der edlen Nacktheit, in der der Mensch dem Gott gleich wurde, vorübergegangen war. Die völlige Klarheit des Gebäudes, wie sie im Tempel verkörpert war, wird durch Mauern verschlossen und durch die diffusen Beziehungen zwischen privat und öffentlich zersetzt. Für Hegel ist diese Entwicklung vom Symbol der noch unzulänglichen, ägyptischen Darstellung des Absoluten hin zur Kunstreligion der Griechen, in der der Gott in menschlicher Gestalt auftrat und der Mensch erstmals eine freie Subjektivität und eine Wirklichkeit, in der er bei sich sein konnte, entwickelt hatte, nur Zeichen des fortschreitenden Geistes.(7) Der nachfolgende Verlust der Harmonie in der griechischen Kunst mit ihren Verfallserscheinungen ist für Hegel letztlich ein Zeichen für den Rückzug des absoluten Geistes aus der Kunst, der sich nun im Sinne seiner Lehre in die Religion des Christentums verlagert hat.(8) Nach der Hochblüte der griechischen Kultur, die den Inbegriff der Schönheit darstellte und vielleicht deshalb schon den Keim des Verfalls in sich trug, musste die Kunst, „da sie nicht weiter hinausgieng, zurückgehen“(9). Winckelmann, der Hegels zentrale Quelle war, beschreibt den Weg, der zum Malerischen, aber auch Diffusen führt: „Es wurden [...] durch die Bemühung, alle vermeynte Härte zu vermeiden, und alles weich und sanft zu machen, die Theile, welche von den vorigen Künstlern mächtig angedeutet waren, runder aber stumpf, lieblicher aber unbedeutender.“(10) Zurück bleibt nur, um mit Beat Wyss zu sprechen, die „Trauer der Vollendung“(11).
Die offene Form bei Wölfflin
Auf dem Weg von Hegel zu Wölfflin hat sich die Sicht des Diffusen deutlich verändert und verläuft analog zum Übergang von der Philosophie des Idealismus zu der des Vitalismus und der Lebensphilosophie. Während sich bei Hegel nach dem Kulminationspunkt des Scheins in der griechischen Tempelarchitektur der Weltgeist in andere Sphären zurückzieht, sieht Wölfflin in der Geschichte der Kunst eine rhythmische Grundfigur des Wechsels zwischen den Polen der offenen und geschlossenen Form, der Klarheit und Unklarheit, des Linearen und Malerischen, Flächenhaften und Tiefenhaften, sowie der Vielfalt und Einheit.
Wölfflin stellte das Problem der Auflösung der Form anhand seiner Analyse des barocken Bauwerkes und der dort beobachteten Zunahme an Atektonik fest. Woran erkennt dies Wölfflin? Zunächst an der Ablösung der Plastik von der Architektur, denn die plastische Figur hat ihre Wurzeln in der Architektur und ihre Freimachung ist bereits ein Akt der Aufweichung der Form. „Der Sockel, die Anlehnung an eine Wand, die Orientierung im Raum – es sind alles architektonische Momente. Nun beginnt hier etwas Ähnliches, wie wir es im Verhältnis von Bildfüllung und Bilderrahmen beobachtet haben: nach einer Periode gegenseitiger Rücksichtnahme fangen die Elemente an sich zu entfremden. Die Figur entwindet sich der Nische, sie will die Mauer im Rücken nicht mehr als verbindliche Macht anerkennen, und je weniger in der Gestalt die tektonischen Achsen fühlbar bleiben, um so mehr reißt die verwandtschaftliche Beziehung zu jeder Form von baulicher Unterlage.“(12) Diese Flucht der Figuren aus ihren Nischen kündigt den Einbruch der Atektonik der offenen Form in der Kunst an. Während der tektonische Stil auf gebundener Ordnung und klarer Gesetzmäßigkeit und einem Sinn für Begrenzung und Sättigung beruht, öffnet der atektonische Stil die geschlossene Form und überführt die gesättigte in die weniger gesättigte Proportion. Die fertige Gestalt wird durch die unfertige, die begrenzte durch die unbegrenzte ersetzt. Anstelle von Ruhe entsteht der Eindruck von Spannung und Bewegung. Dazu kommt als weiterer Schritt zur Eröffnung eines Raumes des Diffusen „die Umbildung der starren Form in die flüssige Form“(13). Zunächst verläuft dieser Prozess eher in Andeutungen, da und dort wird ein Fries bauchig gestaltet, ein Haken krümmt sich zur Kurve. Wenn für die Klassik das streng geometrische Element Anfang und Ende bedeutete, so vollzieht sich im Barock ein eher naturnaher Prozess, „wenn er von den kristallinen Gestaltungen zu den Formen der organischen Natur aufsteigt“(14) und Wölfflin ergänzt noch: „Das wahre Feld der vegetabilisch freien Form ist daher nicht die Architektur, sondern das von der Mauer losgelöste Möbel.“(15) Mit dieser Passage wird nicht nur daran erinnert, dass das mit einem Blumenmuster überzogene Sofa einst auf einem tektonikflüchtigen Gestaltungsdrang des Architekten beruhte, der mit dieser Geste Natur in den Innenraum holte und damit eine nahezu revolutionäre Handlung zur Erzeugung von Diffusität vollzog, sondern auch daran, dass durch die Behauptung eines Aufstieges von den kristallinen zu den vegetabilischen Formen die Existenz eines höheren evolutionären Gesetzes mit größerem Freiheitsgrad angedeutet wird. Ohne die vermutlich von Ernst Häckel inspirierte Theorie der Naturformen im Weiteren verfolgen zu wollen, ist bei Wölfflins Theorie zumindest der Tatbestand der offenen, malerischen Form durch die Annäherung der Tektonik an eher atektonische vegetabile Naturformen aufzunehmen und sind die damit einhergehenden Auflösungserscheinungen des Festen und Geschlossenen zu untersuchen. Nun ist diese schleichende Veränderung des Baugedankens schon im englischen Garten des 18. Jahrhunderts erkennbar und der Rückzug des Gebäudes hinter große, rauschende Bäume drückte damals den Wunsch nach einem Verschwinden in der Natur aus, ehe deren Hegemonie durch die Revolutionsarchitektur endgültig geworden ist. Durch diese Zuwendung zur Natur, vom englischen Sensualismus vorbereitet und von der Französischen Revolution zur Doktrin gemacht, gibt die dionysische Öffnung zum Wald die Richtung des neuen Programms an.
Zurück zu Wölfflins Grundbegriffen. Es gibt den überzeugenden Hinweis einer Übereinstimmung der „offenen Form“ Wölfflins mit dem Begriff des Dionysischen bzw. der geschlossenen Form mit dem Apollinischen, die auf Schopenhauers Begriffen von Wille und Vorstellung beruhen.(16) Schon in seiner Dissertation hatte Wölfflin den Kontrapunkt der Architektur in einer Abwandlung und Verbesserung von Schopenhauers Gegensatz von Stütze und Last als den Gegensatz von Stoff und Formkraft bezeichnet.(17) Das geschlossen Lineare sowie das offen Malerische stellen die zwei Pole eines Kontinuums wie zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen dar, innerhalb dessen das Kunstwerk angesiedelt ist. Diffusität, so die These, wird durch die Bewegung in Richtung des offen Malerischen bzw. des Dionysischen erzeugt. Nach Nietzsche, der dieses Begriffspaar berühmt gemacht hat,(18) entspricht das Apollinische der Kunst des Bildners, das Dionysische der unbildlichen Kunst, der Musik, das Apollinische der Kunstwelt des Traumes, das Dionysische der des Rausches. „Der apollinische Rausch hält vor allem das Auge erregt, so daß es die Kraft der Vision bekommt. Der Maler, der Plastiker, der Epiker sind Visionäre par excellence. Im dionysischen Zustand ist dagegen das gesamte Affektsystem erregt und gesteigert: so daß es alle seine Mittel des Ausdrucks mit einem Male entladet und die Kraft des Darstellens, Nachbildens, Transfigurierens, Verwandelns, alle Art Mimik und Schauspielerei zugleich heraustreibt.“(19) Hier scheint sich ein nachhaltiger Paradigmenwandel in der Architektur zwischen dem Typus des Apollinischen, wie Le Corbusier und seine zeitgenössischen Epigonen, und dem neuen Typus des Dionysischen, wie eben die Architektur von Diller Scofidios Blur Building mit seiner Wolkenform, mit R Sie und ihrem Museum aus einer Staubhülle, mit Jean Nouvels Museum für Guggenheim in Tokio, abzuzeichnen; eingedenk Nietzsches Satz: „Das wesentliche bleibt die Leichtigkeit der Metamorphose.“(20) Nietzsche selbst hat dem Architekten sowohl den apollinischen als auch den dionysischen Zustand abgesprochen, denn immer stand der große Willensakt zu sehr im Vordergrund, im Bauwerk sollte sich der „Sieg über die Schwere, der Wille zur Macht versichtbaren. Architektur ist eine Art von Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmeichelnd, bald bloß befehlend. [...] Die Macht, die keinen Beweis mehr nöthig hat, die es verschmäht, zu gefallen“(21). Hier bezieht sich Nietzsche allerdings auf die Rolle des Architekturproduzenten, die nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Rezeptionstheorie Wölfflins zu bringen ist. Außerdem konnte sich Nietzsche dieses Urteil nur aufgrund der Kenntnis der Architektur der Klassik und des Historismus bilden. Ob er angesichts der neuen Architektur des Diffusen seine Meinung geändert hätte?
Riegl und das Primat des Blicks
Alois Riegl ist noch stärker als Wölfflin von Hegels Darstellung der Antike in der Geschichte der Ästhetik beeinflusst, wie sich unschwer an der Struktur seiner „Spätrömischen Kunstindustrie“ feststellen lässt. Allerdings hält auch er an einem zeitgemäßen Begriff des Kunstwollens fest, der zwar nicht mit Hegels Geist der Geschichte kompatibel ist, aber immerhin eine historische Entwicklung im Sinne eines Fortschreitens und zunehmender Abstraktion darstellt. Für Riegl ist die Kunstgeschichte vom alten Ägypten bis zum späten Altertum die Geschichte der Wendung des Kunstwollens von der haptischen (oder taktilen) zur optischen (oder visuellen) Art des Wahrnehmens. Dieses Kunstwollen entspricht der Weltanschauung und ist eine Äußerungsform des menschlichen Wollens, das sich in der Gestaltung der Welt und den sinnlich wahrnehmbaren Dingen manifestiert.(22) Diese Entwicklung vom haptischen Stadium, das auch eine Nahsichtigkeit erfordert und das am reinsten in der altägyptischen Kunst zum Ausdruck gebracht wird, verläuft über die haptisch-optische Phase der Griechen hin zur dritten Phase der antiken Kunst des späteren römischen Kaiserreiches, die im Wesentlichen optisch und fernsichtig ist. „Pyramide und Pantheon bezeichnen somit zwei entgegengesetzte Extreme der antiken zentralisierenden Baukunst, das griechische Säulenhaus dazwischen gewissermaßen die ausgleichende klassische Mitte. Die Grabkammern und das Dreieck der Pyramide sind noch taktile Formen ohne Tiefe, eher ein Bildwerk(23), im griechischen Säulenhaus erweitert sich der Blick bereits, es gibt bereits Ansätze einer Raumbildung, „erste Anerkennung der Dreidimensionalität“(24) und im Pantheon „muß die Fernsicht eintreten, [...] denn nicht zwei Punkte einer Zone derselben liegen in der gleichen Ebene [...] die stetige Tiefenwirkung zieht den Blick des Beschauers unwiderstehlich in die Tiefe [...] und appelliert an die ergänzende Hilfestellung des subjektiven Bewußtseins“(25). Diese Entwicklung des Blicks gipfelt im Tempel der Minerva Medica, wo durch die Anbringung von Fenstern im Tambour die geschlossene Form aufgebrochen wird, die für die Annahme einer fernsichtigen Kultur erforderlich ist. Ansonsten wäre „das in der Nahsicht oder Normalsicht gesehene Fenster ein störendes Loch in der Wand, eine mißfällige Unterbrechung des Taktisch-Stofflichen durch ein rein optisch-farbiges wesenloses Nichts, gleich einem Schatten“(26). „Wer den Tempel der Minerva Medica betrat, genoß nicht mehr jenes Zaubers absoluter beruhigender Einheit, der noch heute vom Innenraum des Pantheons ausströmt [...] die erfolgte Veränderung lag [...] hauptsächlich an den Fensteröffnungen, die [...] zugleich auch den Blick aus der stofflichen Hülle hinaus in den unendlichen Raum lockten.“(27)
Walter Benjamin schrieb in einer Rezension: Riegl „erkannte in dem, was bisher ,Rückfall in die Barbarei’ geheißen hatte, ein neues Raumgefühl, ein neues Kunstwollen“(28). Die Geschichte der Kunst verläuft nicht in den vermeintlich vorgezeichneten Bahnen des objektiven Geistes, sondern sie ist ein offener Prozess, denn während sie bei Hegel nach dem griechischen Tempel als Verfallsgeschichte weitergeht, ist sie bei Riegl ein Abstraktionsprozess, der mit einer Geschichte des Blickes einhergeht und auf ein Offenes hin ausgerichtet ist. Daher ist in diesem Zusammenhang die Wahl eines Begriffes der Diffusität wenig Erfolg versprechend, es sei denn, man ginge von einem Urzustand größter Diffusität aus, der einer zunehmenden Erleuchtung weicht. Jedenfalls trifft dieser Begriff des Kunstwollens auf eine Entwicklung der Architektur zu, die ein neues Verhältnis zum Raum gewinnt und als Instrument der Raumbildung selbst in Erscheinung tritt. Damit wurde auch die Ausgangsbasis der Moderne abgesteckt. In Hinblick auf die Architektur ist daher Riegls Ansatz vielleicht sogar höher als der Wölfflins einzuschätzen, da letzterer eher von der Malerei ausging und auf ein flächiges Sehbild, auf die Fassade und weniger auf den Raum, vor allem den Innenraum, hin ausgerichtet war.(29)
Riegl antizipierte bereits eine Entwicklung, in der das Subjekt selbst den Raum als wahrnehmendes betritt und sein eigenes Erleben zum Gegenstand der Erörterung macht. Wenn man den Raum nicht mehr als abstrakte Form auffasst, sondern über das Medium der eigenen Wahrnehmung bestimmt, kommt man zu völlig neuen Dimensionen des Diffusen in der Architektur, die bezeichnenderweise jetzt vom Raum der Stadt ausgehen.
Das Poröse bei Benjamin
Benjamin verfolgt in seinem Konzept der urbanen Repräsentation in seinen früheren Arbeiten eine Theorie des Porösen, mit der er das spätere Passagenwerk vorbereitet. Er beschreibt dieses Phänomen des Porösen anhand seiner Wahrnehmung der besonderen sozialen, räumlichen und zeitlichen Organisation in Neapel, das er bezeichnenderweise anlässlich eines Philosophiekongresses 1924 besucht hat und über den er Folgendes berichtet: „Spurlos fiel er im Feuerdunst der Stadt auseinander, während die Siebenjahrhundertfeier der Hochschule, zu dessen blecherner Gloriole er verschrieben worden ist, unter dem Getöse eines Volksfestes sich entfaltete. Klagend erschienen auf dem Sekretariat die Geladenen, denen Geld und Ausweispapiere im Handumdrehen entwendet waren.“(30) Diese Verwirrung der Philosophieprofessoren ist erstes Anzeichen für jenes Phänomen des Porösen, in dem die Regeln ihre Geltung verlieren, sich auch der normale Reisende nicht mehr zurechtfindet und trotz aller Hinweise im Baedeker die Kirchen nicht mehr auszumachen sind.
Die Porosität bezieht sich auf das Fehlen klarer Grenzen zwischen den Erscheinungen, der gegenseitigen Durchdringung, der Vermischung von Altem und Neuem, Öffentlichem und Privatem, Heiligem und Profanem. Die Stadt ist durch räumliche Anarchie, soziale Vermengung und vor allem Unbeständigkeit gekennzeichnet. Neben der Instabilität und den Verwerfungen der sozialen und architektonischen Formen, von innen und außen, von Archaik und Moderne zeigt die Porosität die Bedeutung dessen, was versteckt ist. Im Falle Neapels ist Verborgenheit der Schlüssel zum Verständnis urbaner Verhältnisse: „Die Stadt ist felsenhaft, aus der Höhe, wo die Rufe nicht hinaufdringen, vom Castell San Martino aus gesehen liegt sie in der Abenddämmerung wie ausgestorben, ins Gestein verwachsen. [...] Porös wie dieses Gestein ist die Architektur. Bau und Aktion gehen in Höfen, Arkaden und Treppen ineinander über. In allem wahrt man den Spielraum, der es befähigt, Schauplatz neuer unvorhergesehener Konstellationen zu werden: Man meidet das Definitive, Geprägte. Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht, keine Gestalt ihr ‚so und nicht anders’.“(31)
Das Diffuse besteht nun im Zerfließen der Dinge, einer flüssigen Durchdringung von Stadt und Mensch, von Subjekt und Objekt, was in einer völligen Vermischung münden würde, wäre nicht noch die Instanz des Selbst dazwischen. Es besteht hier eine gegenseitige Ergießung von Dingen, von denen auch die Person durchdrungen oder übergossen wird.
Die Durchdringung bei Boccioni und Giedion
Freilich war diese Vermischung von außen und innen schon in den zeitgenössischen Kunstformen angelegt. Ohne jeglichen Anspruch auf systematische Darstellung sei das Beispiel des Futurismus angeführt, der auf eine Veränderung und Transparenz der Körper durch Licht und Bewegung hinarbeitet, um eine Auflösung der Distanz zwischen Betrachter und Bildraum, eine Vermischung von Bildthemen und letztlich eine völlige Immersion zu erzielen. Boccioni etwa malt 1908 das Porträt der Signora Massimino, einer Frau, die am Fenster sitzt, um hier das Thema der blickmäßigen Verschränkung einer Wohnung mit der Großstadt durch die Darstellung einer Fenstersicht von Straßenbahnen und Fuhrwerken, die von Menschenmengen umflutet werden, aufzugreifen. Drei Jahre später wird dieses Thema mit seiner alten ikonografischen Tradition völlig reformuliert und in „La strada entra nella casa“ zu einem programmatischen Manifest des Futurismus auf der ersten Futuristenaustellung in Berlin. Das im Stile des analytischen Kubismus gemalte Bild zeigt zwar immer noch eine Frau am Balkon, die auf einen Bauplatz hinabsieht, doch scheint hier der gesamte Raum über sie zusammenzustürzen. Durch die Simultanität der Bewegungen und die kubistische Fragmentierung der Häuser werden die Gegenstände zersplittert und kommen einer Verschmelzung der einzelnen Elemente entgegen. Das vom futuristischen Maler intendierte Ziel einer Versetzung des Betrachters mitten ins Bild entspricht dem Wunsch nach Immersion,(32) einer Form der Selbstergießung in das vorgestellte Thema, die mit einer Auflösung der Grenzen zwischen innen und außen vor sich geht. Diese Tendenz wird im Verlauf der nächsten Jahre auch von Vertretern der Architekturtheorie, wie Sigfried Giedion aufgegriffen, der Folgendes schreibt: „Die Gebiete durchdringen sich: Die Wände umstehen nicht mehr starr die Straße. Die Straße wird in einen Bewegungsstrom umgewandelt. Gleise und Züge bilden mit dem Bahnhof eine einzige Größe. [...] Hochhäuser werden von Bahnen durchdrungen. Das fluktuierende Element wird Teil des Baues. [...] Die Architektur ist nur ein Glied dieses Prozesses, wenn auch ein besonderes. Darum keinen ‚Stil’, keinen eigenen Baustil. Gemeinsame Gestaltung. Fließendes Übergehen der Dinge: Ihrer Gestaltung nach öffnen sich heute alle Bauten nach Möglichkeit. Sie verwischen ihre selbstherrliche Grenze. Suchen Beziehung und Durchdringung.“(33)
Zugleich aber und trotz des ähnlichen Ansatzes wie bei Benjamin ergeben sich in weiterer Folge grundlegende Differenzen. Während Giedion, der optischen Werten den Vorzug gibt, auf die Kraft des Lichts und des Blicks vertraut, auf den Sehstrahl, der alles durchdringen und letztlich in der Konstruktion seinen Ausdruck finden möge, zu einem der erfolgreichsten Apologeten des Fortschritts wird, setzt Benjamin auf die mimetische Dimension des urbanen Raumes und kann den geschichtsphilosophischen Optimismus Giedions, wie er schon zu Benjamins Lebzeiten, exemplarisch aber erst nach dessen Tod in seinem Buch Die Herrschaft der Mechanisierung (34) zutage tritt, nicht teilen. Benjamin ahnt in diesen Texten über Neapel das Passagenwerk voraus, in dem er dann durch die mimetische Verbindung mit den in den Passagen enthaltenen Dingen in die Traumwelt einsteigt, um das Vergangene zu wiederholen und im Sinne jüdischer Eschatologie daraus die Rettung zu erlangen.(35) Giedion hingegen vermeint durch die Entdeckung und Freilegung der Konstruktion aus ihrem verborgenen Dasein, das sie noch im Historismus des 19. Jahrhunderts gefristet hatte, sich der Diffusität entwinden zu können, die dieser Epoche anhaftete. Für ihn offenbart sich der Fortschritt durch das Sichtbarwerden der Konstruktion als eine geschichtsphilosophische Notwendigkeit, die über jeden Zweifel erhaben ist. Das Primat der optischen Werte führte allerdings innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer neuen Form des Diffusen, die nun die Züge einer Verlichtung trägt. Anstelle der Emergenz von Licht geht es nun um die technischen Strahlungen, die in den Raum ausgesandt werden. Sie treten in Konkurrenz zum Licht und führen eine neue Form des Diffusen durch übermäßige Strahlungen ein.
Das Immaterielle bei Lyotard
Im Konzept zur berühmten Ausstellung der Immaterialien im Centre Pompidou von 1984 beschrieb Lyotard die neue Raum-Zeit-Dimension der Museumsinstallation, wonach die sphärischen Differenzen in LA nur mehr durch ständiges Shiften der Radiosender während des Ein- und Austritts des Autos in und aus den unsichtbaren Zonen der Sendebereiche erkennbar sind. Die Opposition zwischen Stadt und Peripherie existiert nicht mehr, noch bestehen Unterschiede zwischen der gebauten und der natürlichen Umwelt, die einen Übergang markieren könnten. „Es wäre eher angemessen, von einem Nebelgebilde zu sprechen, in dem die Materialien (Gebäude, Straßen) metastabile Zustände einer Energie sind. Die städtischen Straßen sind ohne Fassaden. Die Informationen zirkulieren über Strahlungen und unsichtbare Interfaces.“(36) Die Stadt ist ein Nicht-Ort, der sich im Zustand des permanenten Flusses befindet und der als Schnittstelle einer neuen synthetischen Zeit-Raumsituation, als eine Sammlung immaterieller elektronischer Formen, serieller Flächen von Repräsentationen und Botschaften zu sehen ist. Was in diesem Zusammenhang für unser Thema von Bedeutung ist, liegt auf der Hand. Die Stadt selbst hat sich in einen Status des Diffusen begeben, der die alten Differenzierungen von Zentrum und Peripherie aufgehoben und damit die alten raumbildenden Kräfte von Endo- und Exosphäre außer Kraft gesetzt hat.
Der Betrachter ist sämtlicher visueller Markierungen beraubt, die im anthropologischen Sinne nötig sind, um Orte mit der längerfristigen Bedeutung eines Gedächtnisortes, eines anthropologischen Ortes, zu besetzen. Von hier aus entwickelt sich die Stadt in jene Richtung des Flüssigen, die nur metaphorisch durch die Begriffe wie Telepolis, Digitale Stadt, Cybercity angedeutet werden kann und deren Ideologie des Diffusen durch die Urbanistik der Virtual City repräsentiert wird.
Wenn die Stadt selbst die Form verloren hat, wie kann sie diese ihren Gebäuden verleihen? Einen Lösungsvorschlag bieten Anthony Dunne und Fiona Raby an, indem sie unter Verzicht auf die alten Messinstrumente des atmosphärischen Klimas, wie Hydro- oder Thermometer, mit ihrem Breitband-Radio-Scanner nun die electroclimates des urbanen Raumes aufzeichnen und gleich in entsprechende Töne konvertieren, um daraus eine Karte der Elektrogeografie zu erstellen.(37) Auf diese Art lässt sich jederzeit der aktuelle elektronische Fluss eines Areals verfolgen und sollte auch jede weitere Stadtforschung erübrigen, weil der urbane Raum ohnehin mit dem Hertzian Space identisch ist.
Die Werke von Anthony Dunne und Fiona Raby stellen einen Seitenstrang zur Telepolis dar, weil sie vom Geist des design noir beseelt sind, durch den sie das geheime Leben der elektronischen Objekte zu ergründen hoffen. Dieser Blick in die Welt der Elektronik gleicht einem Thriller, der im Notopia des Elektrosmogs spielt. Der Stadtbewohner von morgen wird nach ihren Vorstellungen daher dem Typus des beta-testers entsprechen, der neue Technologien ständig an seinen persönlichen Bedarf durch die Veränderung der Software angleicht und in einem Dauerdialog mit seinen Gadgets steht.(38) Damit entspricht er perfekt der Forderung der Situationisten nach permanenter Kreativität, wenngleich diese Spielart der Hertzian Tales noch nicht voraussehbar war.
Die Ergießung der Atmosphäre bei den Situationisten
Einen differenten Zugang zur Frage des Diffusen bietet die Betrachtung der situationistischen Urbanismusdebatte, deren architektonische Umsetzung in der Gestalt des Projektes New Babylon von Constant Anton Nieuwenhuys gipfelte. Denn auf der Basis einer Theorie des Spektakels, wie sie von Guy Debord programmatisch verfasst wurde, schien die moderne Stadt überhaupt nicht mehr dem Funktionalismus verpflichtet, sondern ließ sich viel eher durch die Methode des Herumstreifens, des dérives, auf der Suche nach dem Abenteuer erschließen. „Atmosphäre wird zur Basis politischen Handelns. [...] als phantastischer Endpunkt solcher Kämpfe ist New Babylon eine riesige Atmosphären-Jukebox, die nur von einer völlig revolutionären Gesellschaft gespielt werden kann.“(39) Dieser Hinweis auf die atmosphärische Verfassung der Stadt macht das Wesen dieser neuen Form des Diffusen aus, das allerdings erst für die postrevolutionäre Ära Geltung hat. Denn dann könnte ein neuer Mensch entstehen, dessen Handlungen nur mehr auf der Grundlage von Stimmungen und expressiven Setzungen beruhen und der in einer Welt lebt, wo der Lebensinhalt hauptsächlich aus der Konstruktion von mobilen Räumen und Umwelten besteht, um sich ständig eine der jeweiligen Stimmung angepasste Atmosphäre zu schaffen.(40) Das umherschweifende und abdriftende Verhalten, das dérive, entspricht dem flüssigen Charakter der neuen Stadt der Situationisten, die genau auf diese Bedürfnisse abgestimmt ist, weil dieses Verhalten des dérive zum Motor der innerstädtischen Bewegung und der ständig wechselnden Gestalt der Stadt wird.
Neben der expliziten Abneigung gegen die fordistische Stadt mit ihren Grünanlagen, Scheiben und Hochhäusern bestand der Kern des urbanistischen Konzeptes nach Constant im „Bild der bedeckten Stadt; der Entwurf von getrennten Straßen und Gebäuden ist einer kontinuierlichen, vom Boden losgelösten Raumkonstruktion gewichen, die sowohl Gruppen von Wohnungen als auch öffentliche Räume umfasst (was Bestimmungsänderungen je nach den Bedürfnissen des Augenblicks erlaubt). Da sich jeder Verkehr im funktionellen Sinn entweder unten oder oben auf den Terrassen abspielt, gibt es keine Straße mehr. Die vielen verschiedenen Durchgangsräume, aus denen die Stadt besteht, bilden einen komplexen und ausgedehnten sozialen Raum [...]“(41).
Genauere Bestimmungen über die Gestalt der Module oder die Art serieller Elemente werden nicht gegeben, da Constant offenbar auch hier von der Annahme ständiger Innovation ausging, die eine Präzisierung der Bauteile erübrigen würde. Dieses Zusammenspiel von urbaner Bewegung und synchroner flüssiger Konstruktion entspricht völlig dem Begriff des Diffusen sowie sich die daraus resultierenden Gefühle einer „Einbettung des Leibes“ den Bedingungen der Wahrnehmung von Atmosphären als etwas „räumlich Ergossenes“(42) angleichen. Die Flüssigkeit der Atmosphäre und der Stadt werden in einer Weise synchronisiert, sodass Diffusität in höchstem Maße vorliegt. Daher hat auch Peter Sloterdijk dieses Projekt neben anderen Exemplaren von Makro-Interieurs – wie das Blur Building von Diller Scofidio oder das SITE bzw. High-Rise-of-Homes-Projekt – seinem Begriff der Foam-City substituiert und deren Grundcharakter der urbanen Raumvielfalt als eine Form des städtischen Makro-Schaums beschrieben, der naturgemäß viele Züge des Diffusen aufweist.(43)UmBau, Do., 2008.01.24
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke, vol. 13, Vorlesungen über die Ästhetik I (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1978), p. 151.
2 Norbert Schneider, Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung bis zur Postmoderne (Stuttgart: Reclam, 1996), p. 86.
3 Charles Taylor, Hegel (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1997), p. 617.
4 G. W. F. Hegel (1978a), p. 459.
5 G. W. F. Hegel, Werke, vol. 14, Vorlesungen über die Ästhetik II (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1978), p. 320.
6 ibid., p. 318.
7 Charles Taylor (1997), p. 625.
8 G. W. F. Hegel (1978b), p. 113.
9 Johann Winckelmann, Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums (Dresden: 1767), p. 487; zit. n.: Ernst H. Gombrich, Kunst und Fortschritt (Köln: DuMont, 1978), p. 52.
10 Johann Winckelmann (1767), p. 236, zit. n. Ernst H. Gombrich (1978), p. 52.
11 vid. Beat Wyss, Trauer der Vollendung (München: Matthes & Seitz, 1989).
12 Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (Basel, Stuttgart: Schwabe, 1984), p. 173.
13 ibid., p. 175.
14 ibid., p. 176.
15 ibid.
16 Werner Hoffmann, „Marsyas und Apollo“, in: Merkur, vol. 27 (Stuttgart, April/Mai 1973), p. 404.
17 Meinhold Lurz, Heinrich Wölfflin, Biographie einer Kunsttheorie (Worms: Werner, 1981), p. 240.
18 Es gibt bereits bei Plutarch eine Darstellung: Plutarch, De E apud Delphos, cap. IX, Moralia, p. 389 B; cf. Hermann Schmitz, System der Philosophie, vol. 3/4, Das Göttliche und der Raum (Bonn: Bouvier, 1977), p. 46.
19 Friedrich Nietzsche, „Streifzüge eines Unzeitgemäßen, §10“, in: Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, vol. 6, Götzen-Dämmerung, Giorgio Colli und Mazzino Montinari (Eds.), (München Berlin: dtv de Gruyter, 1999), p. 117.
20 ibid.
21 Friedrich Nietzsche (1999), p. 117.
22 Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie (Berlin: Mann, 2000), p. 401.
23 ibid., p. 36.
24 ibid., p. 39.
25 ibid., p. 44.
26 ibid., p. 49.
27 ibid., p. 50.
28 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. 3, Kritiken und Rezensionen (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1991), p. 169.
29 Meinhold Lurz, Heinrich Wölfflin (1981), p. 240.
30 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. 4/1, Denkbilder (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1991), p. 308.
31 ibid., p. 314.
32 vid. Christa Baumgarth, Geschichte des Futurismus (Reinbek: Rowohlt, 1966).
33 Sigfried Giedion, Bauen in Frankreich – Eisen, Eisenbeton (Leipzig Berlin: Klinckhardt und Biermann, 1928), p. 6; vid. auch p. 8.
34 vid. Sigfried Giedion, Die Herrschaft der Mechanisierung (Frankfurt/M: Athenäum, 1982).
35 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. 5/1, Das Passagen-Werk (Frankfurt/M: Suhrkamp, 1991), p. 161; vid. dazu: Manfred Russo, „Die Passage als Chronotopos, Geschichte der Urbanität Teil 13“, in: dérive, no. 19 (Wien, April/Juni 2005), p. 40.
36 Jean-François Lyotard, Immaterialität, Übersetzung Marianne Karbe (Berlin: Merve, 1985), p. 87.
37 vid. Anthony Dunne, Hertzian Tales (London: Royal College of Art, 1999).
38 Anthony Dunne, Fiona Raby, Design noir: the secret life of electronic objects (Basel: Birkhäuser, 2001), p. 6.
39 Mark Wigley, Constant’s New Babylon: the hyper-architecture of desire (Rotterdam: Witte de With, 1998), p. 13.
40 Auch Wolf D. Prix von Coop Himmelblau greift dieses Konzept auf: „Liquide Architektur ist eine Architektur mit integrierten Medien, die auf Bewegungen und Aktionen der Nutzer reagiert. Das kann durch den Transport des Gefühlslebens auf die Fassade geschehen, es können auch Bewegungen an einem Gebäude ablesbar werden.“, in: Christa Maar, Florian Rötzer (Eds.), Virtual Cities (Basel: Birkhäuser, 1997), p. 204.
41 Constant, „Eine Stadt für ein anderes Leben“, in: Der Beginn einer Epoche, Texte der Situationisten (Hamburg: Edition Nautilus, 1995), p. 81.
42 vid. Hermann Schmitz, System der Philosophie, vol. 3/2, Der Gefühlsraum (Bonn: Bouvier, 1969).
43 Peter Sloterdijk, Sphären, vol. 3, Schäume (Frankfurt/M: Suhrkamp, 2004), Kap. 2 C.
24. Januar 2008 Manfred Russo