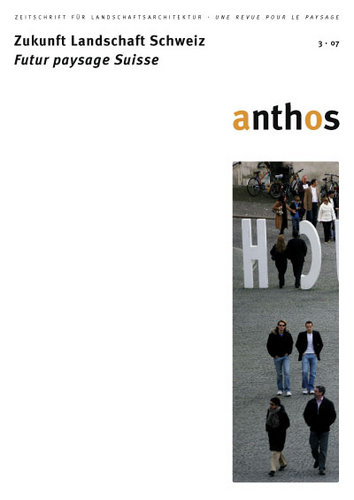Editorial
anthos, die Schweizer Zeitschrift für Landschaftsarchitektur, widmet sich seit jeher der Entwicklung und Gestaltung unserer Landschaften, in Einzelbeiträgen oder in thematischen Heften.
Das vorliegende Heft, das den ambitiösen Titel «Zukunft Landschaft Schweiz» trägt, hat anthos in Partnerschaft mit dem 2006 gegründeten «Forum Landschaft» gestaltet, welches sich als interdisziplinäre Plattform versteht, den Diskurs zwischen Forschung und Praxis sucht und das Thema «Landschaft» in eine breite Öffentlichkeit tragen möchte. Der BSLA ist Mit-Initiant und Gründungsmitglied des Forums.
Die grossen Herausforderungen, vor allem der weiterhin ungebremste Siedlungsdruck, verstärkt durch Gemeindeegoismen und einen verheerenden Steuerwettbewerb, die Umstrukturierungen in der Landwirtschaft, begleitet von einer aus landschaftlicher Sicht ungenügenden Landwirtschaftspolitik, sowie der Wandel unseres Klimas, auf den vorerst nur mit Worten reagiert wird, sind Ausgangspunkt der Diskussion. Aber auch die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen an die Landschaft. Fachleute verschiedener Disziplinen wurden eingeladen, Visionen, Bilder und Vorstellungen, Strategien und Methoden zur Entwicklung und Gestaltung der Landschaft Schweiz zu formulieren.
Einig sind sich alle Autorinnen und Autoren, dass die Landschaft, als unser Lebensraum und Ort der Identifikation, einen grundsätzlich neuen Stellenwert erhalten muss. Ein Paradigmenwechsel ist nötig, indem Landschaft nicht nur als Nebenprodukt betrachtet wird, sondern als nachgefragtes, bewusst gestaltetes öffentliches Gut. Erforderlich ist die Abkehr von sektoralem Denken und Handeln, vom Vorrang der Eigentümer- und Partikularinteressen, die heute zu einem Qualitätsverlust der Landschaft führen.
Die Artikel zeigen Handlungsfelder, Wege, Modelle, Strategien und Methoden auf, wie die Qualität und Funktionsfähigkeit der zukünftigen Landschaft gesichert werden kann. Handlungsbedarf besteht bei der Erarbeitung von weiterreichenden Visionen, Entwicklungsszenarien, Bildern, die provozieren und die Diskussion vorantreiben. Hier zeigt sich eine Lücke in der Forschung, welche sich heute erst ansatzweise oder nur auf genereller Ebene an echte Visionen, an konkretisierte Szenarien heranwagt.
Ein aktueller Bezug besteht zu zwei Volksinitiativen, die zurzeit lanciert werden: zur Initiative «Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)» und zur «Volksinitiative für ein gesundes Klima». Beide Initiativen können wesentlich dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung unserer Landschaft zu verbessern. Es muss auch gelingen, im vorgesehenen «Raumkonzept Schweiz» sowie bei der Aktualisierung des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes der Landschaft einen grundsätzlich neuen, wesentlich grösseren Stellenwert zu geben. Bernd Schubert