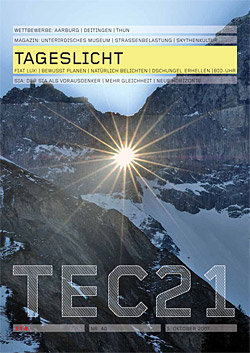Editorial
Licht leitet und führt uns, akzentuiert unsere Umgebung und gibt Sicherheit. Dabei gibt es zwei Arten von Licht: das statische, künstliche, und das Tageslicht, das in Helligkeit und Intensität changiert sowie wach macht und hält. Obwohl das bekannt ist, bewegen wir uns heute aber während eines Grossteils des hellen Tages in geschlossenen, tageslichtfernen oder gar verdunkelten Räumen sei es im Büro, zu Hause oder in öffentlichen Einrichtungen. Nachdem Kunstlicht eine Hochkonjunktur um 1900 erlebt hatte, galt es bereits in der Moderne wieder als schlechtes, krank machendes Licht. Tageslicht sollte fortan wieder vermehrt genutzt werden. Doch bis heute wird im Verhältnis mehr Aufwand betrieben, Kunstlicht zu installieren, als das Tageslicht besser zu nutzen.
Dieses Heft zeigt gute und gelungene Beispiele zum Einsatz von Tageslicht. Den Auftakt gestaltet eine Kunsthistorikerin, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Licht und Architektur befasst. Sie führt uns in die Lichtmystik des Mittelalters ein und schafft den Bogen bis in die jetzige Zeit, in der das Tageslicht wieder vermehrt in die Gebäude gelangt. Im Anschluss beschreibt ein Lichtplaner anhand dreier gebauter Beispiele den Einsatz des Tageslichtes im Gebäude. Dabei werden verschiedene Bautypen vorgestellt: als Vertreterin für öffentliche Museumsbauten das Kunsthaus in Zürich, als öffentlicher Bau für die Lehre das Bildungszentrum in Porrentruy und als Beispiel für Wohnen die Villa Grether Estlinbaum bei Zürich. Wie das Licht in die Gebäude gelangen kann, stellt ein Lichtplaner im dritten Artikel vor. In den letzten Jahren kamen einige lichtdurchlässige und lichtleitende Materialien auf den Markt (bzw. wurden erforscht) der Text bietet eine Einführung in die Thematik und stellt den Stand der Forschung dar.
Diese beschäftigt sich nicht nur mit den Materialien, bevor sie zum Einsatz kommen. Ingenieure des Forschungszentrums in Jülich haben fünf Jahre nach dem Bau der Masoalahalle die Transluzenzwerte der ETFE-Aussenhülle gemessen. Sie wollten in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Zoo feststellen, ob die UVA-, UVB- und PAR-Durchlässigkeit ausreicht, damit die Tiere und Pfl anzen, die in der Halle leben, gedeihen. Die Ergebnisse der Messung werden im vierten Artikel vorgestellt.
Neben Pflanzen und Tieren braucht auch der Mensch das Tageslicht, er benötigt die UV-Strahlung zum Beispiel für die Bildung von Vitamin D, was zum Knochenaufbau unabdingbar ist. Ein Arbeitspsychologe der TU Ilmenau beschreibt im letzten Artikel daher, wie viel Licht wir an unseren Arbeitsplätzen brauchen, um gesund zu bleiben mit einer konsequenten Einplanung des Tageslichtes in Gebäude könnten Wohlbefinden und Produktivität der Menschen gesteigert werden.
Katinka Corts
Inhalt
Wettbewerbe
Age Award 2007 | Zumtobel Group Award 2007 | Magazin für das Jugendheim Aarburg | Dorfzentrum Deitingen | Wohnüberbauung in Thun
Magazin
Unterirdisches Museum im Rampenlicht | Stress für Schweizer Strassen | Skythenkultur ans Tageslicht gebracht
Fiat Lux!
Susanne Schrödter
Ein geschichtlicher Exkurs über die Nutzung von Tageslicht in der Architektur der letzten Jahrhunderte
Bewusst planen
Christian Kölzow
Drei Bautypen, drei Herangehensweisen: über Tageslicht im Museum, in einer Schule und in einem Wohnbau
Natürlich belichten
Christian Vogt
Leiten, Umlenken und Speichern: Neue Materialien ermöglichen verschiedene Einsätze des Tageslichts
Dschungel erhellen
Martin Bauert, Gerhard Reisinger
Messungen in der Masoalahalle im Zürcher Zoo weisen nach, ob Fauna und Flora gedeihen.
Biologische Uhr
Christoph Schierz
Tageslicht beeinflusst unsere Stimmung, reguliert den Wachheitsgrad und beeinflusst die Produktivität.
SIA
Der SIA als Vorausdenker | Mehr Gleichheit | Neue Horizonte: sieben Preise in Runde drei
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Natürlich belichten
Ziel jeder Tageslichtplanung sollte es sein, das natürliche Licht zu jeder Zeit optimal zu nutzen. Neue Materialien können dazu beitragen, das Licht auch in fassadenferne Räume und Untergeschosse zu lenken. Wechselhafte Lichtverhältnisse machen die Planung jedoch komplex.
Tageslicht gilt als eine der Grundvoraussetzungen für langfristiges Wohlbefinden in Gebäuden. Es ermöglicht den Bezug zum Aussenraum und ist – zum heutigen Zeitpunkt noch anders als das Kunstlicht – wesentlich dynamischer und stimulierender. Eine sorgfältige Tageslichtplanung versteht es, gute Sehbedingungen, attraktive Innenräume und Energiehaushalt «unter einen Hut» zu bringen. Viele Fachleute sind sich heute einig, dass durch eine optimierte Tageslichtnutzung weltweit mehr Energie eingespart werden könnte, als zurzeit durch Solarzellen oder Sonnenkollektoren gewonnen werden kann. Aus dem Bedürfnis heraus, Bauten in alle Richtungen zu optimieren, ist jedoch der Entscheidungsgrat zwischen sommerlicher Wärmelast, winterlichem Wärmegewinn, Stromreduzierung beim Kunstlicht und Blendungsbegrenzung schmaler geworden. Kommt das Interesse hinzu, Tageslicht in fassadenferne Räume und Untergeschosse zu bringen, wird die Planung besonders komplex. Vor allem wenn dabei berücksichtigt wird, dass in Mitteleuropa bedeckte Himmelszustände dominieren – Sonnenlicht umlenkende Systeme können in unseren Breitengraden also nur eine ergänzende Rolle spielen. Die Tageslichtplanung muss dementsprechend auf wechselhafte Himmelszustände ausgerichtet werden. Doch dies ist nicht die einzige dynamische Komponente, denn auch die Vegetation der Umgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Tageslichtplanung. Gerade Laubbäume sind ein ideales Mittel, um im Sommer den nötigen Schatten zu spenden und im Winter eine sinnvolle Sonnenwärmegewinnung zu gewährleisten.
Computer oder Handwerk
Einige Computerprogramme für Lichtplaner und Architekten ermöglichen komplexe Simulationen bis hin zu fotorealistischen Raumdarstellungen. Doch der Einfluss sich verändernder Pflanzen bringt bis jetzt jedes Programm an seine Grenzen. Obschon einige Tageslichtberechnungsprogramme unterdessen in der Lage sind, dynamische Lichtabläufe als Film darzustellen, ersetzen gerade sie nicht die «handwerklicheren» Werkzeuge. So ist es mit Hilfe von Computern nach wie vor nicht möglich, das zu erwartende Raumgefühl spürbar zu vermitteln. Besonders bei Tageslichtprojektierungen, die vom Computer pro Standort über einige Stunden berechnet werden müssen, lohnen sich auch altbewährte Techniken. Der Blick auf das Horizontoskop (Bild 1) mit anschliessender Auswertung von Hand dauert im Vergleich etwa 30 Minuten. Neben Modellen sind in der Planung auch einfache, prägnante, aber auf komplexen Zusammenhängen basierende Tageslichtkenngrössen notwendig, zum Beispiel für rein energetische Gebäudebewertungen. Hier helfen einfache Computerprogramme weiter, die auf die Darstellung von Raum und Möblierung verzichten.1 Zu den schwierigsten Prognosen im Tageslichtplanungsprozess gehört die zu erwartende Blendungs- oder Entblendungssituation. Immer noch fehlen für viele Materialien die Daten der dreidimensionalen Reflexionseigenschaften – so lassen sich heute am Computer lediglich Trends aufzeigen. Auch bei neuen Materialien oder Techniken ist der direkte Augenschein neben der Analyse der technischen Daten in der Regel sinnvoll. Im Folgenden sollen einige neuere Tageslichtmaterialien vorgestellt werden.
Umlenken und speichern Lichtleitsteine: Hierbei handelt es sich um ein beinahe künstlerisches Raumgestaltungselement. Mittels unterschiedlich grosser, in Kunststoff oder Beton eingearbeiteter Lichtumlenkelemente wird ein irritierender Effekt erreicht. So erscheinen Licht oder Schatten da, wo es nicht erwartet wird.
Flüssighohlleiter: Sie nutzen die physikalischen Eigenschaften der Totalreflexion von Flüssigkeiten und ermöglichen so einen Lichttransport in einfachen Standardrohren ohne kostenintensive optische Materialien.
Nachleuchtende Materialien: Am uralten Traum des Speicherns von Tageslicht wird geforscht wie noch nie seit Bestehen der Menschheit. Weltweit werden zurzeit ca. 15 Mrd. Euro pro Jahr in die Entwicklung nachleuchtender Materialien gesteckt. Erste Gebäudeumsetzungen haben zwar noch Pilotcharakter, dürften sich aber in den nächsten zwanzig Jahren zur Marktreife entwickeln (Bild 3).
Sonnenröhren: Lichttechnisch optimierte Lichtschächte als Fertigbauteil erlauben kostengünstig das Einbringen von Tageslicht in tief liegende Geschosse. Sie sind bis zu einer Länge von ca. 15 m als Standard erhältlich.
Schachtreflektoren: Verschiedene Firmen haben Tageslichtleitungsprodukte entwickelt, die in erster Linie den Heimmarkt ansprechen sollen. So sind zum Beispiel standardisierte Spiegelsysteme für Kellerlichtschächte erhältlich, die eine verbesserte Nutzung von Untergeschossräumen erlauben (Bild 4).
Hologramme: Hologramme zur Tageslichtlenkung sind seit ein paar Jahren bereits auf dem Markt. Der Vorteil der exakten Vorgabe des Lichtlenkungsverhaltens auf dünnster Folie ist gross, doch der Preis zurzeit noch hoch. Hinzu kommt, dass spektrale Aufsplittungen vorkommen können, die unerwartete Farberscheinungen ergeben.
Grundsätzlich sollte bei neuen Materialien auch geprüft werden, wie das Material entsorgt werden kann. Bei Tageslichtmaterialien kommt oft die Frage der langjährigen UV-Stabilität hinzu.
Gemäss Statistik werden in den USA tagsüber für die Beleuchtung von Gebäuden ca. 10 % des gesamten Strombedarfs des Landes aufgewendet, also bei vorhandenem Tageslicht. Es sind dementsprechend noch einige Entwicklungen hin zu besserer Tageslichtnutzung zu erwarten. Eine Möglichkeit könnten auch Baumaterialien sein, die bei gleich bleibenden Eigenschaften lichtdurchlässiger werden – intelligente Verglasungen, die nicht nur ein dynamisches Transmissionsverhalten aufweisen, sondern auch eine dynamische Lichtumlenkung beinhalten. Bereits heute sind erste Produkte auf dem Markt, die ein jahresdynamisches Speicherverhalten aufweisen: wenig Wärmeaufnahme im Sommer, viel Wärmespeicherung im Winter (Bild 5). Für die Schnittstelle von Kunst- und Tageslicht werden in Zukunft ökonomisch interessante Systeme gebraucht werden, die beide Lichtarten verteilen und damit Tag und Nacht genutzt werden können.
Durch tageslichtabhängige Steuerungen ist bereits in den letzten Jahren der digitale Zustand – Ein / Aus – der Beleuchtung verlassen worden. So genannte «biodynamische» Steuerungen versuchen nun, die Kunstlichtsituation noch mehr dem natürlichen Verlauf anzupassen, wobei dies durchaus auch in der Nacht sein kann. Mit der Computertechnologie ist es heute einfach, den Sonnenuntergang im Innenraum auf zwei Uhr nachts zu verschieben. Es scheint immer noch gängig zu sein, durch eine ideal gesteuerte Beleuchtungsanlage Tageslicht zu ersetzen, anstatt es sinnvoll einzuplanen.TEC21, Mo., 2007.10.01
Anmerkung:
[1] Zum Beispiel Simulation-Wizard von alware.
01. Oktober 2007 Christian Vogt
Dschungel erhellen
Das kleine Stück Masoala-Regenwald, das im Zürcher Zoo ab 2002 in eine Halle gepflanzt wurde, beherbergt heute über 17 000 Pflanzen und circa 430 Tiere (TEC21, Heft 33-34 / 2001). Eine hoch lichtdurchlässige ETFE-Dachfolie ermöglicht es den Regenwaldbäumen, in unserer Region zu überleben. Nach fünf Jahren wurde nun erstmals am Objekt überprüft, wie viel Tageslicht das Innere der Halle durch die Folie erreicht.
Der Architekt Christian Gautschi schuf mit der Regenwaldhalle im Zoo Zürich ein Gebäude, das dem kälteempfindlichen Masoala-Regenwald-Ökosystem eine geschützte Atmosphäre garantiert. Es galt, die beiden gegenläufigen Bedürfnisse von hoher Lichttransparenz und einem möglichst geringen Energiebedarf fürs Heizen zu vereinen. Eine filigrane, stützenfreie Stahlkonstruktion in Form einer Parabel spannt eine grosse Halle auf, die den tropischen Innenraum vor dem rauen Zürcher Klima schützt. Die zehn Vierendeel-Bogenträger überspannen eine Hallenbreite von 90 m und sind im Scheitel rund 30 m über dem Boden.
Dünne Luftkissen als Dachhaut
Die Dachhaut besteht aus dreilagigen Folienkissen aus ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen). ETFE ist hoch transparent für Licht und lässt als eines der wenigen Materialien für Gewächshauseindeckungen auch UVB-Strahlung passieren. Das Material ist extrem widerstandfähig gegenüber chemischer Beanspruchung, UV-stabil und witterungsbeständig.
Verunreinigungen haften dank der geringen Oberflächenspannung nicht dauerhaft und werden aussen durch Regen und innen durch Kondensat wieder abgewaschen. ETFE wiegt weniger als 1 % einer gleich grossen Glasplatte. Nur dank diesem Material lassen sich Projekte wie die Masoalahalle zurzeit überhaupt realisieren.
Die drei ETFE-Folien (Aussenlage 200 µm, Mittellage 100 µm, Innenlage Dach 180 µm, Innenlage Fassade 150 µm) sind am Rand zu Kissen verschweisst und in EPDM(Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)-Gummiprofilen fixiert (Bild 3). Sie haben ein Flächengewicht von 0.81 kg / m2 für die Dachhaut und 0.76 kg / m2 für die Fassade. Die Kissen mit einem Stich von 1.2 m sind 4 m breit, an den Gebäudeenden 108 m und dazwischen 54 m lang. Sie werden mit trockener Luft je nach Witterungsbedingungen unter einem Druck von 250–500 Pa pneumatisch gespannt. Um die von innen in die Kissen diffundierende Feuchtigkeit abzuführen, werden die Kissen mit einer geringen Luftrate permanent durchströmt. Die gesamte Dachkonstruktion weist entsprechend den Herstellerangaben mit den dreilagigen Kissen einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 2.0 W / m2K auf.
Schon während der Bauphase wurde die äusserste Lage der Kissen durch einen Hagelschlag perforiert, was den Austausch der gesamten Dachhülle nötig machte. Die dreilagigen Kissen wurden nach ihrem Austausch mit einer zusätzlichen Folie (ETFE 200 µm) geschützt, die als Verschleissschicht dient und unabhängig von den Kissen ausgetauscht werden kann. Dies hat als Nebeneffekt die Wärmeisolation verbessert, aber auch die Lichttransparenz der Dachhaut reduziert.
Wie viel Sonnenstrahlung ist nötig?
Die Sonnenstrahlung beinhaltet kurzwellige, energiereiche ultraviolette Strahlung (UVB, 280–315 nm, UVA, 315–400 nm), das für die Pflanzen «sichtbare» Licht, welches die fotosynthetisch aktive Strahlung darstellt (PAR, 400–700 nm), und die Infrarotstrahlung (IR, 700–2300 nm). Pflanzen und Tiere benötigen zum guten Gedeihen das ganze Spektrum der Sonnenstrahlung. Wichtig sind nicht nur die Wellenlängen im sichtbaren Bereich, sondern auch die für das menschliche Auge nicht sichtbaren Anteile der UV- und der IR-Strahlung. Messdaten zur Sonnenstrahlungstransparenz grosser Gewächshäuser sind in der Literatur kaum zu finden. Selbst Angaben über den minimalen Bedarf von Pflanzen und Tieren an den unterschiedlichen Wellenlängenanteilen der Sonnenstrahlung sind kaum publiziert und noch wenig erforscht. Nach nun fast fünf Jahren Betrieb des Masoala-Regenwaldes im Zoo Zürich interessierte die Bauherrschaft, wie viel Sonnenstrahlung die Gebäudehülle durchdringt und das mittlerweile gut funktionierende Ökosystem mit Sonnenenergie versorgt. Insbesondere sollte gemessen werden, wie gross die Transparenz der nun vierlagigen Dachhaut im UV- und im PAR-Bereich der Sonnenstrahlung ist.
Neuartige Messtechnik
Von den üblichen Gewächshauseindeckmaterialien sind meist nur Transparenzwerte bekannt, die im Labor bei senkrechter Einstrahlung ermittelt wurden. Transparenzwerte im praktischen Einsatz mit Verschmutzung, Kondensation und für gealterte Materialien sind nur ausnahmsweise verfügbar. Deshalb wurde am deutschen Forschungszentrum Jülich im Rahmen eines vom Deutschen Bundesforschungsministerium finanzierten Projektes im Gartenbau ein spezielles Messsystem entwickelt, mit dem die Transparenz von Eindeckmaterialien im eingebauten Zustand gemessen werden kann. Mit zwei so genannten Tripelsensoren (Gigahertz-Optik, D-Puchheim), die UVA-, UVB- und die PAR-Strahlung gleichzeitig erfassen, wird sekundengenau die Strahlungsintensität im Freien und im Gebäudeinnern aufgezeichnet. Daraus lässt sich dann die Transparenz der Hüllfläche errechnen. Die Geräte sind nicht in der Lage, IR-Strahlung zu messen. Da diese Strahlung für das Pflanzenwachstum und die Tiergesundheit weniger wichtig ist als die übrigen Strahlungsbereiche, konnte diese Messung aber vernachlässigt werden. Am 5. Juni 2007 wurde mit diesem Messsystem die Transparenz der Gebäudehülle des Masoala-Regenwaldes aufgezeichnet. Dabei wurde ein Sensor horizontal, 1 cm unter der Dachhaut im Scheitel der Halle platziert, der andere auf dem Dach des Annexgebäudes im direkten Sonnenlicht. Zusätzlich wurde ein mobiler Sensor eingesetzt, um die Strahlung auf dem Hauptweg der Halle zu messen. Die Sensoren zeichneten zeitgleich alle zwei Sekunden die Strahlungswerte auf.
Die relevante Strahlung ist hoch genug
Direkt unter der Dachhaut konnten im Verhältnis zur parallel geführten Aussenmessung bei trockener Innenfolie maximal 74 % PAR bei direkter Sonneneinstrahlung beziehungsweise 67 % PAR bei diffusem Himmel gemessen werden (Bilder 4 und 5). Maximal 47 % der UVA- und 40 % der UVB-Strahlung drangen dabei durch die vierlagige ETFE-Dacheindeckung. Die starke Tropfenkondensation an der Innenseite der Eindeckung vermindert allerdings in den Morgenstunden die Transparenz deutlich. Die PAR-Transparenz wurde dadurch um bis zu 25 %, die UVA- und die UVB-Strahlung um 10 bzw. 13 % vermindert. Die Transparenz in den lichtschwachen Wintermonaten, bei der fast permanent eine starke Tropfenkondensation an der Innenseite auftritt, wird dadurch klar eingeschränkt. Durch die Messung wurde deutlich, dass ein grosser Anteil der für die Fotosynthese relevanten Sonnenstrahlung die Gebäudehülle trotz der nachgerüsteten Hagelschutzfolie durchdringt. Selbst im UVB-Bereich, in dem normales Floatglas nur eine minimale Durchlässigkeit aufweist, ist die Transparenz mit etwa 40 % nicht schlecht.
Erstaunlich tief sind die Strahlungswerte am Boden. 20–25 m unterhalb der Dachhaut konnten im diffusen Sonnenschein maximal 25 % PAR, 16 % UVA und 7 % UVB nachgewiesen werden. Diese tieferen Werte sind einerseits bedingt durch den Schattenwurf der Träger und der Rahmen der Hallenkonstruktion, andererseits wird ein Teil der Einstrahlung wieder nach aussen zurückgestrahlt. Im Schatten der Vegetation sinken die Transparenzwerte nochmals deutlich ab: Nur 2–11 % PAR, 1–9 % UVA, 0–2 % UVB sind dort noch verfügbar, obwohl es für das menschliche Auge hell erscheint.
Die Zukunft: Sicherer, Transparenter, energieeffizienter
Der Einsatz der ETFE-Folie für die Masoalahalle hat sich, trotz der anfänglichen Probleme bezüglich der Hagelsicherheit, bewährt. Es ist im Moment das einzige Eindeckmaterial für grosse Gewächshäuser, das bei guter Wärmedämmung eine schlanke Konstruktion mit wenig Schattenwurf zulässt. Eine noch höhere Transparenz könnte in Zukunft mit einem besseren Kondensatverhalten der ETFE-Folien erreicht werden. Entweder müsste die Tropfenkondensation vermindert werden oder wie bei Glas eine dauerhafte Filmkondensation stattfinden. Zudem sollten Lösungen gesucht werden, um den permanenten Energieverbrauch für das pneumatische Spannen der Folien sowie das Spülen der Kissen mit getrockneter Luft zu vermindern. Dazu müsste die Dampfdiffusion in die Folienkissen reduziert werden. Da Hagelschläge immer wieder auftreten können, wäre auch eine verbesserte Hagelfestigkeit von Vorteil.
Die Pflanzen im Masoala-Regenwald gedeihen sehr gut. Selbst im Winter, wenn die Sonnenstrahlung deutlich eingeschränkt ist, lässt sich ein Wachstum beobachten. Die UV-Strahlung bewirkt, dass die Bäume gedrungener wachsen. Tieren ermöglicht die UV-Strahlung die Synthese von Vitamin D für einen stabilen Knochenbau. Bei den in der Halle aufwachsenden Pantherchamäleons wurden im Gegensatz zu Tieren aus Terrarien ohne UV-Strahlung keine Probleme mit dem Knochenstoffwechsel festgestellt. Es liegt der Schluss nahe, dass die nominal mit ca. 40 % als gering erscheinende UVB-Transparenz der Gebäudehülle offensichtlich genügt, damit Tiere und Pflanzen von der durchaus auch positiven Wirkung der UVB-Strahlung profitieren können.TEC21, Mo., 2007.10.01
01. Oktober 2007 Gerhard Reisinger, Martin Bauert