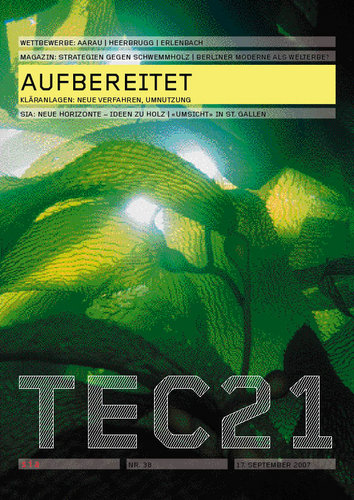Editorial
Vor etwa 30 bis 40 Jahren stand der Schweiz das Wasser bis zum Hals: nicht in erster Linie das Hochwasser wie heute, sondern die kommunale und die industrielle Abwassermenge, die seit den 1950er-Jahren rapide zugenommen hatte. Sie drohte ausserhalb der wenigen bereits mit Abwasserreinigungsanlagen (ARA) versehenen Zentren zu einer ernsthaften Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung zu werden.
Anfang der 1960er-Jahre wurde die Gefahr erkannt. In der Folge wurden bis in die 1980er-Jahre kommunale ARA mit einem Investitionsvolumen in derselben Grössenordnung wie für die etwa gleichzeitig erfolgte Erstellung der Hauptstrecken des Nationalstrassennetzes gebaut. Der aktuelle Wiederbeschaffungswert der 759 gegenwärtig in Betrieb stehenden zentralen ARA wird auf ca. 10 Mrd. Franken veranschlagt, dazu kommen über 3300 dezentrale Kleinkläranlagen und Dutzende von industriellen Aufbereitungsanlagen. Damit wird ein Anteil an gereinigtem Abwasser von 97% erreicht.
In einzelnen Fällen ist es heute ökonomisch und ökologisch sinnvoll, ältere Anlagen stillzulegen. Mit dem Klärwerk an der Glatt in Zürich Nord wurde 2002 eine der bedeutenden, in den 1970er-Jahren ausgebauten ARA der Schweiz stillgelegt. Der letzte Beitrag im vorliegenden Heft beschreibt die Umgestaltung von zunächst zwei ihrer Bauwerke für eine völlig andersartige Funktion. Für weitere Anlageteile, vor allem für die ausgedehnten, im Terrain eingelassenen Becken, werden noch Nutzungskonzepte gesucht. Die beiden ersten Fachartikel stellen aktuelle verfahrenstechnische Weiterentwicklungen in der Abwasseraufbereitung vor. Der grosse Platz- bzw. Baulandbedarf und die nicht ganz vermeidbaren Geruchsemissionen von konventionellen ARA werden mit zunehmender Ausdehnung und dichterer Besiedlung der Wohngebiete bei vielen Anlagen problematisch. Hier kann die in der Schweiz noch wenig verbreitete Membrantechnologie die Lösung sein. Das Wasser, das moderne Reinigungsanlagen mit nachgeschalteter Sandfiltration verlässt, ist optisch klar und geruchlos. Doch ist es noch durch Mikroverunreinigungen, darunter Medikamente und Hormone, verschmutzt.
Diese lassen sich bisher nicht entfernen und sind aufgrund ihrer noch weitgehend unbekannten Auswirkungen auf Menschen und Ökosysteme als Risikofaktoren zu betrachten. In einem Pilotversuch wird gegenwärtig abgeklärt, ob sich das in der Trink- und Badewasseraufbereitung bewährte Ozon auch für den Abbau der Mikroverunreinigungen im Abwasser eignet. Eine lange Zeit unbeachtete Quelle für die Verschmutzung von Oberflächengewässern ist das auf Strassen anfallende verschmutzte Abwasser. Dieses bedarf dezentraler Aufbereitungstechniken, die im dritten Fachartikel vorgestellt werden. Dazu gehört aber weiterhin auch die geordnete Versickerung in geeigneten Böden, was im kleinen Massstab derselben Technik entspricht, mit der auf den ausgedehnten Rieselfeldern um die europäischen Grossstädte des 19. Jahrhunderts die früheste geordnete Abwasseraufbereitung erfolgte. Aldo Rota
Inhalt
Wettbewerbe
Anbau mit Fingerspitzengefühl | Wabe ade | Friedhofsgebäude in Erlenbach
Magazin
Strategien gegen Schwemmholz | Ausgezeichnete Kläranlage | Abwasserreinigung mit Pflanzen | Berliner Moderne als Welterbe? | Sonnenenergie für die Stadt
Geruchlose Abwasserreinigung
Lukas Denzler
Seit die Kläranlage Uerikon mit Membranfiltern ausgerüstet wurde, gehören Geruchsemissionen der Vergangenheit an.
Ozon gegen Mikroschadstoffe
Lukas Denzler
Ein Pilotversuch in der Klär-
anlage Regensdorf soll zeigen, ob eine zusätzliche Reinigungsstufe mit Ozon problematische Mikroverunreinigungen entfernen kann.
Strassenabwasser
P. Kaufmann, E. Scheiwiller, U. Ochsenbein, M. Rudin
Der Kanton Bern testet technische Möglichkeiten, um den Naturfilter «Boden» zur Reinigung von Strassenabwasser zu ersetzen.
Dicker Dampfer
Rahel Hartmann Schweizer
Wie aus einem Schlammeindicker ein «Fass des Diogenes» wird und seine ursprüngliche Funktion trotzdem lesbar bleibt
SIA
Gespräche zur Bauökonomie | Bern: Neue Horizonte – Ideen zu Holz | Wahlen in Kommissionen | «Umsicht – Regards – Sguardi» in St. Gallen
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Ozon gegen Mikroschadstoffe
Herkömmliche Kläranlagen sind nicht in der Lage, sogenannte Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen. Seit Juli 2007 wird in Regensdorf im Rahmen eines Pilotversuchs abgeklärt, ob eine zusätzliche Reinigungsstufe mit Ozon diese problematischen Verbindungen knacken kann.
In der Schweiz werden über 97 Prozent der Abwässer in Kläranlagen eingeleitet und gereinigt. Dank dem guten Ausbaustandard der Siedlungsentwässerung hat sich der Zustand von Flüssen und Seen in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Im Vordergrund stand dabei die Elimination von Nährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kohlenstoff. Nur ungenügend abgebaut werden hingegen sogenannte Mikroverunreinigungen. Bei diesen organischen Spurenstoffen, die in den Gewässern nur in sehr geringen Konzentrationen nachgewiesen werden, handelt es sich um Inhaltsstoffe von Pflanzenschutzmitteln, Körperpflegeprodukten, Reinigungsmitteln, Hormonen und Medikamenten. Wie sich diese Stoffe auf die Ökosysteme der Gewässer auswirken, ist erst ansatzweise bekannt. Es gibt aber Hinweise, dass einige dieser Verbindungen bereits in sehr geringen Konzentrationen Organismen schädigen; so wurden bei Fischen beispielsweise Geschlechtsumwandlungen beobachtet.
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat 2006 das Projekt «MicroPoll» gestartet. Ziel ist, Grundlagen zusammenzustellen und eine Strategie zu entwickeln, wie der Eintrag von Mikroverunreinigungen aus der Siedlungsentwässerung in die Gewässer und damit auch ins Grundwasser reduziert werden kann. Ein viel versprechender Ansatz ist, die heutigen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) technisch aufzurüsten. Zwei Verfahren stehen derzeit im Vordergrund: die Behandlung des Abwassers mit Ozon und der Einsatz von Pulveraktivkohle. Seit Anfang Juli führt das Bafu in der ARA Regensdorf nun einen Pilotversuch mit Ozon durch. Ozon wirkt stark oxidierend und bildet im Kontakt mit Wasser die noch reaktiveren Hydroxylradikale, die viele Substanzen angreifen. Bei der Ozonierung werden daher komplexe Verbindungen aufgebrochen, die anschliessend biologisch viel besser abgebaut werden können. Die Untersuchungen sollen zeigen, wie effizient Ozon die unliebsamen Substanzen abbaut und welche Anforderungen das Verfahren an die ARA stellt.
Wissenschaftlich betreut wird der Pilotversuch durch das Wasserforschungsinstitut Eawag des ETH-Bereichs. Die Ozonierung ist ein Verfahren aus der Trinkwasseraufbereitung. Zur Abwasserreinigung werde es bis jetzt erst bei Industrieabwässern eingesetzt, etwa zur Entfärbung, sagt Hansruedi Siegrist von der Eawag. Im kommunalen Bereich sei die ARA Regensdorf weltweit die erste dieser Art. Die Behandlung des Abwassers mit Ozon ist günstiger als der Einsatz von Pulveraktivkohle. Zudem kann bei der Ozonierung im Unterschied zur Pulveraktivkohle auf einen Sandfilter eventuell verzichtet werden. Dies wäre von Bedeutung, weil in der Schweiz viele Anlagen keinen Sandfilter haben. Inwieweit ein Sandfilter zum Abbau der Ozonzwischenprodukte jedoch sinnvoll ist, soll im Rahmen des Pilotversuches abgeklärt werden.
Unbekannte Abbauprodukte
Laut Siegrist werden pro Kubikmeter Abwasser 3 bis 8g Ozon benötigt. Das aus drei Sauerstoffatomen bestehende Ozon wird aus flüssigem Sauerstoff (O2) vor Ort erzeugt und in einem geschlossenen Becken ins Abwasser eingeblasen. Sollte nicht alles Ozon verbraucht werden, sorgt ein thermischer Katalysator dafür, dass mit der Abluft kein Ozon in die Atmosphäre gelangt. Während 18 Monaten werden nun die Konzentrationen verschiedener Mikroverunreinigungen vor, während und nach der Behandlung mit Ozon bestimmt. Besondere Beachtung wird den Oxidationsprodukten geschenkt, über die man erst wenig weiss. Die Frage ist, ob diese tatsächlich weniger toxisch und leichter abbaubar sind. Zusätzlich werden toxikologische und biologische Untersuchungen im Abwasser nach der Ozonbehandlung und nach der Filtration sowie im Furtbach, in den das gereinigte Abwasser eingeleitet wird, durchgeführt. Regensdorf eignet sich für diese Untersuchungen besonders gut, weil der Furtbach oberhalb der ARA nicht durch Abwasser belastet ist und das gereinigte Abwasser nach dem Einleiten relativ wenig verdünnt wird.
Die Mehrkosten der Ozonierung dürften je nach Anlagengrösse und Ausbaustandard der Anlage 5 bis 20Rp./m3 Abwasser betragen. Auch der zusätzliche Strombedarf von rund 0.1kWh/m3 Abwasser ist nicht vernachlässigbar. Der Energiebedarf für die Abwasserreinigung dürfte um 30 bis 50 Prozent steigen. Siegrist plädiert hier jedoch dafür, eine Gesamtbewertung vorzunehmen. So benötigten die Kläranlagen im Vergleich zur Warmwasser- oder Trinkwasseraufbereitung relativ wenig Energie (Tabelle). Mit anderen Worten: Der Energiebedarf für die Abwasserreinigung inklusive Ozonbehandlung würde lediglich einen kleinen Bruchteil der gesamten Energie betragen, die wir heute jeden Tag benötigen.
Totaler Primärenergieverbrauch in Europa: 5000 W/Person (100%)
Warmwasserproduktion mit Strom (Elektr. Energie: 50–80 W/Person): 200 W/Person (4%)
Trinkwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung (Elektr. Energie: 15–20 W/Person): 50 W/Person (1%)
Ozonierung (Elektr. Energie: 2–4 W/Person) 6–10 W/Person (< 0.2%)
Anmerkung: Den Zahlen liegt die Annahme zu Grunde, dass für die Bereitstellung elektrischer Energie etwa dreimal so viel Primärenergie (Kernenergie, thermische Energie) benötigt wird. Für die Schweiz mit derzeit 60 % elektrischer Energie aus Wasserkraft dürfte der Primärenergieverbrauch folglich etwas geringer sein.TEC21, Mo., 2007.09.17
17. September 2007 Lukas Denzler