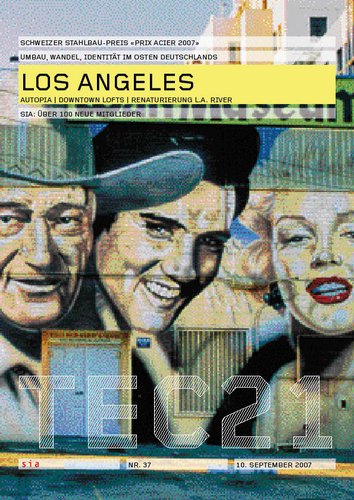Editorial
Die Stadt, in die ich vor kurzem gezogen bin, leidet unter ganz unterschiedlichen Bedrohungen. Zum einen sind dies Naturkatastrophen, vor allem Erdbeben, zum andern aber auch ganz eigene hausgemachte Mängel bei der Wasserversorgung, dem öffentlichen Verkehr und der Verslumung von Downtown Los Angeles. Jeden Tag ist in der Zeitung der Verkehrskollaps und seine Bewältigung Thema. Der Ausbau der Metro – von der nur eine unterirdische U-Bahn-Linie in der 18-Millionen-Stadt besteht – verschlingt bis 2030 über 30 Mrd. Dollar, von denen bisher 4 Mrd. privat aufgetrieben wurden. Längst werden jedoch auch andere Strategien diskutiert wie das Erhöhen der Benzinsteuer, das kostenpflichtige Benutzen bestimmter Freeways oder das schnellere Umstellen der Ampeln auf Grün.[Los Angeles Times 17.08.2007] Wie es überhaupt zur Vernachlässigung des öffentlichen Verkehrs gekommen ist, zeigt der erste Beitrag auf. Denn das Transportsystem, das Tram, gehörte – heute kaum mehr vorstellbar – zu einem der fortschrittlichsten seiner Zeit – bis die Faszination für das Auto in den 1940er-Jahren zum Bau erster Autobahnen führte und auch das Kino und die Architektur erfasste.
Die Wiederbelebung von Downtown steht derzeit bei den Planern an erster Stelle, denn bis vor fünf Jahren konnte man nach Geschäftsschluss die Innenstadt nicht mehr betreten. Eine ganze Horde von Investoren hat diesen Stadtteil nun entdeckt und baut leer stehende Hochhäuser zu schicken Lofts aus. Dass das Loft, wie es einst in New York erfunden wurde, mittlerweile auch neu gebaut wird – mit dem Versuch, den Charme der Industrieromantik zu integrieren –, kann im zweiten Beitrag nachgelesen werden. Die jüngste Idee der Stadtverwaltung ist, die Bauzonengrenze zu erhöhen, sodass die Investoren höher und auch die Blöcke näher aneinander bauen können und so animiert werden sollen, einen Anteil an Wohnungen zu errichten. Ob dies tatsächlich zum Erfolg führt, wird bezweifelt. So wäre ein neuerlicher Verkehrsstau in Downtown zu erwarten, und um wirklich städtisches Leben zu ermöglichen, müsste gerade das Gegenteil passieren: nicht eine noch dichtere Bebauung, sondern das Freilassen von Grünflächen, um Parks, Alleen und Flaniermeilen zu errichten.[Los Angeles Times 09.08.2007]
Ein weiteres Riesenprojekt, das in den nächsten 50 Jahren realisiert werden soll, ist die Renaturierung des L.A. River, der auf 82km Länge quer durch Los Angeles führt. In einer über 18-monatigen Planungsphase wurde der Masterplan, der seit Juni offiziell genehmigt und mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, ausgearbeitet. Der Fluss diente früher als einzige Wasserquelle, führte durch seine unstete Wassermenge zu Flutkatastrophen und wurde deswegen in den 1960er-Jahren fast vollständig in ein Betonbett verlegt. Heute soll er vielmehr als grüne Oase gegen die Luftverschmutzung wirken, als Anreiz für Bewohner und Firmen, sich hier niederzulassen, und für die Bevölkerung von L.A., sich in der Freizeit körperlich zu betätigen – sozusagen als Ausgleich für die täglich mehreren Stunden im Auto, die im Stau verbracht werden.
Lilian Pfaff
[1] Los Angeles Times 17.08.2007
[2] Los Angeles Times 09.08.2007
Inhalt
Wettbewerbe
Prix Acier 2007
Magazin
Umbau, Wandel, Identität im Osten Deutschlands
Sia
Beitritte zum SIA im 2. Quartal 2007 |
Kurse: Langfristig wirksame Marktstrategie; Optimaler Versicherungsschutz
Autopia
Nicholas Olsberg
Die Geschichte der Architektur von Los Angeles ist geprägt vom Kommerz und vom Auto – eine sozialhistorische Betrachtung.
Downtown lofts
Christopher Hawthorne
Drei Projekte im Geschäftsviertel Downtown L.A. zeigen Schwierigkeiten und Möglichkeiten, den Stadtteil abends wieder mit Leben zu füllen.
Renaturierung l.a. river
Lilian Pfaff
Heute wird der L.A. River als Betonwanne bezeichnet. In den nächsten 50 Jahren soll sein Ökosystem auf einer Länge von gut 50 km wiederhergestellt werden.
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Autopia
Die Geschichte der Architektur von Los Angeles ist geprägt vom Kommerz und vom Auto. Die Stadt der Häuser wurde mit Freeways durchzogen und von verschiedenen Modestilen im Hausbau beeinflusst. Wie Hotels, Cafés oder auch normale Wohnhäuser dem Immobilienhype, dem Verkehr und dem Verschmelzen des Öffentlichen und des Privaten ausgesetzt sind, lässt sich mit einer sozialhistorischen Betrachtung analysieren.
Es scheint immer nur um die Männer zu gehen, die Filme machen, Autos verkaufen, auf den Wellen surfen, sich leger kleiden oder Werbung für die Unterhaltungsmusik der Welt machen. Wenn man sich aber die TV-Serie «Real Wives of Orange County» ansieht, erkennt man, worum es in Los Angeles wirklich geht: um Frauen, die Häuser vermitteln, sie ausstatten oder kaufen möchten. Und so war es schon immer.
Von dem Zeitpunkt an, an dem die Eisenbahn in den 1880er-Jahren Los Angeles erreichte, war dies die «Stadt der Häuser». Das war es, was ihre Zeitungen, ihre Banken, ihre evangelisierenden Predigten und sogar ihre Kunst und Unterhaltung bewarben und feierten. Vom Aufrüstungswahn des Ersten Weltkriegs über den Ölboom der 1920er-Jahre, den Aufstieg der Unterhaltungsbranche, den Erfolg der Luft- und Raumfahrtindustrie in der Nachkriegszeit bis hin zu der Dienstleistungsgesellschaft der Gegenwart hat kein einziger Bereich in L.A. je konkurriert – weder hinsichtlich Beschäftigung noch Kapitalisierung noch Marketingaufwendungen – mit der Erschliessung, dem Aufbau, der Finanzierung, der Versicherung und dem Verkauf von Grundbesitz und dessen unterstützender Infrastruktur. Und keine Quelle individuellen Reichtums konnte jemals mit dem gleichgesetzt werden, was Privatpersonen mit dem Verkauf von Häusern erzielen. Man beachte das endlose Band des Verkehrs von L.A., das sich an einem Sonntag durch die ruhigsten Strassen der Stadtteile windet, während die Wallfahrt der «offenen Häuser» stattfindet. Man lausche den Unterhaltungen, in denen Wörter wie «Abriss» oder «Sanierung» zu Metaphern für Selbstverwirklichung geworden sind. Und man lese die Werbung an den Hauswänden, in welcher der vermeintliche (von Richard Dorman inspirierte) Einfluss von selbst einfachen, lokalen Architekten Häusern zusätzlichen Wert bescheren kann, und schnell lässt sich erahnen, dass Los Angeles eine Stadt ist, in der «Architektur» in gewissem Sinne schon immer das führende Gewerbe war.
Das Tram und der Aufstieg des Autos
Aus diesem Grund wurde auch ihr gewaltiges elektrisches Tramsystem – über 1900 Schienenkilometer bis 1911 – aufgebaut, damit Grundstückspekulanten Interessenten über dieses Spinnennetz, das sich so locker über ein riesiges Gebiet trockenen Landes erstreckte, herbeibringen und zum Kauf einer staubigen, freien Parzelle bewegen konnten. Und deshalb traten auch schon so früh und in einem solchen Ausmass in den 1920er-Jahren Autos in Erscheinung, als sich dieses Netz ausfüllte. Häuser wurden derart schnell und rücksichtslos über so grosse Gebiete hochgezogen, dass sich keine städtische Infrastruktur entwickeln konnte und Einkaufsmöglichkeiten und Schulen weit entfernten, nur über Strassen zugänglichen «Subzentren» überlassen wurden, welche die Hausfrauen vom Auto abhängig machten. Daher dehnte sich die erste Schnellstrasse nicht in einem urbanen Netz aus Ring- und Verbindungsstrassen aus, sondern hinaus ins offene Land, über die Berge zum San Fernando Valley, in Richtung der Wüsten von Riverside und durch die Orangenhaine im Süden, sodass man mit einer Heerschar von Migranten, die ihre Häuser mit Krediten der Federal Housing Administration (FHA) und des GI Bill kauften, ein Vermögen verdienen konnte. Das Auto brach zu schnell über Los Angeles herein und überforderte die Stadt. Da 1924 niemand warten konnte, bis die Grundlagen und Systeme für eine Stadt mit zentralen Verkehrsknotenpunkten und Zubringern, dem so genannten «Hub and Spokes»-Prinzip, gelegt waren, wurden Muster, die durch Zufall entstanden und zunächst nach einer zufälligen Geografie aussahen, schnell in ein System verwandelt: Kommerzielle Orte, die wie Westwood Village als «Verkaufsausstellung» für Häuser begannen, wurden zu «Subzentren», und gelegentliche Handelsniederlassungen entlang der Strassen wurden die Basis der Stadtplanung – so teilten sich Züge, Strassenbahnen und Autos weiterhin die gleichen spärlichen Strassen des winzigen, engen Stadtzentrums, bis sie es strangulierten. Eine reizvolle Folge der Entscheidung, die Stadt durch Dispersion zu ordnen, ist eine Ansammlung prachtvoller Zentrumsstrassen, die in den späten 1920er-Jahren «eingefroren» sind, etwa zu der Zeit, als Harold Lloyd sie beschritt.
Autopia-Kultur
Die Gewohnheiten, die Redensarten und das Wesen des Ortes vermitteln eines übereinstimmend: In Los Angeles sind Autos, Häuser, Mode und Hollywood ständig im Gespräch. Das erste Filmstudio, das 1911 nach Westen zog, war das von Mack Sennett und seinen Keystone Cops, deren Filme sich ausschliesslich um Autoverfolgungsjagden drehten, und – abgesehen von einer kurzen Unterbrechung, als die ersten Tonfilme Ton und Bewegung nicht gleichzeitig bewältigen konnten – die Liaison zwischen Film, dem sich fortbewegenden Fahrzeug und vor allem dessen Rückspiegel geht endlos weiter. Die ersten Karten, in denen die Häuser von Stars eingezeichnet waren, erschienen vor 1920, und die Studios warben in Gestalt von «Stars zuhause» eifrig auch für das letzte bisschen Häuslichkeit ihrer Schauspieler. Sie bezahlten dafür, ihre Häuser einzurichten, damit sie ihrem öffentlichen Image gerecht wurden – im Fall von Rita Hayworth erwarben sie am Tag nach ihrer Scheidung von Orson Welles sogar eine kleine Hütte, in der sie Hayworth mit Schürze und Bratpfanne präsentierten – wahrscheinlich das einzige Mal, dass sie diese als Erwachsene zu Gesicht bekam. Wesentlich dezenter war die übergreifende Werbung der auflebenden lokalen Modebranche – «California Casuals» – mit Automobil und grossräumigem Haus. Jedes diente dem Verkauf des anderen – die kleine Investition in Freizeitbekleidung führte zu dem grösseren Kauf eines Cabriolets, um das neue Outfit darin stolz zu zeigen, und weckte dann die Begierde nach einem grossräumigen, von Fenstern dominierten Patio-Haus mit einem Einstellplatz, der zwangsläufig mit beidem harmonierte. Dies war eine überzeugende Verkaufstechnik in einer Stadt, in der die einzigen Momente, in denen man sich der Öffentlichkeit präsentierte – wie ein Star bei einer Premiere –, jene waren, in denen man sich zwischen Autositz und Hauseingang bewegte.
Mode
Tatsächlich wurde die Idee, den allgemeinen Geschmack im Hinblick auf Häuser zu verändern, ganz bewusst von der Bekleidungs- und Automobilindustrie entliehen. Als sich die Bevölkerung der Region in den Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Börsenkrach verdreifachte, reichte es meist schon, Leute zu einem Grundstück zu bringen, um ihnen ihr erstes Haus zu verkaufen. Wie aber sollte man eine überhitzte Bau- und Darlehensbranche stärken, wenn die grosse Migrationswelle – diejenige, die dem Zweiten Weltkrieg folgte, war sogar noch grösser – stockte oder sich verlangsamte? Es waren nicht die Architekten oder Bauunternehmer, sondern die Banken, die als Erste zu dem Schluss kamen, dass es keinen grossen Unterschied gab, ob man bereits ein Haus besass oder ein Kleid oder Auto. Sie würden einfach dafür sorgen, dass das, was man schon hatte, morgen bereits unmodern war. Also wurden 1921 Holzbungalows und die späteren Blüten des Kunsthandwerks für unmodern erklärt und Begeisterung für spanischen und maurischen Stuck und Beton verbreitet, Mary Pickford als deren erste Fürsprecherin bestellt und Filme wie «Im Zeichen des Zorro», Hotels wie «The Garden of Allah» und wundersame Kreationen einer kaum authentischen Geschichtsauslegung wie «Olvera Street» zu ihrer Propagierung eingesetzt. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs der 1930er-Jahre bemühten sich die verzweifelten Hypothekenbanken um ein «modernes Image» – und engagierten viele jener Architekten, die wir heute bewundern, sogar den Sozialisten Ain, damit sie Abbilder des schicken, weissen Hauses mit grossen Fenstern und schlichter Front oder Bungalows entwarfen (schnell versteckten sich jedoch die meisten von ihnen nach einem anfänglichen, erfolglosen Anflug von Formenreinheit hinter Regency-Dekorationen). Dem unnachgiebigen Drängen ihrer Tochter ist es zu verdanken, aus dem Schatten eines spanischen Hauses der 1920er-Jahre in eben ein solches schlichtes, helles und «modernes» Haus zu ziehen, das die Grundlage für die fiktionale Tragödie der Mildred Pierce in «Solange ein Herz schlägt» bildete. Die Entwicklung ging noch in eine zweite Richtung: Das «Art Modern»-Haus war die schmucke, häusliche Widerspiegelung einer Filmbühne wie
die unermesslich glänzenden Wölbungen einer Busby-Berkeley-Treppe oder die prunkvollen Linien des Transatlantik-Dampfers, auf dem Fred Astaire und Ginger Rogers tanzten. Sie beide stellten die letzten ausgereiften Stile von Los Angeles dar, rationalisiert und aerodynamisch, spiegelnd, geistreich und stark an Cocktails für zwei erinnernd.
Nichts konnte weniger zu einer Stadt passen, die sich durch ihren Boom in der Kriegszeit quasi über Nacht von einer Junggesellenmetropole – mit dem höchsten Anteil einzelbelegter Wohnstätten – in eine Art ausufernder Kindertummelplatz junger Familien verwandelte. Als Tonfilme im Freien und in Farbe gedreht wurden, kamen John Ford und die Cowboy- und Pionierromantik glücklicherweise mit dem «Ranchhaus» zu Hilfe. Dieses langlebige und sich schliesslich durchsetzende Modell des hellen, leicht zu erbauenden, flexiblen und erweiterbaren Wohnsitzes war ein weitaus erfolgreicherer Prototyp des grossräumigen, den inneren vom äusseren Bereich deutlich abgrenzenden Hauses als die Häuser berühmter Architekten wie Schindler, und es passte in ästhetischer Hinsicht perfekt zu dem Bild der Familie, das jetzt im Film präsentiert wurde – mit ihren karierten Hemden und Jeans, Barbeques, Verandamöbeln und holzverkleideten Kombilimousinen, wie sie auf dem Fernsehbildschirm und auf der Kinoleinwand zu sehen waren.
Wie die Home Federal Savings von Ahmanson zeigt, folgten die Hypothekenbanken ihrem eigenen Stil und entwarfen und gestalteten ihre eigenen Gebäude, um für den Lebensstil zu werben, den sie verkauften.
Flexibilität, Mobilität und Privatsphäre
Mitte der 1920er-Jahre gab es in Los Angeles durchschnittlich fast zwei Autos in jedem Haushalt. Erst Mitte der Fünfziger konnten auch andere Städte der Welt mit einem vergleichbaren Mobilitätsgrad aufwarten. Diese einzigartige Situation führte auch zu einer Reihe einzigartiger Gebäudearten – oder bekannter Gebäudearten, die auf einzigartige Weise realisiert wurden. Und alle machten die Stadt eigenartig agil.
Allgegenwärtig ist vor allem das Bogenträgerdach, das stützenlose Mehrzweckhallen unter Bitumenschindeln mit einer zur Strasse hin ausgerichteten Fensterfront kennzeichnet. Dank dieser Konstruktion, die von in L.A. patentierten Systemen für die bahnbrechende, lokale Flugzeugindustrie und die ersten Hollywood-Studios übernommen wurde, lässt sich eine Autowerkstatt leicht in eine Reinigung oder ein Zeichentrickstudio verwandeln, indem einfach eine neue Front errichtet wird, wenn sich die Strasse nebenan von einer offenen Schnellstrasse zu einer Wohnstrasse oder sich diese Wohnstrasse zu einer Wohn- und Gewerbezone entwickelt.
Ein anderes Beispiel ist das Bungalow-Hotel, das 1921 in Form des «Ambassador» von Myron Hunt etabliert wurde, fern des Zentrums, mit öffentlichen, per Auto zu erreichenden Einrichtungen – dem Modell eines grossen Resorts kam es somit viele Jahre zuvor (Bild 1). Genau hier, mit den kleinen, von der Strasse abgewandten Häusern und der allgemein zugänglichen Fläche, die an diese angrenzte, verschmolzen das Private und das Öffentliche. Und es ist eigentlich nie das Auto gewesen, das ein Problem darstellte, sondern die Strasse, die den Angelinos ein Gräuel zu sein schien. In der traditionellen Kleinstadt und der von Strassenbahnen dominierten Vorstadt der USA war die öffentliche Front unerlässlicher Bestandteil eines Hauses. In Los Angeles jedoch trieben die Strategien, Wohnbereiche von der Strasse abzuschirmen und abzugrenzen, vielfältige Blüten. Harwell Harris realisierte dies noch auf dem kleinsten Grundstück. Ein Beispiel dafür ist das Haus am Hang mit seinen umgekehrt angeordneten Stockwerken, bei denen der Eingang oben und die untere Ebene dem Wohnbereich und Ausblick gewidmet ist. Es gab eine ständige und ideenreiche Neuinterpretation des dicht stehenden Hauses, während sich der für L.A. typische Bungalow nach und nach von der Strasse abkehrte wie bei den Dunsmuir Apartments von Ain , sich über dieser erhob wie bei Sheats «l’Horizon» von Lautner (Bild 3) und sich schliesslich einfach um einen Pool herumzog, abgeschirmt von der Strasse, wie ein Motel ohne Eingang.
Ersatz für öffentliche Räume
Los Angeles, das die meiste Zeit seiner Stadtgeschichte von einem Stadtzentrum mit einem einzigen öffentlichen Platz geprägt war und weder Boulevards noch Parks besass, verfügte immer schon über weniger urbane offene Areale und Grünflächen als irgendeine andere amerikanische Stadt von vergleichbarer Grösse (so spärlich waren diese in den 1920er Jahren, dass Flugplätze den Mittelpunkt für Freizeitaktivitäten bildeten). Auto und Schnellstrasse fungierten daher als eine Art Ersatz für öffentliche Plätze. Dies bedeutete weitaus mehr als nur Begegnungen mit Fremden – obwohl es Handbücher zu Flirttechniken auf der Schnellstrasse gab. Es bedeutete auch, dass das sich fortbewegende Fahrzeug ein Beobachter und Konsument der flüchtigen Szene war. Und vielleicht wandten sich Häuser gerade deshalb für einen so langen Zeitraum von der Strasse ab. Die Ausstellungsräume für Automobile mit ihren grossen Glasfronten zeigten den vorbeifahrenden Fahrzeugen als Erste ihre Waren, Cafés und Restaurants zogen nach und überliessen hinter den Glasscheiben so viel von sich und ihren Kunden dem freien Blick, um den Fahrer schnell genug dazu zu bewegen, langsamer zu werden und anzuhalten. Als die Strassen gepflastert wurden und der Verkehr schneller wurde, tauchten allmählich andere Lösungen auf wie der Drive-in-Verkauf, der sich den an den Strassenecken vorbeiziehenden Verkehrsstrom zunutze machte. Dabei wurde der Drive-in-Bereich mit einem Pylon markiert und beleuchtet, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, die Bestellung aufzunehmen und die Waren zum Auto zu bringen, sodass Kunden nicht aussteigen mussten. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zum Drive-in-Restaurant, in dem einem das Essen verzehrbereit gebracht wurde, aber keiner fuhr fort, um dieses zu essen, sondern das Auto selbst wurde zur gemeinschaftlichen Tafel.
Suche nach Orientierungspunkten
Das erste Gebäude, das in den Zwanzigern in jedem neuen Viertel errichtet wurde, war – neben dem Verkaufsbüro – eine charakteristische Tankstelle mit angegliederter Verkaufsstelle, deren Turm sich wie ein Ausrufezeichen über die staubige Ebene erhob. Als die Stadtbebauung zum Ende des Jahrzehnts immer dichter wurde, kamen zu diesen ersten «Anziehungspunkten» atmosphärische Kinos hinzu – welche die flache Landschaft noch triumphierender mit ihren Pylonen unterbrachen, sodass sie vom fahrenden Auto aus gesehen werden konnten – wie Stiles Clements’ grosse Romanze in Leimert Park. Hollywood fügte sich freimütig und feierte all seine grossen Premieren in den Kinos dieser Einöde – umgeben von nichts Anderem als einer Tankstelle, einem Blumengeschäft, den Flaggen, die leere Grundstücke markierten, und den Hunderten von Autos, die darauf parkten. Als die kommerzielle Expansion entlang der Boulevards gen Westen fortschritt, wurde diese Idee in grösserem Stil verwirklicht, und das Modell des Turms, der auf einem zwei- bis sechsstöckigen Fundament ruhte – wobei ihn das niedrigere Fundament abgrenzte und zugleich besser erkennbar machte –, entwickelte sich zu einer zentralen Werbestrategie und etablierte diesen als wesentlichen Markierungspunkt für eine Bevölkerung, die zum ersten Mal Auto fuhr und die meiste Zeit orientierungslos war. Los Angeles war immer schon eine horizontale Stadt, aber diese sorgfältig gesetzten, vertikalen Orientierungspunkte an den Strassen waren ein wunderbarer Ausdruck der Dynamik dieser Stadt, anfangs noch einfache Pylonen mit Aufschriften, dann vollkommen mit Steinmetzarbeiten überzogen, und nach und nach mit verändertem Massstab der Dekorationen und flacherem dekorativen Relief, als der Verkehr schneller wurde. Dann kam Farbe ins Spiel, als Technicolor die Kinoleinwände eroberte, und schliesslich wurden sie zu schmucklosen Strukturen, die sich mit der Veränderung des Lichts und der Entfernung verwandelten und wie im Falle von Capitol Records ihre Form als eigenes Leitsystem einsetzen konnten.
Dennoch ist dies eine Stadt, deren Geschäft Gebäude sind und in der kein Gebäude als dauerhaftes Monument bestehen kann. Gott weiss, dass sie es versucht haben – vom Rathaus über das Theme Building am Flughafen, das Water and Power Building, Coca Cola und das Pan Pacific bis hin zur Disney Hall. Aber man kann nicht nur mit einem isolierten Orientierungspunk in einer Region auskommen, in der keiner derselben Strasse folgt, keiner sich in die gleiche Richtung bewegt oder am selben Ziel ankommt. Doch zwei Monumente sind unvergänglich. Die unausweichliche Wand der Berge, die dem Fahrzeug folgt und den Weg zeigt, die einst die Stadt im Norden begrenzte und nun mitten durch sie hindurchgeht, die aber stets jedem Versuch widerstand, den Horizont von Menschenhand zu ordnen. Und ein vertrauter Schriftzug, der vor vielen Jahren in diesen Bergen installiert wurde – und wie die Jesus-Statue auf dem Zuckerhut von Rio die meiste Zeit von weiten Teilen der Stadt aus sichtbar ist. Er war dort platziert worden, um für jene Art von Grundstückspekulation zu werben, die schon immer der Puls dieser Stadt war.
[ Nicholas Olsberg, Chief-Kurator 1989–2004 und dann Direktor des CCA, Canadian Centre for Architecture, Montreal, heute freischaffender Architekturhistoriker ]TEC21, Mo., 2007.09.10
10. September 2007 Nicholas Olsberg