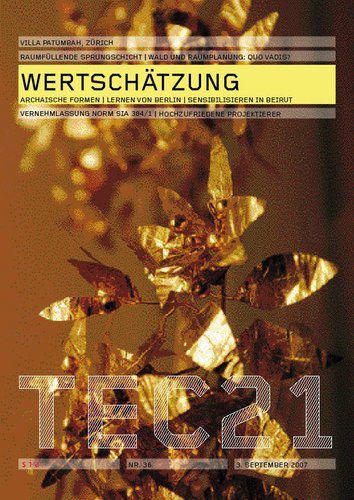Editorial
Gesellschaftliche Achtung und Anerkennung orientieren sich meist an den Leistungen oder der Beliebtheit einer Person. Bei Architekten und Ingenieuren geschieht dies zum einen über die Anerkennung des Titels, zum anderen oftmals über die Berichterstattung in Zeitschriften, die über die Qualität ihrer Werke befindet oder in der Realität über die Höhe der Honorarleistungen. Letzteres scheint dabei genauso willkürlich zu sein wie die oft subjektive Architekturkritik, denn Stararchitekten erhalten ein anderes Honorar und Prestige als alle anderen. Dass aber diese selbst auch Schwierigkeiten bei der Ausführung ihrer Bauten haben, zeigen Beispiele von Perrault in Moskau oder Herzog & de Meuron in Peking.
Die Leistungen, gemessen an der Qualität der Bauwerke, und deren Wertschätzung betreffen sowohl das Erhalten des architektonischen Erbes und damit den Umbau, die Sanierung oder das Weiterbauen am Bestand als auch das Erstellen von Neubauten. So forderte schon Gottfried Semper, dass sich niemand in seine Entwürfe einmische, und er kritisierte heftig den lange Zeit in Dresden wirkenden Altertumsforscher Johann Joachim Winkelmann: Durch ihn und viele andere Kunsthistoriker sei wegen fehlender Wertschätzung «an der Architectur schreiendes Unrecht geschehen [...]». So wäre es eigentlich selbstverständlich, den Architekten bzw. die Architektin des Bauwerkes bei einem Umbau hinzuzuziehen. Dies geschieht jedoch leider allzu selten und ist urheberrechtlich nicht einzufordern, denn alles, was nachträglich – nach der Fertigstellung des Baus – von der Bauherrschaft verändert wird, ist rechtens, sofern es sich nicht um ein geschütztes Denkmal handelt. Oftmals fehlen auch die objektiven Kriterien für qualitätvolle Architektur – ist diese dem Zeitgeist unterworfen oder der nicht mehr angemessenen Nutzung?
Bei Neubauten beginnt die Auseinandersetzung um die Wertschätzung der Planer bereits in der Wettbewerbsphase und deren gerechter und angemessener Durchführung, sie geht weiter bei der Planung und den Abänderungsmöglichkeiten durch Dritte und damit der Gewährung des Urheberrechts und endet in der Ausführung, wenn andere Partner wie Unternehmer und Investoren mitwirken. So führen derzeit der Architekt I.M. Pei und der Bauunternehmer Fluor Corp über die Überschreitung von 40 Mio. US-Dollar bei der Errichtung des Orange County Performing Art Center in Kalifornien einen Rechtsstreit, wobei auch die Ästhetik der Architektur Teil der Debatte ist.
Wichtig ist, dass ein Bewusstsein geschaffen wird, das der Baukultur einen adäquaten gesellschaftlichen Stellenwert zugesteht. Preise wie der AIA Gold Medal Award, der 2006 an Antoine Predock verliehen wurde (S. 18 ff.), können dabei helfen. Doch selbst bei fast schon historischen Figuren wie Oskar Niemeyer (S. 27ff.), wo dieser Stellenwert eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, sind Grenzen gesetzt. Und von anderen wie Meinrad Gerkan in Berlin (S. 24ff.) muss dieser Stellenwert erst mühsam erstritten werden – nicht nur um die Ehre des Architekten zu wahren, sondern für den Erhalt des Berufsstandes der Architektinnen und Ingenieure und deren kreative Leistungen.
Inhalt
Wettbewerbe
Villa Patumbah, Zürich
Magazin
Raumfüllende Sprungschicht | Wald und Raumplanung: Quo vadis?
Archaische Formen
Dominic Marti
Das Schaffen des Architekten Antoine Predock ist geprägt von der Bauweise der Anasazi-Indianer. Bauwerk und Landschaft verschmelzen zu einer Einheit.
Lernen von Berlin
Isabelle Vogt
Der Lehrter Bahnhof von Berlin darf nicht entstellt werden. Mit diesem Urteil setzt das Landgericht Berlin ein Zeichen für den Schutz gestalterisch wertvoller Bauwerke.
Sensibilisieren in Beirut
Carole Gürtler
Im Libanon diente ein unvollendetes Messegelände von Oscar Niemeyer lange als Militärbasis. Nun kämpfen Intellektuelle für dessen Erhalt und Schutz.
SIA
Symposium Via della Pietra | Vernehmlassung Norm SIA 384/1 Hochzufriedene Projektierer| Seminar Freizeitwald
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Archaische Formen
An der Wand hinter Antoine Predocks Arbeitstisch hängen zwei grosse Schwarzweissfotos von Chaco Canyon und Pueblo Bonito, Bauten der Anasazi-Indianer aus der Hochblüte ihrer Kultur zwischen 850 und 1150. Es ist diese Architektur, die auf sein Schaffen grossen Einfluss ausübt und auf die er seine Arbeiten bezieht. Predock ist Träger zahlreicher renommierter Auszeichnungen und erhält diesen Herbst den Design-Award 2007 des Smithsonian Cooper-Hewitt National Museum.
Predocks zeitgenössische Werke weisen den Bauten der Anasazi-Indianer (Kasten S.20) ähnliche architektonische «DNA-Spuren» auf. Es sind archaische Formen, die die Erd-
kruste durchstossen – Bauwerk und Landschaft verschmelzen dabei zu einer Einheit: schlichte, fensterlose Gebäudeformen, die als Teil der Landschaft wahrgenommen werden. Predock arbeitet mit nackten Materialien, die der Kargheit der Landschaft entsprechen. Seine Bauten integrieren sich in einen Kontext, sind aber als eigenständige, moderne Zeichen lesbar. Sie sind mit der Tradition und dem Wesen des Ortes verbunden. Predock: «Die Grundlage meiner Entwürfe ist immer der Ort, der Ausdruck des Geistes eines Ortes. Hinter diesem universalen Anspruch steht die Frage nach dem Wesentlichen, dem Tiefgründigen, Unsichtbaren.»
Zwanzig Jahre baute Predock in der Landschaft, die seine Heimat geworden war, im Südwesten der USA. Seine Bauten dort sind dem Wüstenklima angepasst, sie gelten als gute Beispiele eines zeitgenössischen Regionalismus. Sein Hauptbüro ist in Albuquerque an der Route 66, weitere Ateliers befinden sich in Los Angeles und Taiwan. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist Predock über den regionalen Rahmen hinausgewachsen, Projekte in
Florida, Texas, Taiwan, Minnesota, Wyoming, Winnipeg, Los Angeles, Paris, Kopenhagen, Sevilla, San Diego und Agadir liegen auf den Tischen.
«Wer in der Wüste baut, muss wissen, woher der Wind weht»
1936 geboren in einer Kleinstadt in Missouri, zog Predock Mitte der 1950er-Jahre nach Albuquerque zum Studium an der UNM University of New Mexico. Sein Lehrer Don Schlegel erkannte bald seine Begabung zum Zeichnen. Nach dem Diplom und Arbeiten in Architekturbüros in Texas realisierte Predock seinen Erstling, die Wohnsiedlung La Luz (Bilder 1–3) am Stadtrand von Albuquerque an den Ufern des Rio Grande(1967–74). Lehmziegel zu Blocksteinen geformt und luftgetrocknet (Adobe), so bauten bereits die Pueblo-Indianer und die Spanier. La Luz ist alt und zugleich neu. Predock hat der Lehmarchitektur ihren Platz in der Modernen Architektur geschaffen. Dicke Mauern schützen vor glühender Tageshitze und geben die im Lehm gespeicherte Wärme in den kühlen Nächten an die Räume ab. «Wer in der Wüste baut, muss wissen, woher der Wind weht.» (Predock)
Nach Südwesten, der Richtung, aus der die jährlichen Sandstürme kommen, zeigen sich nur fensterlose Mauern. Mit äusserster Sorgfalt ist die Mauer bearbeitet. Sie ist das schützende Element, wächst tief aus dem Erdinnern zum Himmel, trennt Licht von Schatten, verbindet Himmel und Erde. Die Farben der Wände stehen im Einklang mit der Wüstenlandschaft. Antoine Predock: «New Mexico hat mein Denken, meine Entwürfe geprägt, New Mexico ist eine Herausforderung, die ich angenommen habe, New Mexico ist eine Schule, die mich die richtige Verhaltensweise gelehrt hat; diese Erfahrungen haben auch anderswo ihre Gültigkeit.»
Bewusstere Wahrnehmung unerwarteter Räume
Der Mythos der Goldenen Städte von Cibola, in New Mexico vermutet, bewahrte die Indianer New Mexicos vor grösseren Massakern. Etwas von diesem Mythos lebt weiter im Werk von Antoine Predock: die geheime Öffnung, durch die Energie des Kosmos in die menschliche, kulturelle Manifestation strömt (Campbell). Der Zugang zum Raum will entdeckt werden. Predocks Bauten offenbaren sich nicht auf den ersten Blick. Wo geht es hinein, wie komme ich wieder heraus? Der Betrachter wird verführt zum bewussten Wahrnehmen unerwarteter Räume.
Zur bewussten Wahrnehmung gehört auch eine gewisse Desorientierung. Der Weg führt durch Schleusen, an jeder Schleuse gibt der Besucher ein Stück Erinnerung ab an den Lärm, an die Gluthitze. Das grelle Licht wird gebrochen, filtriert. Der Besucher wird erfasst vom geheimnisvollen Innenraum mit seinem Wechselspiel von Licht und Schatten – ein Kino-Effekt. Architektur erfahren ist eine physische und intellektuelle «Reise» – ins Unerwartete. Die Choreografie muss stimmen wie bei Tanz und Ballet (während seiner Studienzeit hatte sich Predock intensiv mit Tanz und Ballet, mit der Bewegung des Körpers im Raum befasst). Der Bewegungsablauf bringt ständigen Wechsel der Gegensätze: Spannung – Entspannung, Licht – Schatten, wechselnde Raumhöhen.
bauen mit phantasie und Disziplin
Nebst dem musischen Talent verfügt Antoine Predock über die Doppelbegabung Phantasie und Disziplin. Phantasievoll und zugleich diszipliniert ist sein erster grösserer Bau – ein Auftrag aus einem Wettbewerb –, das Nelson Fine Arts Museum (1989, Bild 4): ein kühner Bau, dynamisch. Der Besucher wird auf eine Entdeckungsreise geführt, langsam wandert das Auge vom Licht ins Dunkel. Der Bau auf dem Universitätsgelände beinhaltet ein Kunst- museum, eine Schauspielschule, ein Tanzstudio, ein Theater und mehrere Skulpturengärten. Wesensverwandt und doch anders: das Spencer Theater for the Performing Arts, auf einer Mesa (Tafelberg) in der Wüste von New Mexico gelegen (Bilder 5 und 6). Lage und Form sind abgeleitet vom majestätischen Bergmassiv der Sierra Blanca: ein weisser Baukörper (Kalkstein), der die Erdkruste durchdrungen hat, um dem Berg die Reverenz zu
erweisen. Im Innern des Theaters, im Foyer, schweift der Blick weit über die Mesa.
Überraschend ist der Zugang zum Besucherzentrum im Rio-Grande-Naturreservat (Bilder 7 und 8). Durch einen langen Tunnel betreten die Besucher das Naturreservat und finden sich am Ausgang in der üppigen Natur des Rio-Grande-Ufers wieder. Eine akustisch gelungene Ergänzung ist die Übertragung der vielen Vogelstimmen in den Raum der Beobachtungsstation (1982).
In den Wohnhäusern Lazarus und Shadow House zeigt sich die Fähigkeit zur Abstraktion. Beide Bauten gehen weit über das übliche Adobe-Haus hinaus. Der Raum ist fliessend, die Übergänge sind rund, es gibt keine spitzen Kanten und rechten Winkel. «Lazarus» ist ein Zeichen in der Wüste.
Ebenso durch ein klares Zeichen gut sichtbar ist die Mesa Public Library (inneres Titelbild) an der Kante der Mesa (1994). Sie besteht aus Bibliothek, Lesesälen, Büchermagazin und Verwaltung. Der Bau wählt einen Mittelweg zwischen einer abstrakten Skulptur und der stilistischen Anpassung an die Umgebung der Forschungsstation Los Alamos.
In diesen Tagen wird Predocks neustes Werk, die Architekturschule von New Mexico, eingeweiht: Die New School of Architecture and Planning UNM ist ein gemeinsames Werk von Antoine Predock und Jon Anderson. Der Bau will den Studierenden das Potenzial vermitteln, das in guter Architektur und Raumgestaltung liegt, er soll Lehrstück sein für werdende Architekten, Ansporn, es noch besser machen zu wollen. Die UNM ist landesweit die einzige Architekturschule direkt an der legendären Route 66.
Identifikation mit dem Ort
Letztes Jahr durfte Predock für sein Gesamtwerk den AIA Gold Medal Award entgegennehmen, und In diesem Herbst wird er anlässlich der National-Design-Woche auch den Preis des Smithsonian Cooper-Hewitt National Design Museum erhalten. 1980 bereits hatte die Zeitschrift «Forbes» Antoine Predock als einen der Erneurer der amerikanischen Architektur aufgeführt, mit ihm damals I.M Pei, Philip Johnson, Ezra Ehrenkranz, Bennie Gonzales, Charles Moore, John Rauch, Denise Scott Brown und Robert Venturi. Robert Venturi über seinen Kollegen Predock: «Es ist genial und zeugt von grosser Kunst, wie Antoine sich mit dem Ort, wo er baut, identifiziert. Diese Qualität macht ihn zur Weltklasse.»
Das Werk von Antoine Predock passt in kein Schema und keine Schule. Er ist Einzelgänger, ohne Paten und Sponsoren. Gerade diese Stellung macht ihn in Amerika so populär. Dem Betrachter in Europa sind wohl das Hotel Santa Fe bei Paris, das Projekt für den Amerikanischen Pavillon an der Weltausstellung in Sevilla oder jenes für das Dänische Nationalarchiv bekannt – im Übrigen muss ihn Europa aber noch entdecken.TEC21, Mo., 2007.09.03
03. September 2007 Dominic Marti