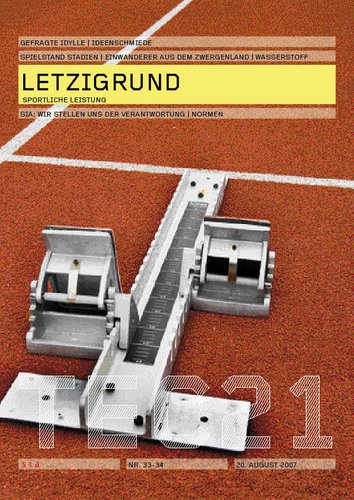Editorial
Bulldozer, Schrottgreifer und Betonbeisser machten sich einen Tag nach «Weltklasse Zürich 2006» an den Rückbau des alten Letzigrundstadions – die entscheidende Phase des Neubaus begann. Mit dem Abbruch der Flutlichtmasten endete symbolisch die Ära des altehrwürdigen Letzigrunds. In kürzester Zeit wurde eine neue Arena an gleicher Stelle errichtet, sodass bald schon nicht vier einzelne, sondern ganze 31 Lichtmasten ihr Flutlicht ins Stadion werfen.
Das neue, multifunktionale Stadion wurde innerhalb von nur einem Jahr gebaut. Mit feinfühliger Präzision konnte den umweltspezifischen Aspekten nachgegangen werden. Mit geschickter Eleganz bringen die Architekten die Filigranität und Transparenz zur Geltung. Mit hartnäckiger Ausdauer erbrachten die Ingenieure die statischen Nachweise. Mit diszipliniertem Krafteinsatz ermöglichten die Stahlbauer eine schnelle Montage, und mit beeindruckender Schnelligkeit und permanenter Beschleunigung wurde eine kurze Bauzeit erreicht. – Eine sportliche Leistung, die den Anlässen, wie sie das Letzigrundstadion kennt, ebenbürtig ist.
Eine Medaille ist bereits vergeben. Der Schweizer Stahlbaupreis Prix Acifer 2007 geht an das Letzigrundstadion. Die Jury wertschätzt damit den Neubau und belohnt die Beteiligten mit einer Auszeichnung für ihren beeindruckenden Einsatz. Weitere Medaillen folgen am 7. September: Mit dem Golden League Meeting «Weltklasse Zürich 2007» wird das neue Stadion eröffnet. Clementine van Rooden
Inhalt
Wettbewerbe
Gefragte Idylle | Ideenschmiede
Magazin
Spielstand Stadien | Einwanderer aus dem Zwergenland | Die grosse Wasserstoff-Illusion | Strassenverkehr | «Baukultur entdecken » | Dumont-Praxis abschaffen?
Geringe Belastung
Martin Schmid
Umweltschonend und quartierfreundlich ist das Letzigrund nicht nur in der Betriebsphase. Umweltspezifische Aspekte bestimmten auch die Bauphase.
Viel Transparenz
Benjamin Muschg
Die durch viel Transparenz geprägte, multifunktionale Arena wird damit auch zum Freizeitpark.
Grosse Auskragung
Tomazˇ Ulaga
Das auskragende Dach auf
den filigranen Stützen aus Stahl sind die statischen Hauptmerkmale des Stadions.
Kurze Bauzeit
Rudolf Hirt, Marco Santucci
Die äusserst
kurz veranschlagte Bauzeit stellte eine logistische Herausforderung dar.
Schnelle Montage
Martin Mensinger
Weil alle Tragelemente verschieden sind, mussten in der Werkstattplanung, beim Transport und bei der Montage spezielle Massnahmen getroffen werden.
SIA
Wir stellen uns der Verantwortung | Normen |
Personalbörse
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Geringe Belastung
Im Frühjahr 2002 entschied der Gemeinderat der Stadt Zürich, an Stelle des alten Letzigrunds ein modernes, den neusten Ansprüchen genügendes Leichtathletik- und Eventstadion zu bauen. Damit war beschlossen, dass das Stadion im dicht bebauten Kontext des Letzigebiets bleibt. Es musste aber in diesem bereits stark belasteten Umfeld sowohl quartierverträglich wie auch umweltschonend sein.
Schon 2001 untersuchte das Amt für Hochbauten unter Beizug von Experten in der strategischen Planung für das neue Stadion die Themen im Bereich Umwelt. Die wichtigsten Ergebnisse daraus bildeten Rahmenbedingungen für den zweistufigen Gesamtplanungs-studienauftrag, der 2003 / 2004 durchgeführt wurde. Im Rahmen des Vorprojekts fand mit dem Gestaltungsplan eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) statt. Diese Erkenntnisse wiederum flossen in die Baubewilligung ein und waren bzw. sind Bestandteil des Baus und Betriebs des neuen Stadions. Für den Bauprozess wurde ausserdem eine Umweltbaubegleitung (UBB) eingesetzt. Beauftragte der Bauherrschaft begleiteten und überwachten zusammen mit der Totalunternehmung den gesamten Bauprozess auf der Umweltebene. Alle Umweltthemen wurden – eingebettet in das integrale Projektqualitätsmanagement (PQM) – systematisch und periodisch in Sitzungen besprochen. Wenn nötig leiteten die Fachplaner geeignete Massnahmen ein. Zu den wichtigsten Themen bezüglich Umweltschutz während der Bauphase gehörten ein ausgeklügeltes Materialmanagement, der Grundwasserschutz, der Rückbau und das Recycling. Für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudes spielten Energie und Verkehr eine wesentliche Rolle. Jeder einzelnen Problemstellung wurde entsprechendes Gewicht beigemessen.
Materialmanagement
Mit innovativen Planungsansätzen konnte das Materialmanagement während der Bauzeit optimiert werden. Infolge der Teilversenkung des Stadions fielen insgesamt etwa 350 000 m³
Aushub, Kies und Rückbaumaterialien an (Bild 3). Der daraus verursachte erhebliche Baustellenverkehr musste minimiert werden. Grundsätzlich sollten längere Transporte vermieden und möglichst grosse Mengen auf der Baustelle wiederverwendet werden. So kaufte ein Unternehmen frühzeitig den anfallenden Wandkies, der in einem Zwischenlager mit einer Kapazität von 40 000 m³ nahe der Baustelle gelagert wurde. Dadurch konnten grosse Mengen an Wandkies in der Stadt behalten und wieder verbaut werden. Weitere 40 000 m³ Wandkies wurden vor Ort zu Betonkies trocken aufbereitet und als «Letzibeton» verarbeitet und wieder eingebaut (Bild 2).
Die Unternehmer hatten weitere Auflagen zu erfüllen: Es mussten mindestens 4-Achser mit 32 t Gesamtgewicht eingesetzt werden, mindestens 95 % aller Lastwagen mussten der EURO3-Abgasnorm entsprechen, und es durfte nur schwefelfreier Dieseltreibstoff verwendet werden. Mit diesen Massnahmen konnten rund 7000 Lastwagenfahrten und 600 000 Transportkilometer sowie die entsprechende Luftbelastung vermieden werden. Der CO2-Ausstoss reduzierte sich um 380 t, der NOX-Ausstoss um 4.3 t und der Feinstaubausstoss um 110 kg.
Grundwasserschutz
Das Areal des Letzigrundstadions liegt in direkter Nachbarschaft zum Schlachthof Zürich. Da dieser eine eigene Grundwasserfassung besitzt, liegen grosse Teile des Letzigrundareals in der Gewässerschutzzone. Infolgedessen erarbeitete das Planerteam in Zusammenarbeit mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) des Kantons Zürich ein Schutzkonzept. Über ein Messnetz wurden die Schutzzonen in regelmässigen Abständen beprobt. Zusätzlich installierten Fachleute eine automatische Sonde, die im Notfall eine Alarmierung der Verantwortlichen per SMS erlaubt hätte. Allerdings traten keine Probleme auf. Bei Arbeiten in der kritischen Grundwasserzone S2 wurde die Grundwasserfassung während Wochen gänzlich ausser Betrieb genommen, was zu erheblichen Mehrkosten für die Bauherrschaft führte.
Rückbau und Recycling
Insgesamt musste die Bauherrschaft rund 29 000 m³ Material fachgerecht entsorgen lassen (Bilder 4 und 5). Dazu gehörten auch mit Schadstoffen belastete Bestandteile der alten Anlage. Der Laufbahnbelag der alten Tartanbahn beispielsweise enthielt Schwermetalle, die eine Entsorgung problematisch machten. Statt einer zulässigen Verbrennung fand der verantwortliche Unternehmer eine noch bessere Lösung – der Belag wurde zu Lärmdämmmaterial aufbereitet. Im alten Stadion stellte man zudem geringe Mengen an Asbest fest. Diese Bauteile sowie auch die PCB(Polychloridbiphenyl)-Fugen in der alten Tribüne wurden nach einem Überwachungs- und Schutzkonzept entsorgt.
Energie
Nur durch eine ausgeklügelte Wärmeerzeugung kann die gewünschte Nachhaltigkeit erreicht werden. Die notwendige Energie für das Stadion liefern darum zwei Holzpelletskessel, die CO2-neutral Wärme liefern. Ein zusätzlicher Gaskessel deckt den Bedarf in Übergangs- und Spitzenlastzeiten ab. Für die Warmwasservorerwärmung ist auf dem Dach zusätzlich eine Solaranlage mit einer Fläche von 90 m² installiert. Ausserdem entsteht dort auf einer Fläche von ca. 2500 m² die zurzeit grösste Fotovoltaikanlage der Stadt Zürich (Bild 1). Sie erzeugt durchschnittlich eine Leistung von 250 kV/A, was dem Strombedarf von ca. 70 Haushaltungen entspricht. Trotz dem Einsatz regenerierbarer Energieträger konnten die Grenzwerte für Minergie für die Gebäudehülle aufgrund der ungünstigen Tribünengeometrie nicht ganz erreicht werden. Der Standard für die Minergiebeleuchtung wird jedoch erfüllt.
Verkehr
Der öffentliche Verkehr trägt mit seinem attraktiven Angebot wesentlich dazu bei, dass Grossveranstaltungen im Stadion Letzigrund durchgeführt werden können. Der statistische Wert für die Verkehrsmittelwahl (Modal Split) bei Grossveranstaltungen ist aufgrund der geeigneten Erschliessungen sehr gut. Der Neubau des Stadions verkürzt sogar den Zugang zur wichtigsten Haltestelle Letzigrund. Das Fuss- und Radwegnetz um die Sportstätte ist bereits gut ausgebaut. Durch die offene Architektur des Stadions wird die Durchlässigkeit des Areals zukünftig im Alltag noch verbessert. Für den motorisierten Individualverkehr wird es auf dem Stadionareal auch in Zukunft keine Parkplätze für Veranstaltungsbesucher geben. Die vorhandenen Abstellplätze dienen nur dem Betrieb. Dadurch sowie mit dem neuen, automatisierten Verkehrsleitsystem verringert sich die Belastung für die Anwohner.
Martin Schmid ist Projektleiter für das Stadion Letzigrund, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich TEC21, Mo., 2007.08.20
20. August 2007 Martin Schmid
Viel Transparenz
Noch ist im neuen Letzigrund kein Weltrekord und kein Tor gefallen, aber die Meinungen sind längst gemacht. Zwischen Anerkennung und Begeisterung liegt etwa das Spektrum der Reaktionen von Architektinnen und Ingenieuren auf das elegante, subtil in die Umgebung eingepasste Zürcher Stadion, das schon vor der Fertigstellung mit dem Stahlbaupreis Prix Acier ausgezeichnet wurde.
In der Bevölkerung der angrenzenden Quartiere Altstetten, Sihlfeld und Hard herrscht überwiegend Vorfreude auf einen neuen öffentlichen Treffpunkt. Und die Leichtathletinnen und Leichtathleten, die den Letzigrund mit dem Meeting «Weltklasse Zürich» am
7. September einweihen, geraten im Angesicht der neuen Sportanlage ins Schwärmen. «Das Stadion ist schlicht ein Hammer», fand etwa der deutsche Stabhochspringer Tim
Lobinger kürzlich bei einem Rundgang auf der Baustelle.
Weniger euphorisch wird die Architektur der Arbeitsgemeinschaft der Zürcher Architekturbüros Bétrix & Consolascio und Frei & Ehrensperger dagegen in Fussballerkreisen beurteilt. Für den FCZ und die Grasshoppers ist der neue Letzigrund kein Grund, nicht weiterhin auf einen baldigen Umzug in ein neues Fussballstadion auf dem Hardturmareal zu hoffen. Mit ihren zehn VIP-Logen verdienen die beiden Klubs je rund 1 Million Franken jährlich – im geplanten Fussballstadion hätten sie dreimal so viele Logen. Die Fussballfans ereifern sich in den Internetforen seit Monaten über das «Anti-Fussballstadion». Die wichtigsten Kritikpunkte: Die Entfernung zum Spielfeld sei zu gross, wegen der offenen Architektur könne keine Stimmung aufkommen, dafür seien die Zuschauer Wind und Wetter ausgesetzt, ausserdem hätten die roten Klappsitze die falsche Farbe (Baslerrot statt Zürcherblau).
Ohne Mantelnutzung
Wäre der neue Letzigrund nämlich noch nicht bezugsbereit, dann würden im Sommer 2008 in Zürich keine Partien der UEFA-Europameisterschaft stattfinden, deren Gastgeberin die Schweiz gemeinsam mit Österreich sein wird. Wenn diese Fussballspiele nicht in Zürich ausgetragen würden, so behaupteten wenigstens Stimmen der Zürcher Politik und Medien in den letzten Jahren, dann würde die Stadt einen gravierenden Imageverlust erleiden. Im schwierigen Planungsprozess mit zeitweise unklarem Ausgang wurde beispielsweise erst nach zwei mehrstufigen Planungsverfahren deutlich, dass die Vision eines «Superstadions» für Fussball und Leichtathletik mit Mantelnutzungen auf dem Hardturm städtebaulich und wirtschaftlich nicht zu realisieren ist. Schliesslich war der Entscheid des Stadtrats im Herbst 2004, das bereits vorliegende Siegerprojekt des Wettbewerbs für ein neues Leichathletikstadion auf dem Letzigrund ein Jahr schneller als geplant und Fussball-EM-tauglich zu realisieren, ein Befreiungsschlag, der zu einem positiven Ende führte.
Für die Öffentlichkeit
Weil die Stadt bei der Ausschreibung des Wettbewerbs für den Letzigrund davon ausging, dass das Hardturmstadion zuerst realisiert werde, mussten die Teilnehmer eine Infrastruktur entwerfen, die mit dem internationalen Leichtathletikmeeting und einer Handvoll anderer grösserer Events pro Jahr stark unternutzt wäre. Folgerichtig ist das Projekt «Corculum impressum» (eingegrabene Muschel) der Architektengemeinschaft Bétrix & Consolascio und Frei & Ehrensperger auch ein Stadion, das nicht in erster Linie für Spitzensportler, sondern vor allem für die Quartierbewohner nutzbar ist. Der Kontrast des neuen Letzigrunds zum Projekt für das Fussballstadion von Meili, Peter Architekten könnte kaum grösser sein: Während die Fussballarena dereinst als kolossale Skulptur auf einem viergeschossigen Sockel mit Mantelnutzungen thronen soll, fliesst die Stadt förmlich durch den neuen Letzigrund hindurch.
Das Stadion öffnet sich ganz seiner Umgebung. Im Osten kann es von der Herdernstrasse aus ebenerdig vollständig eingesehen und betreten werden. Die Tribüne führt dort vom Strassenniveau aus 8 m in den abgesenkten Innenraum hinunter. An den Querseiten steigt sie sanft an, bis hinauf zur 10 m höheren Westtribüne. Erschlossen wird der Publikumsraum über eine auf Stützen liegende, umlaufende Rampe, die gleichzeitig die darunter liegende Pausenzone überdacht. Über dem Stadion schwebt der Dachring, der für seine imposante Grösse hauchdünn wirkt. Dazwischen fällt der Blick auf den bewaldeten Üetliberg, die Backsteinfassaden des Schlachthofs und die braunroten Betonplatten an den Hardau-Hochhäusern. Auch im Innenraum dominieren erdige Töne; die Robinienholzlatten an der Dachunterseite, der angerostete Stahl der «tanzenden» Stützen, die in drei leicht unterschiedlichen Rottönen flimmernden Klappsitze, die Tartanbahn, die Rasenfläche. Die farblichen Übergänge sind fliessend.
Der Letzigrund ist im Wesentlichen eine Grube im Erdreich mit überdachten Wällen für die Zuschauer. Als Gebäude erscheint nur die Westtribüne, in der sämtliche sekundären Nutzungen des Stadionbetriebs untergebracht sind. Zürichs neue Sportstätte ist wie das Urstadion im antiken Olympia mehr Landschaftsgestaltung als Architektur und steht damit auch in der modernen Tradition der Olympiastadien von Berlin und München – oder Eduardo Souto de Mouras Stadion in Braga, das auf einer Schmalseite in den Fels gebaut ist und sich auf der anderen zur Landschaft öffnet.
Stadionpark statt Hexenkessel
Offen soll der Letzigrund nicht nur für das Auge sein. Das Konzept der Architekten sieht vor, dass das ganze Stadion einschliesslich der Tribünen frei zugänglich sein soll, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Die Erschliessungsrampe wird dann zur Flaniermeile, die Stadiongastronomie am höchsten Punkt der Westtribüne zum Aussichtsrestaurant, die Fankurve zur Schmuseecke – das ganze Stadion zum Freizeitpark. Die Architektur des Letzigrunds ist auf einen solchen Alltagsbetrieb ausgelegt. Ohne zusätzliches Personal und finanziellen Mehraufwand wird sich die schöne Vision vom Stadion als Quartiertreff aber nicht umsetzen lassen. Wenn die Idee des Stadionparks aber an diesen Kosten scheitert, ist auch der Letzigrund wie so viele Sportanlagen zwischen Abpfiff und Anpfiff nur eine grosse Brache.
Die grosse Chance des neuen Letzigrunds liegt neben seinen ästhetischen Qualitäten darin, dass er ein Gegenmodell zum Typ des hermetisch abgeschlossenen «Hexenkessels» ist und sich damit von den ikonenhaften Fussballtempeln, wie sie etwa Herzog & de Meuron in Basel und München gebaut haben, nicht nur durch seine Leichtathletikbahn unterscheidet. Er steht im Gegensatz zu den meisten jüngeren Stadionneubauten eben nicht auf der sprichwörtlichen grünen Wiese, sondern mitten in einem Wohnquartier – und damit quer zum Trend. Aus Investorensicht muss ein Stadion heute vor allem über einen Autobahnanschluss und ausreichend Parkplätze verfügen, umso besser, wenn es auch noch ein ansprechendes Äusseres hat. Wenn es aber ein städtisches Stadion gibt, das heute noch funktionieren kann, dann müsste es der neue Letzigrund sein.TEC21, Mo., 2007.08.20
20. August 2007 Benjamin Muschg