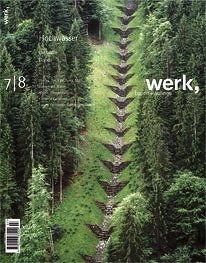Editorial
Es ist noch gar nicht so lange her, dass man Naturkatastrophen mehr mit historischem Interesse begegnete, wenigstens in unseren Breitengraden. Dass in Indien oder in einer chinesischen Provinz nach einem Hochwasser Tausende Menschenleben zu beklagen waren, nahm man mit Trauer und Bedauern zur Kenntnis und half, war aber auch froh, dass solches weit weg von uns geschah. Keiner sprach von Klimawandel, und niemand hätte vor zwei Jahrzehnten gedacht, dass sich die sogenannten Jahrhundertereignisse eines Tages häufen würden. Inzwischen sind wir wohl so weit. Dass die Temperaturen steigen, ist mittlerweile unbestritten, und schon wenige Grade globale Erwärmung haben das natürliche Gleichgewicht der Umwelt bedenklich aus dem Lot gebracht. Wir kennen die Folgen. Mit Flüssen, die über die Ufer treten und verheerende Schäden an Leib und Gut verursachen, werden wir vermehrt zu rechnen haben. Vieles wird man mit baulichen Vorkehrungen schützen wollen und können, besonders im Bereich der Siedlungen, doch gibt es auch Orte, wo aus wirtschaftlichen Gründen das letzte Risiko nicht aus der Welt zu schaffen ist. Mehr denn je sind deshalb heute präventive Massnahmen im Bereich der Planung wichtig. Mit dem Instrument der Gefahrenkarten soll verhindert werden, dass in gefährdeten Lagen neu gebaut wird. Die detaillierten Karten geben Aufschluss über zu erwartende Wassermengen und Pegelstände und definieren die unterschiedlichen Gefahrenbereiche, die es bei Bauvorhaben zu berücksichtigen gilt. Dort, wo sich ältere Gebäude bereits in gefährdeten Zonen befinden, legen die Karten besondere Schutzmassnahmen nahe. Diese ziehen in der Regel enorme Investitionen nach sich und gereichen den Landschaften und Siedlungen in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht selten zum Vorteil. Dass dem nicht so sein muss, möchte dieses Heft zeigen. An grösseren und kleineren Flüssen, die in den letzten Jahren vermehrt ausserordentliche Hochwasser geführt haben und auch in Zukunft bringen werden, sind in unterschiedlicher Weise bauliche Schutzvorkehrungen getroffen worden, die interessante architektonische Qualitäten aufweisen, etwa in Wörth am Main oder in Krems-Stein an der Donau. In Brezice (Slowenien) schlägt ein Projekt vor, aus der Not eine Tugend zu machen und ein vom Hochwasser bedrohtes Gebiet in eine naturnahe Freizeitlandschaft zu verwandeln. Schutzvorrichtungen sind generell gegen das Wasser gerichtet und versuchen, es auf- und abzuhalten. Es gibt auch eine andere Haltung: Im Freiluftbad Niederrad steht ein Kiosk – es sei denn, dass der Main steigt, dann schwimmt er nämlich. Und in Passau hat man sich darin geschickt, dass die Donau alle paar Jahre über die Ufer tritt. Entsprechend werden die Erdgeschosszonen des ufernahen Stadtteils nur temporär genutzt. Im Erdgeschoss des Hauptzollamts von 1851 werden bei Hochwasser grosse Tore geöffnet, damit das Wasser durchfliessen kann. Eine fatalistische Haltung oder Gelassenheit? So oder so, wir werden nicht darum herum kommen, mit künftigen Fluten zu leben. Die Redaktion