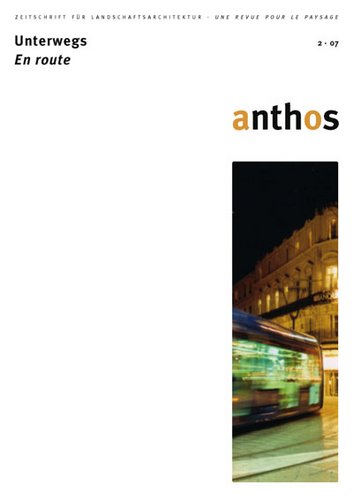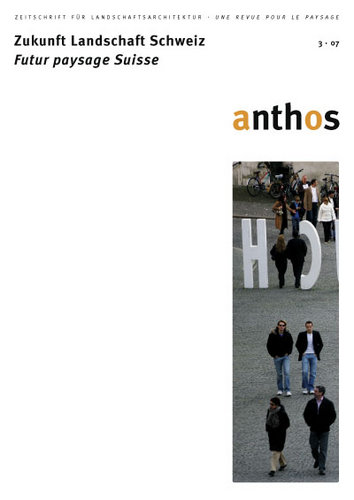Editorial
Neunzig Prozent der Schweizer Bevölkerung sind täglich mindestens einmal «unterwegs». Zu Fuss, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Vergnügen.
Knapp 50 Prozent aller Wegetappen entfallen dabei auf den Fuss- und Fahrradverkehr, beim Einkaufs- und Ausbildungsverkehr sind es sogar über 50 Prozent. Das ist gesund, Platz sparend, verträglich für Mensch und Umwelt, im verkehrsplanerischen Sinne leistungsfähig.
Doch wir fahren auch Auto, alle zusammen in der Schweiz täglich 130 Millionen Kilometer, das wären 3250-mal um die Erde. Im Jahr sind das 48 Milliarden Kilometer. Ein Mensch mit 80 Jahren hat in seinem Leben statistisch gesehen knapp zwei Jahre im Auto zugebracht, viele natürlich wesentlich mehr. Trotzdem stehen unsere Autos die meiste Zeit still, durchschnittlich 23 Stunden am Tag, eine Stunde fahren sie. Also salopp gesagt könnten wir auch von einem «Stehzeug» sprechen.
Für unsere Mobilität brauchen wir Infrastrukturen, die Schweiz investiert hierfür jährlich mehrere Milliarden Franken. Als Landschaftsarchitekten sind wir damit immer wieder gefordert, Gestaltungspotenziale im Zusammenhang mit Verkehrsanlagen zu erkennen, sie auszuschöpfen und dazu beizutragen, dass das «Unterwegssein» schön, angenehm, angstfrei und attraktiv ist. anthos 2/07 greift Projekte des Fuss-, Schienen- und Strassenverkehrs auf.
Der Fussverkehr stellt hohe Qualitätsanforderungen an die Linienführung und Gestaltung, was in einem Grundsatzartikel dargelegt wird. Wichtige Orte sind Umsteigepunkte, wie die Bahnhofsvorplätze, erläutert an den Beispielen Altstetten und Rüschlikon. Mit Überdeckungen von Bahneinschnitten (wie bei Genf) oder «Einhausungen» von Stadtautobahnen (München) können neue öffentliche Freiräume geschaffen werden. (Auch in Zürich-Schwamendingen wird sich hoffentlich bald diese Chance bieten.) Wahrnehmungsanalysen der Zugreisenden sollen zu linearen, translokalen Gestaltungen führen (Ruhrgebiet). Die landschaftliche Eingliederung von Strassen ist ebenso ein Thema wie Detailfragen zu Parkierung, Rastplätzen und Lärmschutz.
Ein spezielles Thema ist die Renaissance der Stadtbahnen in den europäischen Städten. Am konsequentesten und spektakulärsten geschieht dies wohl in Frankreich, wo mit neuen Tramstrecken gleichzeitig eine Stadtreparatur, die Neugestaltung des gesamten öffentlichen Raumes entlang der Bahntrassen angestrebt wird.
Dies ist wohl auch eine Kernaussage dieses Heftes: Die Sanierung oder Neuschaffung von Verkehrsanlagen ist nicht allein eine verkehrsplanerische Aufgabe, sondern sie eröffnet uns die Chance zu einer integralen landschaftlichen, städtebaulichen und freiraumplanerischen Um- oder Neugestaltung.
Bernd Schubert
Inhalt
Editorial
Klaus Zweibrücken
- Räume für Füsse, Kopf und Auge
Roland Raderschall
- Geschwindigkeit und Langsamkeit Bahnhofplatz Zürich Altstetten
Brigitte Nyffenegger
- Leitbild Zentrum Rüschlikon
Marie-Hélène Giraud
- Ein «Grüner Weg» über einer ehemaligen Eisenbahnlinie
Stephan Besier
- Die Renaissance des Trams in Frankreich
Stefanie Jühling, Otto A. Bertram und Petra Stautner
- Petuelpark München Stadtpark über dem Verkehr
Elizabeth Sikiaridi
- Wahrnehmung und Gestaltung translokaler Räume
Gaël Müller und Bertrand de Montmollin
- Die Autobahn am Nordufer des Neuenburgersees
Jean-Yves Le Baron
- Ein öffentlicher Raum als Balkon über dem Genfersee
Pascal Amphoux und Filippo Broggini
- Runninghami
Céline Orsingher
- Parkieren
Stephane Collet
- Das Bild des Autos
- Schlaglichter
- Mitteilungen der Hochschulen
- Wettbewerbe und Preise
- Agenda
- Literatur
- Markt
- Bezugsquellen Schweizer Natursteine
- Bezugsquellen Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Impressum
Räume für Füsse, Kopf und Auge
Fussverkehr ist in hohem Masse leistungsfähig, dabei verträglich für Mensch und Umwelt, und er braucht wenig Platz. Fussverkehrsanlagen sind wichtige Bestandteile belebter öffentlicher Räume.
Die Zufussgehenden setzen sich aus Gruppen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen. So reichen beispielsweise die Geschwindigkeiten des Fussverkehrs von zwei bis sieben Kilometer pro Stunde, je nach Benutzer (Junge, Alte) und Zweck des Weges (Arbeit, Freizeit). Mit sinkender Gehgeschwindigkeit steigt in der Regel die Aufnahmefähigkeit für die Gestaltung des Wegumfeldes. Planungen müssen sich daran messen lassen, wie weit und wie gut sie den unterschiedlichen gruppenspezifischen Bedürfnissen gerecht werden. Werden bei Planung und Bau die Bedürfnisse des Fussverkehrs beachtet und die Grundsätze der Fussverkehrsplanung gestalterisch gut umgesetzt, kann ein nachhaltiger Beitrag zur Förderung des öffentlichen Raumes resultieren.
Fussverkehr ist wichtig und belebt
In der Schweiz werden pro Person und Tag fast 90 Minuten unterwegs verbracht, rund 40 Prozent davon zu Fuss. Die Bedeutung des Fussverkehrs liegt nicht in grossen Kilometerleistungen, sondern im hohen Anteil an den Wegetappen, vor allem bei kurzen Wegen. Bei den Ausbildungswegen werden 56 Prozent der Wegetappen zu Fuss zurückgelegt; beim Einkaufen sind es 45 und beim Freizeitverkehr noch 42 Prozent. Bei Erhebungen in Strassen unterschiedlicher Verkehrsbedeutung wurden zum Beispiel in Zürcher Stadtquartieren Fussverkehrsanteile von bis zu 60 Prozent gemessen. Der Fussverkehr füllt den öffentlichen Raum mit Leben. Ohne Fussverkehr gäbe es keinen öffentlichen Verkehr und keine belebten Plätze.
Fussverkehr ist platzsparend und leistungsfähig
Der Raumbedarf des Fussverkehrs ist bescheiden. Wenn es sein muss, teilen sich bei hohen Fussgängerdichten mehr als drei Personen einen Quadratmeter Fläche. Fussverkehrsanlagen sind extrem leistungsfähig. Auf einer 3,5 Meter breiten Gehspur können pro Stunde 19 000 Fussgänger verkehren, auf einer gleich breiten Fahrspur aber nur 2000 Autos. Bei Planungsaufgaben in Geschäftsstrassen, Fussgängerzonen, Bahnhöfen oder auf den Zuwegen zu Grossveranstaltungseinrichtungen spielt die Leistungsfähigkeit von Fussverkehrsanlagen eine Rolle.
Fussverkehr ist anspruchsvoll
Zufussgehende sind die Benutzergruppe mit der höchsten Aufnahmefähigkeit für Gestaltungsmassnahmen im öffentlichen Raum. Bei der Gestaltung von Anlagen für den Fussverkehr spielen «weiche» Kriterien, wie zum Beispiel Schönheit, Anregung, Identifikation eine grosse Rolle. Attraktive Räume für den Fussverkehr sind «anziehende» öffentliche Räume. Defizite in dieser Hinsicht sind: zu wenig Platz; zu unattraktiv (zu viel Lärm, zu viele Störungen, schlecht gestaltet); keine direkte Führung (Umwege, Unterführungen); zu unsicher (subjektiv, objektiv).
Grundbedürfnisse des Fussverkehrs
Die Ansprüche des Fussverkehrs liegen sowohl in der Bewegung als auch im Aufenthalt im öffentlichen Raum. Die Grundbedürfnisse umfassen im Wesentlichen die drei Funktionen Gehen, Aufenthalt und Queren.
Gehen:
• direkte Wegeführung
• kleinteilige Netzverbindungen
• gute Orientierung und Überschaubarkeit
• ausreichend breite Gehbereiche
• störungsarmer Ablauf in Längsrichtung
• hohe Erlebnisqualität des Raumes.
Aufenthalt/Verweilen:
• erträgliche Umweltbelastungen
• Sitzmöglichkeiten
• Wetterschutz (Baumdach, Schatten)
• Störungsfreie Orte zum Verweilen
• Treffpunkte für unterschiedliche Nutzergruppen
• subjektive und objektive soziale Sicherheit.
Queren:
• linear oder punktuell sichere Querungsmöglichkeiten für alle Benutzergruppen
• keine oder kurze Wartezeiten
• Übersichtlichkeit des Strassenraumes
• kurze Querungswege.
Grundsätze zur Planung und Gestaltung
Anlagen für den Fussverkehr sollen deshalb:
• verkehrssicher sein
• möglichst störungsfrei verlaufen
• subjektiv und objektiv (sozial) sicher sein
• direkt und umwegfrei verlaufen
• ausreichenden Bewegungsraum (genügend Platz) bieten
• bequem nutzbar sein
• übersichtlich und begreifbar sein
• gute Orientierungsmöglichkeiten bieten
• Aufenthaltsqualitäten bieten und angenehmes Gehen ermöglichen
• an Verweilorten möglichst witterungsgeschützt sein.
Hohe Verkehrssicherheit:
In beidseits bebauten Strassen ist grundsätzlich ein linienhafter Querungsbedarf auf der ganzen Strassenlänge zu erwarten, der durch geeignete Massnahmen unterstützt werden sollte. Nur bei Strassen, die vom motorisierten Verkehr hoch belastet sind, kann es nötig werden, den Querungsbedarf zu bündeln und diesen baulich oder verkehrstechnisch zu sichern. Sicherheitsdefizite für den Fussverkehr beruhen zum grössten Teil auf den hohen Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs. Reduzierte Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr sind deshalb insbesondere an Strassen wichtig, die vom Fussverkehr stark frequentiert werden.
Minimierung der Widerstände:
Bewegungsbereiche sollen grundsätzlich von stationären oder temporären Hindernissen freigehalten werden. Wartezeiten an Lichtsignalanlagen sind so gering wie möglich zu halten. Bei gebündelten Strassenquerungen sind bauliche und verkehrstechnische Sicherungen angezeigt. Dabei sind Unter- bzw. Überführungen zu vermeiden.
Hohe soziale Sicherheit:
Fussverkehrsanlagen sollen sicher und angstfrei erlebbar sein. Bedeutsam für das Sicherheitsempfinden sind neben der Anwesenheit anderer Menschen auch Umfeldnutzungen, die soziale Kontrolle übernehmen können. Anlagen für den Fussverkehr sollen von anderen Nutzflächen aus gut einsehbar, übersichtlich und gut beleuchtet sein sowie tote Winkel und Nischen vermeiden.
Direkte Verbindungen:
Der Fussverkehr ist sehr umwegempfindlich; selbst kleinste Umwege werden oft nicht akzeptiert. Fussverkehrsanlagen müssen deshalb unbedingt direkt und umwegfrei geführt werden. Bei Strassen mit intensiver Umfeldnutzung (beispielsweise Geschäften) können zum Beispiel Querungsmöglichkeiten im gesamten Strassenverlauf erforderlich werden.
Angemessene Dimensionierung:
Die Breiten von Fussverkehrsanlagen ergeben sich aus dem Raumbedarf des Fussverkehrs und seinem dynamischen Gehverhalten. Zu beachten ist dabei, dass Fussgänger häufig nebeneinander gehen und Gegenstände mit sich tragen. Personen mit Kinderwagen, in Rollstühlen und bis zu einem bestimmten Alter auch Kinder mit Fahrrädern müssen ebenfalls ausreichend Platz haben. Über die Transportfunktion hinaus wird in vielen Bereichen auch die Aufenthaltsfunktion flächenwirksam.
Massstäbliche Gestaltung:
Für ein angenehmes Gehen und für den Aufenthalt soll der öffentliche Raum dem menschlichen Massstab entsprechend gestaltet sein und ein unverwechselbares, von regionalen und örtlichen Eigenarten geprägtes Erscheinungsbild aufweisen. Die erwünschte Massstäblichkeit kann durch die Verwendung geeigneter Belags- und Ausstattungsmaterialien und durch eine angemessene Höhe der Beleuchtungskörper unterstützt werden.
Behindertengerechte Planung:
Die Anforderungen der Personen mit Mobilitätseinschränkungen sind bei allen Anlagen des Fussverkehrs zu berücksichtigen. Diese Anforderungen differieren je nach Art der Mobilitätseinschränkung. Taktile Leiteinrichtungen, Rampen oder Aufstiegshilfen müssen in Aussenraumgestaltungen integriert werden. Bodenbeläge müssen rollstuhlgerecht sein; Abgrenzungen und Ränder sollen ertastbar sein.
[ Klaus Zweibrücken, Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung, Prof. für Verkehrsplanung, Hochschule für Technik Rapperswil, Fachbeirat Fussverkehr Schweiz ]anthos, Mo., 2007.06.11
Planungshilfen
Forschungsgesellschaft für das Strassen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Fussgängerverkehrsanlagen (EFA), Köln 2002
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW: Fussverkehr – eine Planungshilfe für die Praxis, Bausteine Nr. 24, Dortmund 2001
Forschungsgesellschaft für das Strassen- und Verkehrswesen: Empfehlungen zur Strassenraumgestaltung (ESG), Köln 1995
11. Juni 2007 Klaus Zweibrücken
Geschwindigkeit und Langsamkeit
(SUBTITLE) Bahnhofplatz Zürich Altstetten
Der alte Bahnhofplatz war in die Jahre gekommen. Als Werk der 1960er Jahre wollte er die Fahrgäste mit Rasenflächen und Rosenrabatten erfreuen. Mit dem zwischenzeitlich völlig veränderten Umfeld und den massiv erhöhten Benutzerfrequenzen wurde eine Neugestaltung des Platzes notwendig.
Zürich Altstetten hat in den 1980er und 90er Jahren, bis heute anhaltend, den Wandel von einer ruhigen dörflichen Vorortgemeinde zu einer dynamischen Wohn- und Bürostadt durchlaufen. Tausende neue Arbeitplätze sind in den vergangenen Jahren entstanden, unter anderem mit den Hauptsitzen internationaler Firmen wie zum Beispiel der IBM. Der verschlafene Vorortbahnhof ist zu einem der meistfrequentierten Bahnhöfe der Schweiz avanciert und war mit seiner lieblichen gärtnerischen Gestaltung eher zum Ärgernis und Störfaktor der täglichen Pendlerströme gediehen. In einem Studienverfahren suchte die Stadt Zürich demzufolge eine neue Konzeption für den Bahnhofplatz.
Ruhe und Bewegung
Der Altstetterplatz verfügt mit drei markanten Gebäuden über klare Begrenzungen, zur Hohlstrasse hingegen fehlte der räumliche Abschluss. Die notwendigen Buswartehallen entlang der Hohlstrasse wurden entsprechend neu entworfen und über das notwendige Mass hinweg so stark vergrössert und architektonisch markant ausformuliert, dass der Platz einen kräftigen, aber durchlässigen Abschluss gegen die Strasse erhielt. Das auf langen Schotten gelagerte Dach wird das Pendant zu den gegenüberliegenden Baumfeldern. Die Wartezone dient als Bushaltestelle und transitorischer Raumabschluss. In die tragenden Schotten integriert wurden die Werbe- und Informationselemente wie auch die Beleuchtung, und nicht zuletzt die Sitzbänke der Haltestelle.
Laufen und Warten sind die entgegengesetzten, aber prägenden Tätigkeiten eines Bahnhofplatzes, Stress und Langeweile die korrespondierenden Gemütszustände. Grosse Fussgängerströme queren den Platz wechselseitig und suchen sich den Weg zu Geleisen, Übergängen und Haltestellen. Diese Bewegungsräume frei zu belassen und die Orientierung zu verbessern, war ein Ziel des Entwurfs. Die neue, asphaltierte Platzfläche ist hindernisfrei gestaltet und bis auf eine, nur in den Randstunden verkehrende, Buslinie für Fahrzeuge gänzlich gesperrt. Die gesamte Parkierungsinfrastruktur, auch für Fahrräder, wurde in den seitlichen Lagen angeordnet, um den Platz auch wirklich frei zu spielen. Farbige Bodeneinbauleuchten in Reihe versetzt leiten den Fussgänger vom Bahnhof zu den Zebrastreifen, respektive umgekehrt. Die Farben Rot und Blau der Lampen verweisen dabei einerseits auf das Logo der SBB, andererseits erinnern sie an die Runways der Flughäfen, sind Metaphern des Reisens. Im Kontrast zu den leeren Bewegungsräumen wurden daneben Aufenthaltsorte geschaffen. Zahlreiche und differenzierte, an der jeweiligen Funktion orientierte Sitzgelegenheiten sowie ein Trinkbrunnen möblieren diese zwei Orte auf dem Platz. Eine mächtige alte und vier Platanen aus den 1960er Jahren wurden erhalten, in Kiesbeläge gesetzt und mit zahlreichen Sitzgelegenheiten versehen, die Warten und Aufenthalt im Schatten der grossen Bäume angenehm gestalten. Die Sitzmöbel sind die Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Produktes, das jedoch explizit für den «rauen» Gebrauch auf dem Bahnhofplatz abgeändert wurde. Die nebeneinander liegenden Zonen für das Warten und das Laufen sind somit auch durch «langsame» und «schnelle» Beläge, Kies und Asphalt thematisiert.
Kunst und künstliche Natur
Schon auf dem alten Bahnhofplatz stand die hohe farbige Eisenplastik des Künstlers Bernhard Luginbühl auf einem stufenartigen Sockel. In Absprache mit dem Künstler wurde die Plastik an einen anderen Standort verschoben und erhielt eine neue Bodenplatte. So steht die Plastik nun auf dem Belag, inmitten der Passantenströme, wo sie quasi selber zum Akteur wird.
Der Plastik gegenüber, im Schatten der grossen Platane, wurde ein Wasserfeld angeordnet. In dem langen Wasserbecken ruht eine übermannshohe Mauer aus in Steinkörben geschichteten Kalktuffsteinen. Diese Natursteinmauer wird einseitig permanent mit Wassertröpfchen besprüht. Dadurch entsteht einerseits ein akustisches Gegengewicht zum Verkehrslärm, andererseits entwickelt sich eine eigentümliche Vegetation aus Moosen, Farnen, Flechten. Mit unendlicher Langsamkeit entsteht ein archaischer, zeitloser, lebendiger Mikrokosmos inmitten der dem Verkehr und dem urbanen Alltag gewidmeten Platzfläche. Permanentes Gurgeln und Tropfen tönt aus dem Inneren des massiven Mauerwerks. Mystische Glühwürmchen leuchten in der Dunkelheit geheimnisvoll aus den Ritzen der Mauer.anthos, Mo., 2007.06.11
11. Juni 2007 Roland Raderschall
verknüpfte Bauwerke
Bahnhofplatz Zürich Altstetten