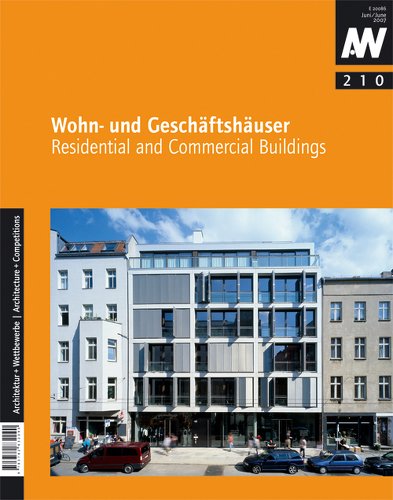Editorial
Unlängst wurden mehrere Studien und Umfrageergebnisse veröffentlicht, die belegen, dass sich in Deutschland seit ein paar Jahren ein deutlich erkennbarer Trend zur »Rückkehr in die Stadt« abzeichnet. Obwohl das frei stehende Einfamilienhaus als Idealvorstellung des Wohnens nach wie vor eine wichtige Rolle einnimmt, verliert diese Wohnform zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Menschen bevorzugen zum Wohnen die Innenstädte und zentrumsnahen Gebiete. Zahlreiche Gründe sind für die anhaltende Landflucht verantwortlich und rücken das Thema verstärkt in den Fokus der Kommunen und Bauträger: Durch die Streichung der Eigenheimzulage wird das Bauen auf der »grünen Wiese« nicht mehr gefördert. Die kontinuierlich steigenden Kraftstoffpreise und die reduzierte Entfernungspauschale machen es für Pendler immer teurer, von Ihrem Wohnort im Umland zum Arbeitsplatz in der Stadt zu gelangen, so dass sich viele von ihnen für einen Umzug entscheiden. Für junge Familien mit Kindern – den bislang »klassischen« Bewohnern des Umlands – bietet das »Heim im Grünen« mittlerweile längst nicht mehr so viele Vorteile, wie noch vor etlichen Jahren. Durch das Anlegen von offen strukturierten Siedlungen sowie Grünflächen auf stillgelegten Industriearealen sind viele Städte selbst inzwischen lebenswerter geworden. Auch auf die attraktivere Infrastruktur der Städte mit ihrer Vielzahl von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, ihrem breit gefächerten kulturellen Angebot sowie den guten Einkaufsmöglichkeiten können und möchten viele Familien mittlerweile genauso wenig verzichten, wie die immer größer werdende Zahl von Alleinerziehenden, Singles und kinderlosen Paaren. Und noch eine weitere, stark anwachsende Bevölkerungsschicht, die sich zunehmend gegen ein Leben in der Vorstadt oder gar auf dem Land entscheidet, bringt der demographische Wandel mit sich: Die so genannten »Woopies« (well-off older people) – finanziell abgesicherte und damit kaufkräftige Senioren. Bereits jetzt bevorzugt jeder dritte Deutsche über 50 die attraktive Infrastruktur und bessere medizinische Versorgungsmöglichkeit in den Städten. Bis 2020 soll die Zahl dieser Deutschen um zehn Millionen wachsen – weshalb sie auch als Vorreiter des Trends »Wohnen im Zentrum« angesehen werden. Das Thema hat mittlerweile eine Bedeutung auf dem Immobilienmarkt erreicht, wie man sie sich noch vor einigen Jahren in dieser Größenordnung nicht hätte vorstellen können. Immer mehr Städte und Gemeinden begreifen die Stärkung des innerörtlichen Wohnens als einen Schwerpunkt ihrer zukünftigen Stadtplanung. Die Differenzierung der Wohnungsnachfrage erfordert jedoch auch eine entsprechende Differenzierung des innerstädtischen Wohnungsangebots. Ein vergleichsweise klassischer Bautyp ist dabei der eines «Wohn- und Geschäftshauses«. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine Auswahl an realisierten Bauten, Projekten und Wettbewerbsergebnissen vor, die sich durch ihre gelungenen Umgang mit Themen wie Flexibilität, Belichtung und Einfügen in den Bestand auszeichnen. Es handelt sich um Beispiele unterschiedlicher Größe und Nutzungsvorgaben, nur eines haben sie gemeinsam – sie sind garantiert keine »Stangenware«. Arne Barth