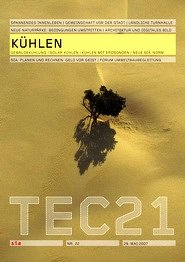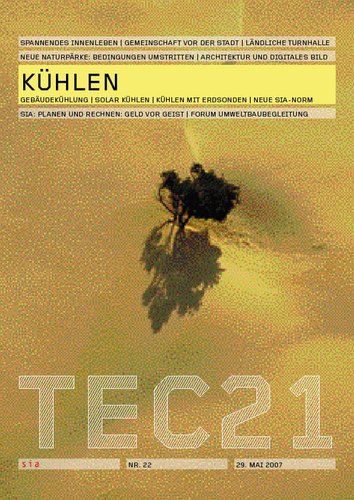Editorial
Editorial
Der aussergewöhnlich warme April schuf beste Voraussetzungen, um über einem Heft zum Thema «Kühlen» zu brüten: Die grosszügig verglasten Büros der TEC21-Redaktion werden an warmen Tagen spätestens ab Mittag unangenehm heiss und wecken den Wunsch nach einer effi zienteren Beschattung oder einer Klimaanlage. Mit diesem Wunsch sind wir nicht allein. Die weltweite Nachfrage nach Kälte zur Gebäudeklimatisierung steigt rasant. Die internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit einer jährlichen Zunahme von gekühlten Gebäuden um 12.7%. Verantwortlich dafür sind unter anderem steigende Komfortansprüche, höhere interne und externe thermische Lasten und der Trend zu transparenten Fassaden. In ihrem Forschungsprojekt «Bauen, wenn es wärmer wird» untersuchen Urs Steinemann und Conrad U. Brunner, wie sich diese Entwicklung im sommerlichen Elektrizitätsbedarf widerspiegelt. Jahrzehntelang waren kalte Winter der Engpass für die Elektrizitätsversorgung in der Schweiz. In den letzten Jahren weisen jedoch die Sommermonate die höchsten Zuwachsraten beim Verbrauch an elektrischer Energie auf. Durch die Klimaerwärmung wird dieser Trend beschleunigt. Das Forschungsprojekt zeigt, dass sich diese Zunahme mit angepassten Baustandards vermeiden oder zumindest reduzieren lässt, ohne dass Abstriche bei der thermischen Behaglichkeit gemacht werden müssen. Dazu gehören Lüftungs- und Klimaanlagen, die möglichst energieeffizient Raumkonditionen schaffen, die behaglich sind und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Bauwerk verhindern. Die entsprechenden technischen Vorgaben sind in der neuen Norm SIA 382/1 enthalten, die in diesen Tagen erscheint und von Urs Steinemann in einem weiteren Artikel vorgestellt wird. Interessant werden könnten in Zukunft Kühlsysteme, die erneuerbare Energien nutzen.
Eine Alternative zu klassischen thtemaschinen ist die solare Kühlung, um die es im Artikel von Othmar Humm geht. Vorteilhaft ist, dass der Kühlbedarf der Gebäude im Tages- und Jahresverlauf dann am grössten ist, wenn auch die Sonnenkollektoren am meisten Energie liefern. Der Artikel stellt die Technologien für die solarthermische Kälteproduktion sowie einige Schweizer Pilotprojekte vor und erläutert das Potenzial für solche Anlagen. Eine andere Variante ist, die Kälte zur Gebäudekühlung aus dem Erdreich zu beziehen, zum Beispiel mittels Erdwärmesonden. Ralf Dott, Thomas Afjei und Arthur Huber untersuchten im Rahmen eines Forschungsprojektes, wie sich Aufwand und Nutzen verhalten, wenn eine Wärmepumpenanlage mit Erdwärmesonde nicht nur zum Heizen und zur Warmwasserproduktion, sondern auch zur Gebäudekühlung eingesetzt wird.
Inhalt
WETTBEWERBE
Spannendes Innenleben / Gemeinschaft vor der Stadt / Eine ländliche Turnhalle
MAGAZIN
neue Naturpärke: Bedingungen umstritten / Architektur und das digitale Bild
GEBÄUDEKÜHLUNG IN DER ZUKUNFT
Urs Steinemann, Conrad U. Brunner
Durch die Klimaerwärmung wird der Kühlbedarf in Gebäuden zunehmen. Mit angepassten Baustandards kann eine Zunahme des Stromverbrauchs aber vermieden werden.
MIT WÄRME KÄLTE PRODUZIEREN
Othmar Humm
Bislang sind nur wenige solarthermische Kälteanlagen installiert. Doch das Potenzial für diese Art des solaren Kühlens ist immens.
KÜHLEN MIT ERDSONDEN
Ralf Dott, Thomas Afjei, Arthur Huber
Wärmepumpen mit Erdwärmesonden eignen sich auch zur Gebäudekühlung. Ein Forschungsprojekt untersuchte Nutzen und Aufwand.
NEUE NORM LÜFTUNGS- UND KLIMAANLAGEN
Urs Steinemann
Mit den Vorgaben in der neuen Norm SIA 382/1 schaffen Lüftungsund Klimaanlagen behagliche Raumkonditionen bei mässigem Energieverbrauch.
SIA
Planen und rechnen: Geld vor Geist / Forum Umweltbaubegleitung / Hans-Gerhard Dauner verstorben / Qualifi kation Stahlbau
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Gebäudekühlung in der Zukunft
Während der Lebensdauer heute erstellter Gebäude wird das Klima deutlich wärmer werden. Im Forschungsprojekt «Bauen, wenn das Klima wärmer wird» wird untersucht, welche Zunahme der mechanisch belüfteten und gekühlten Gebäudefläche dadurch zu erwarten ist und mit welchen Massnahmen ein Anstieg des Elektrizitätsverbrauchs vermindert oder vermieden werden kann.
Der Uno-Weltklimarat IPCC kam in seinen kürzlich veröffentlichten Berichten1 zu einem klaren Schluss: Die vom Menschen verursachte Freisetzung von Treibhausgasen ist hauptverantwortlich für die Klimaerwärmung. Im Moment sind wir in unseren Breitengraden bei einer Zunahme der Jahresmitteltemperatur von etwa 0.2 K pro 10 Jahren, Tendenz steigend. Ohne drastische Gegenmassnahmen müssen wir uns also darauf vorbereiten, dass die Tendenz der Erwärmung anhält. Notwendig sind daher gleichzeitige Anstrengungen zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen, zur Schadensminderung und zur Anpassung an die neue Klimasituation.
Die Klimaerwärmung hat teilweise auch positive Effekte. Betrachtet man beispielsweise den Energiebedarf von Gebäuden, so führt die Klimaerwärmung hierzulande im Winter zu einem geringeren Raumwärmeverbrauch. Die Erwärmung gibt uns heute allerdings noch nicht die Möglichkeit, geringere Auslegetemperaturen für die Heizung zu wählen, weil ihre Volatilität zu hoch und Extremereignisse häufiger geworden sind.
Höherer Strombedarf im Sommer
Dagegen werden im Sommer künftig viele Gebäude häufiger und länger unangenehm hohe Innentemperaturen aufweisen. Dabei werden sich bei vielen Gebäuden starke thermische Komfortmängel zeigen, die einige Gebäude zeitweise gar unbenutzbar machen. Anderseits werden wärmere Sommer eine Welle der Nachrüstung mit Raumklimageräten auslösen, die im Bürobereich und neu auch im Haushaltbereich grosse Märkte erschliessen wird. Im Bürobereich werden vorhandene Lüftungsanlagen schrittweise zu Teilkühl- und Klimaanlagen aufgerüstet. Dadurch wird der Elektrizitätsbedarf für den Raumklimabereich im Sommer merklich steigen.
Spitzenlastsituationen werden dann im Hochsommer und nicht mehr nur im Winter auftreten. Dieser sommerliche Mehrverbrauch wurde hierzulande lange als problemlos eingeschätzt, weil wir sozusagen im Wasserstrom schwimmen und diesen im Sommer zu schlechten Preisen exportieren müssen. Inzwischen werden an den Strombörsen in Europa und auch in der Schweiz mitunter die stärksten Preisausschläge für Elektrizität im Sommer verzeichnet. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf Versorgungsengpässe bei der Produktion und in der Verteilung.
Entwicklung der gekühlten Gebäudeflächen
Das vom Bundesamt für Energie und weiteren Stellen unterstützte Forschungsprojekt «Bauen, wenn das Klima wärmer wird» hat zum Ziel, die erwartete Zunahme des Elektrizitätsverbrauchs in den Sommermonaten zu quantifizieren und aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen diese Entwicklung vermindert oder vermieden werden kann. Um den zusätzlichen Elektrizitätsbedarf im Sommer abschätzen zu können, wurden in einem ersten Schritt die Entwicklung des Gebäudebestandes und dessen Technisierung betrachtet. Die Entwicklung der Gebäudeflächen von 1990 bis 2035 im Bereich Wohnen, Dienstleistungen und Industrie wurde im Rahmen der schweizerischen Energieperspektiven 2000 bis 2035 untersucht3. Sie geht von einer Nettozunahme (d. h. Zubau minus Abbruch und Zweckentfremdung) der Energiebezugsfläche (EBF) von 0.8 % p.a. aus.
Über den Anteil der Gebäudeflächen mit mechanischer Lüftung und mit Kühlung liegen keine gesicherten Grundlagen vor. Im beschriebenen Forschungsprojekt wurde mit zwei verschiedenen Szenarien gerechnet. Im Szenario «Basisentwicklung» (ohne Klimaerwärmung) wird bei den Wohn- und Büronutzungen die relative Bedeutung der drei Technisierungsstufen bei der Gebäudetechnik (natürlich belüftet, mechanisch belüftet ohne Kühlung bzw. mit Kühlung) gemäss Bild 2 angenommen. Ein zweites Szenario «Entwicklung mit warmen Sommern» (mit Klimaerwärmung) nimmt ab dem Jahr 2000 eine zusätzliche Zunahme der mechanisch belüfteten und gekühlten Gebäudeflächen an (Bild 3).
Elektrizitätsverbrauch im Sommer
Jahrzehntelang war die Engpassleistung der Elektrizitätsversorgung in der Schweiz und in Europa insgesamt auf tiefe winterliche Aussentemperaturen konzentriert, weil elektrische Heizungsanlagen den Spitzenbedarf verursachten. Betrachet man die Veränderung des monatlichen Stromverbrauchs im Jahr 2003 verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2004 (Bild 4), so zeigt sich hier eine neue Entwicklung, bei der die Sommermonate Juni ( 11.6 %), Juli ( 12.3 %) und August ( 11.2 %) die höchsten Zuwachsraten aufweisen.
Ein weiteres Indiz für die Zunahme des sommerlichen Kühlbedarfs liefert die Korrelation der Monatsverbrauchswerte für Elektrizität der vier Jahre 2000 bis 2003 in der Stadt Zürich. Bei Monatsmitteltemperaturen über 17 °C nimmt der monatliche elektrische Energieverbrauch um ca. 2.6GWh / K zu (Bild 5). Diese markante Zunahme kann durch verschiedene sommerliche Tätigkeiten (u. a. zusätzlicher gewerblicher Kältebedarf und Raumkälte) erklärt werden.
Im Rahmen der Energieperspektiven des Bundesamtes für Energie sind summarische Ab-schätzungen für den zusätzlichen elektrischen Energiebedarf für Raumkälte im Haushalt- und im Dienstleistungssektor bis 2035 gemacht worden.6 Danach bewirkt die Klimaerwärmung angeblich einen bis zu 4 % höheren Stromverbrauch sowohl im Referenzszenario I «Weiter wie bisher» (2.9 TWh / a) als auch im Szenario IV «2000-Watt-Gesellschaft» (1.9 TWh / a). Da die Grundlagen für diese Berechnungen ungenau sind, ist dieser Wert wohl zu hoch. Die Entwicklung der Gebäudeflächen basiert auf der gleichen Berechnungsgrundlage. Die Entwicklung der Stufen der Technisierung und die Möglichkeiten der technischen Anpassungen auf der Gebäude- und Haustechnikseite wurden dabei aber nicht weiter untersucht.
Entwicklungsszenarien
Im Forschungsprojekt werden die folgenden Entwicklungsszenarien betrachtet:
– Gebäudebestand: Entwicklung wie oben beschrieben
– Technisierung: Szenario 1 «Basisentwicklung» gemäss Bild 2 und Szenario 2 «Entwicklung mit warmen Sommern» gemäss Bild 3.
– Energieeffizienz: Szenario 1 «Status quo» und Szenario 2 «Anwendung von energieeffizienten Lösungen für die mechanische Belüftung und Kühlung».
Die heutige Situation wird anhand des Zustandes im Jahr 2005 beschrieben. Die Berechnung des sommerlichen Energiebedarfs erfolgt für das Jahr 2035 mit den oben beschriebenen Szenarien. Auf der Basis der Angaben in der neuen Norm SIA 382 / 17 (siehe Artikel Seite 28) werden für die Abschätzung des elektrischen Energiebedarfs die Kennwerte nach den Tabellen 6 und 7 verwendet.
Beurteilung und Massnahmen
Da das Forschungsprojekt noch nicht abgeschlossen ist, liegen vorerst nur qualitative Ergebnisse vor. Die detaillierten Resultate werden Anfang 2008 als SIA-Dokumentation publiziert. Unabhängig von der Klimaerwärmung wird in den nächsten Jahren die mechanisch belüftete und gekühlte Gebäudefläche in der Schweiz zunehmen aufgrund der Vergrösserung der spezifischen Gebäudeflächen, der Bevölkerungszunahme und der allgemeinen Zunahme der Komfortansprüche. Durch die Klimaerwärmung wird diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Ohne kompensatorische Massnahmen ist damit eine deutliche Zunahme des Elektrizitätsverbrauchs vor allem in den Sommermonaten verbunden.
Die Untersuchungen im Forschungsprojekt «Bauen, wenn das Klima wärmer wird» zeigen aber, dass mit heute zur Verfügung stehenden energieeffizienten Techniken eine Zunahme des Elektrizitätsverbrauchs für die Lüftung und die Kühlung vermindert oder sogar vermieden werden kann. Im Vordergrund stehen die folgenden Massnahmen:
– Besserer Schutz vor äusseren Wärmelasten durch einen guten beweglichen äusseren Sonnenschutz mit mindestens fassadenweiser Steuerung
– Gebäude mit tiefen Grundrissen der Haupträume (> 6 m) und nicht übermässiger Fensterfläche (< 0.3 Af / EBF) können wesentlich besser gegen hohe sommerliche Aussentemperaturen geschützt werden.
– Reduktion der inneren Wärmequellen durch die Verwendung von energieeffizienten Geräten und Beleuchtungsanlagen inkl. bedarfsgerechten Betriebs und Vermeidung von Stand-by-Verlusten.
– Energieeffiziente Luftförderung durch die Verwendung angepasster Luftvolumenströme, kleine Druckdifferenzen (kleine Luftgeschwindigkeiten, kurze Kanalnetze etc.), gute Wirkungsgrade der Kältemaschinen und der Luftförderung sowie bedarfsgerechten Betrieb.
Die entsprechenden technischen Vorgaben sind in der neuen SIA 382 / 1, Ausgabe 2007, enthalten7.
Die Klimaerwärmung ist unvermeidlich, die Zunahme des elektrischen Energieverbrauches für Raumkühlung in der Schweiz aber nicht. Angepasste Baustandards können die Zunahme auf null reduzieren und garantieren trotzdem die thermische Behaglichkeit der Benützerschaft.TEC21, Di., 2007.05.29
29. Mai 2007 Conrad U. Brunner, Urs Steinemann
Mit Wärme Kälte produzieren
Bei solarthermischen Kälteanlagen treibt Solarwärme einen Absorptions- oder Adsorptionsprozess an. Neben Wärme fällt dabei Kälte an. Bislang sind in der Schweiz und in Europa nur wenige Anlagen installiert, doch das Potenzial für diese Art des solaren Kühlens ist immens.
Auf 12.7% schätzt die Internationale Energie-Agentur IEA die jährliche Zunahme der Kälteproduktion zur Gebäudeklimatisierung. Die immense Steigerung ist allerdings weniger auf die Temperaturveränderung aufgrund des Klimawandels als auf die gestiegenen Komfortansprüche, den Trend zu hohen Glasanteilen in Fassaden und die Bautätigkeit in warmen Regionen zurückzuführen. Für die konventionelle Kälteerzeugung mit elektrischen Kompressoren bedingt dieser Zuwachs entsprechende Infrastrukturen, insbesondere von Kraftwerken und Verteilnetzen. Bei der solaren Kühlung von Bauten und Anlagen dagegen stammt die Antriebsenergie für die Kältemaschinen aus Sonnenkollektoren. Als Vorteil erweist sich, dass der Kältebedarf der Gebäude und die Spitzenwärmeproduktion der Kollektoren weitgehend korrelieren − sowohl im Jahres- als auch im Tagesgang. Zudem lassen sich die Kollektoren während der Heizperiode zur Raumwärmeproduktion nutzen.
Zwei Technologien
Bei der solarthermischen Kälteproduktion sind zwei Technologien zu unterscheiden: Absorption und Adsorption. Der Absorptionsprozess kommt rund um den Globus millionenfach in Kleinkühlschränken, vorab in Hotels und Campingfahrzeugen, zum Einsatz. Im Hotelzimmer ist der lautlose Betrieb das Kriterium (die Maschine läuft ohne Kompressoren), im Camper der Mangel an elektrischer Leistung. Denn Absorptionsmaschinen lassen sich mit thermischer Energie − zum Beispiel aus Gasflaschen oder Sonnenkollektoren − antreiben. Noch besser für die solare Kühlung eignet sich die Adsorption, weil dieser Prozess mit tieferen Antriebstemperaturen arbeitet. Ob Adsorption oder Absorption, Kältemaschine und Kollektoranlage bilden sozusagen eine Schaukel: Bei hohen Temperaturen des Antriebsmediums bringt die Kältemaschine eine hohe Leistungszahl, die Kollektoren dagegen ernten nur mit vermindertem Wirkungsgrad. Bei tiefen Temperaturen ist es umgekehrt. Wichtig ist deshalb die geschickte Einbindung der Komponenten in das Gesamtsystem «solare Kühlung» und dessen Optimierung.
Drei Kollektorarten
Die Optimierung fängt allerdings schon bei der Wahl der Komponenten an. Denn die Kollektortypen arbeiten in unterschiedlichen Temperaturbereichen. Flachkollektoren liefern Wärme bis ungefähr 90 °C, Röhrenkollektoren bis 130 °C, und Systeme mit Parabolreflektoren erzeugen Temperaturen von einigen hundert Grad. Noch stärker als die Temperaturen steigen allerdings die spezifischen Investitionskosten zur Erzeugung von Solarwärme. Dies ist mit ein Grund, weshalb in unseren Breitengraden Kühlsysteme in Kombination mit Flachkollektoren häufig entscheidende Kostenvorteile aufweisen.
Vier Anlagen in der Schweiz
Auf dem Weingut Schloss Salenegg im Bündner Rheintal erzeugen schon seit Jahren 70 m² Flachkollektoren Wärme für Heizung und Warmwasser. Ausserhalb der Heizperiode fällt Überschusswärme an, die früher nicht verwertet wurde. In diesen sommerlichen Zeiten besteht auf dem Gut ein Kühlbedarf für die Weinproduktion, der seit 2006 über eine Absorptionskältemaschine gedeckt wird (Bild 2). Bei einem Wärmeeintrag von 21kW bei 75 °C und einer Kühlleistung von 15kW bei 11 °C soll die Maschine eine Leistungszahl von 0.7 ausweisen. Für die vom Bundesamt für Energie unterstützte Pilotanlage in Salenegg ist eine mehrjährige Messkampagne vorgesehen; zurzeit sind noch keine Daten verfügbar.[1,2]
Nach dem gleichen Prinzip arbeitet die Kältemaschine am SPF Institut für Solartechnik an der Hochschule für Technik Rapperswil. Die Kühlleistung beträgt 10kW, die Kollektorfläche misst 30 m², und die Leistungszahl liegt zwischen 0.6 und 0.8. Die Rapperswiler Testanlage arbeitet mit Flachkollektoren im Temperaturbereich von 55°C bis 95°C. Die Forscher setzen für die Optimierung weite Systemgrenzen: Da zwischen stärkster Solarstrahlung und höchstem Kühlbedarf aufgrund der Gebäudemasse eine zeitliche Verschiebung von drei bis vier Stunden wirksam ist, liefert eine konsequente Orientierung der Kollektoren nach Südwesten eine bessere Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage. Der in Rapperswil installierte Pufferspeicher mit einem Inhalt von 1500l Wasser stellt Antriebsenergie für die Kältemaschine nach Sonnenuntergang zur Verfügung.[3] Weitere Anlagen sind in Gebäuden des Migros Genossenschaftsbundes am Limmatplatz in Zürich und der Berner Kantonalbank in Thun installiert. [4]
Wertigkeit der Energie
Die Leistungszahl, in der Literatur häufig als Wärmeverhältnis bezeichnet, ist der Quotient aus Kälteproduktion und Wärmeeintrag und naturgemäss von der Antriebs- und der Kühltemperatur abhängig. Bei einstufigen Absorptionsmaschinen liegen die Leistungszahlen üblicherweise zwischen 0.6 und 0.7. Bei zweistufigen Geräten sind Werte zwischen 1.1 und 1.4 möglich, weil die Wärme nach der ersten Stufe − mit tieferer Temperatur − wieder in den Prozess zurückgeführt wird.[5] Neben den beiden Parametern Antriebs- und Kühltemperatur beeinflusst die Temperatur der Wärmeabfuhr aus dem Absorber die Effizienz der Maschine erheblich. Dies zeigt ein Vergleich an der Maschine im Schlossgut Salenegg: Bei sonst gleichen Verhältnissen steigt die Leistung um rund 30 % und die Leistungszahl von 0.54 auf 0.69, wenn sich die Temperatur der Wärmeabfuhr von 33 °C auf 30 °C verringert.2 Für Planer von solaren Kühlanlagen ist deshalb die Dimensionierung und Ausrüstung der Kühltürme für die Wärmeabfuhr sehr wichtig. In der Regel werden die Kühleinrichtungen mit Wasser berieselt, um den Kühleffekt der Verdunstung zu nutzen.
Der Markt
Kälte wird überwiegend mit elektrischen Kompressoren produziert. Ein japanischer Branchenverband gibt für das Jahr 2006 einen weltweiten Absatz von 63Mio. Kühlgeräten an, für Europa von 5.4Mio. Im Jahr 2008 sollen es bereits 69Mio. respektive 6.1Mio. Geräte sein.[6] In Europa ist die Marktdurchdringung von Kältemaschinen im Wohnungsbau mit 2 % vergleichsweise gering. In Japan sind 70 % und in den USA 55 % der Wohnungen mit Kältemaschinen ausgerüstet. Das dürfte sich bald ändern. Schon heute steigen die Installationsraten im südlichen Europa sehr stark an.6 Absorptionsmaschinen bilden einen verschwindend kleinen Anteil und kommen fast ausschlieslich in industriellen und gewerblichen Prozessen zur Nutzung von kostengünstiger Abwärme zum Einsatz. Solarthermische Kälteanlagen schliesslich sind äusserst selten, in der Schweiz sind vier Anlagen installiert.
Aufgrund der hohen Anlagekosten produzieren solarthermische Kälteanlagen keineswegs günstig; in der Regel ergeben sich hohe spezifische Wärmekosten. Anders sieht die Rechnung aus, wenn sich eine Kollektoranlage über die Wärmeproduktion für Heizung und Wassererwärmung amortisiert und Überschusswärme im Sommer quasi gratis anfällt. Solarthermische Kälteanlagen stehen zudem − auch unter ökologischen Gesichtspunkten − in Konkurrenz mit solarelektrischen Anlagen. Zwar sind die spezifischen Investitionskosten in die Fotovoltaikanlage deutlich höher im Vergleich zu Kollektoranlagen, aber die elektrische Kältemaschine ist kostengünstiger bei gleichzeitig besserer Leistungszahl.TEC21, Di., 2007.05.29
Anmerkungen:
[1] Ökozentrum Langenbruck, Bernd Sitzmann, Langenbruck
[2] EAW Energieanlagenbau, Westenfeld
[3] Hochschule für Technik Rapperswil, Institut für Solartechnik, Rapperswil
[4] Bundesamt für Energie, Bereich Solarenergie
[5] Recknagel: Heizung- + Klimatechnik. München 2006.
[6] Jakob Ulli und Ursula Eicker: Solare Kühlung in Gebäuden. Energietag Rheinland-Pfalz. Bingen, September 2006.
29. Mai 2007