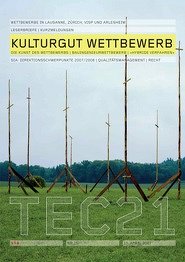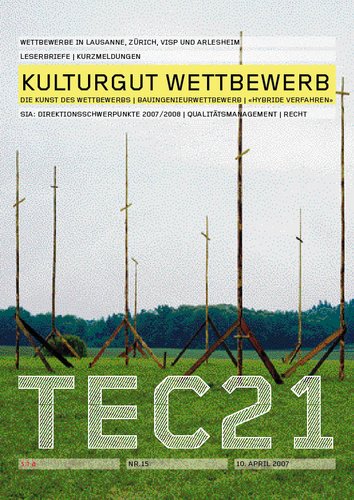Editorial
Editorial
Die Geschichte der Architektur- und Ingenieurwettbewerbe ist bislang kaum dokumentiert und wissenschaftlich erforscht. Die jährlich über 200 in der Schweiz durchgeführten klassischen Wettbewerbe lassen ein enormes Material und Wissen über Bauprojekte entstehen, das jedoch nur schwer zugänglich ist. Dies will die neu gegründete Stiftung des SIA «Forschung Planungswettbewerbe» mit einer Datenbank und Forschungsprojekten rund um das Thema Planungswettbewerbe ändern und für die Zukunft nutzen. Die Analysen und Aufarbeitungen der Wettbewerbe und ihrer Verfahren können so langfristig Einfluss auf die aktuelle Wettbewerbsgestaltung nehmen.
Systematische Auswertungen ermöglichen zum einen den inhaltlichen Vergleich von Wettbewerben über einen längeren Zeitraum. Daraus lassen sich Tendenzen ablesen, die zeitgebunden sind oder von der wirtschaftlichen Konjunktur abhängen bzw. den immer komplexer werdenden Wettbewerbsvorgaben gerecht zu werden versuchen.
Zum anderen aber geht es bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung auch um das Wissen über die Verfahren selbst: Welche Modalitäten der Durchführung haben in welchem Fall zu welchem Resultat geführt? Welche Kosten sind dabei den Organisatoren und den Teilnehmenden entstanden? Wo liegen Stolpersteine, und welche Tendenzen in der Rechtsprechung sind erkennbar? Aus diesen Recherchen müssen veränderte Bedürfnisse und Entwicklungstendenzen erkannt und die Modalitäten der Planungswettbewerbe angepasst werden, wie es auch Fritz Schumacher in seinem Gespräch über die «hybriden Verfahren» in diesem Heft fordert.
Dass Wettbewerbsprojekte auch verschiedene städtebauliche Szenarien veranschaulichen und es erlauben, ein Bauprojekt und seinen Kontext im Variantenvergleich beurteilen zu können, erläutert Andreas Tönnesmann anhand historisch relevanter Bauten. Deswegen können die Lösungsfindungen der Wettbewerbe als eigentliche angewandte Forschung im Bauen gelten. Wie der Bauingenieur daran Teil haben kann und in Zusammenarbeit mit dem Architekten die besten Ergebnisse erzielt, wenn er frühzeitig in den Wettbewerb einbezogen wird, zeigt Jürg Conzett anhand von vier Beispielen. Viele offene Fragen und Themen in Zusammenhang mit Wettbwerben werden auch in Zukunft in TEC21 diskutiert werden: Hierzu gehört z.B. die Frage, ob und welchen wirtschaftlichen Nutzen Wettbewerbe bei der Erstellung eines Projektes haben können. Eine deutsche Studie, die Ernst Karsten Kümmerle am Gründungssymposium zu diesem Thema vorstellte, kommt in einem späteren Heft zur Sprache.
Unbestritten sind die volkswirtschaftliche Relevanz der Wettbewerbsanalysen und -vergleiche sowie ihr hoher beruflicher Nutzen und die Forschungsarbeit. Das gesammelte
und ausgewertete Wissen für die Gestaltung unseres Lebensraumes einzusetzen ist das erklärte Ziel der Stiftung des SIA. Erfreulicherweise beteiligen sich zu diesem Zweck neben der Verlags-AG alle namhaften Lehrinstitutionen und Behörden an der Stiftung und unterstützen mit ihrem Wissen und Engagement die Forschung am Planungswettbewerb.
Lilian Pfaff
Inhalt
WETTBEWERBE
Neue Ausschreibungen / Lausanne: weder Spital noch Heim / Zürich: Bäume für den Vulkanplatz / Visp: abgespeckt / Arlesheim: dichte Massstäblichkeit
MAGAZIN
Leserbriefe / Kurzmeldungen
DIE SCHÖNE KUNST DES WETTBEWERBS
Andreas Tönnesmann
Architekturwettbewerbe, die in die Geschichte eingingen, weil sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Architektur leisteten, machen deutlich, wie wichtig die Archivierung der Wettbewerbe ist.
BAUINGENIEURWETTBEWERB IM HOCHBAU
Jürg Conzett
Der Autor plädiert für den Bauingenieurwettbewerb im Hochbau und zeigt anhand von vier Beispielen, wie der zwischen Team-Wettbewerb und Submissionsverfahren mit Konzepteingabe angesiedelte Wettbewerb aussehen kann.
«HYBRIDE VERFAHREN»
Interview mit Fritz Schumacher
Der klassische Projektwettbewerb wird heute durch diverse Kombinationsverfahren abgelöst. Welche dieser Verfahren sich für welche Aufgaben eignen, erläutert der Kantonsbaumeister von Basel-Stadt im Gespräch.
SIA
Direktion: Schwerpunkte für 2007/2008 / Qualitätsmanagement als Daueraufgabe / Recht: Meteorwasser im Kellergeschoss
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Die schöne Kunst des Wettbewerbs
Nicht alle Architekturwettbewerbe kommen so breitspurig daher wie der für das Verlags- und Redaktionsgebäude der «Chicago Tribune» im Jahr 1922. Hunderttausend Dollar hatte man in spektakulärem Fettdruck als Preissumme jener Entwurfskonkurrenz ausgesetzt, die sich die nach eigenem Bekunden «grösste Zeitung der Welt» zu ihrem 75. Geburtstag schenkte. Nicht nur wollte man der Belegschaft komfortable Arbeitsplätze und ein «Monument dauerhafter Schönheit» bescheren, obendrein sollte der Bau auch noch späteren Generationen von Zeitungsverlegern als leuchtendes Beispiel vor Augen stehen.
Auch wenn der «Chicago Tribune»-Wettbewerb (Bild2) in erster Linie ein Werbegag war – in die Architekturgeschichte ist er trotzdem eingegangen. Schon weil Koryphäen der europäischen Moderne wie Walter Gropius und Adolf Loos sich daran beteiligt haben. Sie blieben damals zwar erfolglos, aber ihre Entwürfe haben überdauert. Es ist unbestreitbar: Wettbewerbe sind das Salz in der Suppe der Architektur. Sie machen die Bahn frei für den Vergleich, lassen Ideen und Konzepte gegeneinander antreten. Oft genug haben sie ein subversives Potenzial, bringen einen Hauch von Demokratie in das meist so autoritäre Geschäft der Architektur. Sie zwingen zur Entscheidung. Und sind doch seit 600 Jahren viel mehr als das, nämlich ein Instrument zu architektonischer Erkenntnis – vielleicht das präziseste, über das wir nach wie vor verfügen.
Schon zu Beginn der Neuzeit wird das offenbar. War es doch ein Wettbewerb, der einem berühmten Aussenseiter sein Entree ins Baumetier verschaffte: Filippo Brunelleschi, der die Domkuppel von Florenz ersann. Mass und Umriss des monumentalen Gewölbes hatten zwar schon die Kathedralbaumeister des 14. Jahrhunderts in groben Zügen festgelegt. Einen gangbaren Weg zur Ausführung konnte aber erst der öffentliche Wettbewerb aufzeigen, den die Dombaukommission im Jahr 1418 ausschrieb. Scheinbar unlösbare technologische Probleme hatten das Projekt in eine Sackgasse geführt: Die riesigen Dimensionen – der untere Kuppeldurchmesser beträgt 46 Meter – machten nämlich das traditionelle Bauverfahren mit hölzernem Lehrgerüst untauglich, weil kaum auszuführen und viel zu teuer. Brunelleschi, gelernter Goldschmied und exzentrischer Erfinder, war der Einzige, der eine freitragende Konstruktion vorschlug (Bild 3). Sie lasse sich, beteuerte er, allein mit Hilfe beweglicher Arbeitsbühnen aufmauern.
In seine raffinierte, zugleich stabile und gewichtsparende Mauerwerkskonstruktion liess Brunelleschi eine Reihe eigener Beobachtungen einfliessen, die er beim Studium der Pantheonkuppel in Rom gewonnen hatte. Die Konkurrenz führte also zu einer Lösung, die nicht auf professionell erworbenem Erfahrungswissen aufbaute – Brunelleschi hatte nie als Maurer gearbeitet –, sondern auf historischer Einsicht und systematischer Problemanalyse. Die Wettbewerbspraxis öffnete das Bauwesen für die revolutionäre Methodologie der Renaissance. Ihr sollte auf allen Wissensgebieten die Zukunft gehören.
Von den erfolglosen Konkurrenzentwürfen für die Domkuppel wissen wir so gut wie nichts – in die Florentiner Anekdotensammlung ist nur die Geschichte von jenem Witzbold eingegangen, der vorgeschlagen hatte, die Kuppel über einem gewaltigen Sandhaufen auszuführen. Ganz unten solle die Kommission ein paar Goldmünzen verstecken. An Freiwilligen, die später den Sand aus dem fertigen Bauwerk herausschaufeln würden, werde es dann schon nicht fehlen. Weitaus aufschlussreicher sind die Dokumente, die vom mutmasslich ersten internationalen Architekturwettbewerb erhalten sind. Die Konkurrenz um die Stadtfassade des Louvre sollte überdies zum Lehrstück dafür geraten, wie man Wettbewerbe politisch instrumentalisieren kann.
Erster internationaler Wettbewerb
War es doch Jean-Baptiste Colbert, allmächtiger Minister in Diensten des Sonnenkönigs Louis XIV., der sich mit den Vorschlägen französischer Architekten für das wichtigste Staatsbauwerk unzufrieden zeigte und so auf die Idee kam, die Creme der römischen Architekturszene – Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Carlo Rainaldi – um Konkurrenzentwürfe zu bitten.
Auf grösstes Interesse stiess Gianlorenzo Berninis bestechend elegantes, in dynamischer Kurvatur ein- und ausschwingendes Fassadenprojekt, das wie kein anderes versprach, den königlichen Palast mit der Stadt kommunizieren zu lassen. Gewiss, der Minister bat um Korrektur des einen oder anderen Punkts – die unbeschränkte Öffnung der Fassade weckte klimatische Bedenken und vor allem Sorge um die Sicherheit. Ganz so freizügig sollte und wollte der König mit seiner Hauptstadt offenbar doch nicht in Kontakt treten. Eine erste Projektüberarbeitung des berühmten römischen Cavaliere fand zwar noch immer keine spontane Zustimmung, aber der Minister lud Bernini im Auftrag des Königs doch zu einem Parisbesuch ein, um offene Punkte zu klären und sich persönlich kennenzulernen. Es sollte eine diplomatische Reise werden, begleitet von Höflichkeiten, Audienzen und geheucheltem Interesse auf beiden Seiten: ein letztlich misslungener Versuch der Verständigung. Aber auch ein Schritt, der sich als notwendig erwies, um eine erste Ausdifferenzierung nationaler Kunstauffassungen und Architektursprachen zu ermöglichen. Der europäische Barock wird Lehren aus dem Wettbewerb ziehen und hier ein grosses, neues Thema architektonischer Debatten entdecken.
Es war wohl diplomatischer Comment, der Colbert veranlasste, Berninis letzten Entwurf zum Ausführungsprojekt zu erklären und kurz vor der Abreise des Gastes den Grundstein für einen entsprechenden Neubau zu legen. Kaum war Bernini ausser Sichtweite, stoppte man die Arbeiten aber unverzüglich und liess eine Expertengruppe um Claude Perrault jenen Entwurf für die majestätische Kolonnade ausarbeiten, der aus Berninis Urprojekt zwar die Geste der Öffnung übernahm, sie aber in eine Triumph- und Distanzgebärde von unmissverständlicher Präzision umdeutete und so die Basis für die klassizistische Architekturtradition Frankreichs legen konnte.
ScheinWettbewerbe
Wettbewerbe, wir alle wissen es, werden oft genug nur zum Schein ausgeschrieben – um einem favorisierten Architekten, der eigentlich das Rennen schon im Voraus gemacht hat, über die Hürden öffentlicher Debatten und politischer Entscheidungen zu helfen. Solche Pläne können scheitern, aber auch glänzend gelingen, wie ein Blick in die Baugeschichte der ETH Zürich erweist. 1855 war Gottfried Semper als international renommierter Architekt an das neu gegründete Polytechnikum berufen worden. Aus fachlicher Perspektive mochte niemand anderer als er in Frage kommen, das Hauptgebäude der Schule zu entwerfen. Aber es ging um den bislang prominentesten Bau der jungen Eidgenossenschaft, ein Politikum ersten Ranges. Auch Zürcher Interessen mussten berücksichtigt werden: Staatsbauinspektor Johann Caspar Wolff machte sich Hoffnungen, selbst den prestigeträchtigen Auftrag zu erhalten.
Was lag näher, als den Ausweg eines internationalen Wettbewerbs zu wählen – schon um demokratischen Schein zu wahren. Der kluge Semper lehnte eine eigene Eingabe ab und nahm stattdessen Einsitz im Preisgericht, das – kaum überraschend – alle 19 eingereichten Projekte für ungeeignet befand und die Vergabe eines ersten Preises ablehnte. Verbinde doch kein Vorschlag «ein homogen erscheinendes Äusseres mit einer zweckmässigen durchgearbeiteten Anlage des Grundrisses», diktierte Semper in den Jurybericht. «Aus diesem geht nach unserem Ermessen hervor, dass für die Bauausführung keiner der vorliegenden Entwürfe geeignet, und dass vielmehr hierdurch die weitere Aufgabe gegeben ist, einen allen Vorgaben entsprechenden neuen Plan ausarbeiten zu lassen.» Damit hatte der Wettbewerb seine Aufgabe erfüllt: Für Semper war die Bahn frei, den Auftrag selbst – wenn auch in Zusammenarbeit mit Wolff, was zu manchen Problemen führen sollte – zu übernehmen.
Als aktuelle Mahnung können wir den schludrigen Umgang mit der materiellen Hinterlassenschaft des Zürcher Wettbewerbs von 1857/58 begreifen. Denn die von der Jury immerhin mit einem zweiten und dritten Preis ausgezeichneten Projekte – sie stammten von Caspar Joseph Jeuch, den Partnern Felix Wilhelm Kubly und Alexander Tritschler sowie Ferdinand Stadler – wurden zwar, wie alle anderen, eine zeitlang ausgestellt, aber weder veröffentlicht noch angemessen archiviert. Sie blieben im Besitz des Kantons Zürich, doch verlieren sich ihre Spuren schon 1859. Den Einsendern wurden sie anscheinend nie zurückgegeben – in den entsprechenden Nachlässen fehlen sie –, und weder im Staats- noch im Bundesarchiv ist heute eine Spur von ihnen zu finden. Sehr wahrscheinlich wurden sie schon in den 1860er-Jahren vom Staatsbauinspektorat vernichtet.
[ Andreas Tönnesmann ist Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH Zürich]TEC21, Di., 2007.04.10
10. April 2007 Andreas Tönnesmann
Bauingenieurwettbewerbe im Hochbau
Der Bauingenieurwettbewerb kann im Hochbau für alle Beteiligten interessante Resultate liefern. Unter «Bauingenieurwettbewerb» ist nicht der klassische Ingenieurwettbewerb, etwa für Brücken, zu verstehen, sondern ein kürzeres, vielfältiges und anpassungsfähiges Verfahren, das sich im Hochbau zwischen die «Team-Wettbewerbe» und die «Submissionsverfahren mit Konzepteingabe» einreiht.
Der Team-Wettbewerb ist für Aufgaben geeignet, bei denen die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Bauingenieur von Anfang an stattfinden muss, beispielsweise für grosse Sportstadien. Bei Bauvorhaben von hauptsächlich städtebaulich-architektonischer Bedeutung besitzt der Team-Wettbewerb aber auch Nachteile, denn es gibt in der Regel mehr teilnahmewillige Architekten als Ingenieure. Das heisst, die Gruppenbildung beruht darauf, wer am schnellsten auf die Ankündigung eines Verfahrens reagiert. Sie wird dadurch zumindest teilweise zufällig, und die Bauingenieure wirken ungewollt als Selektionsinstrument für die Architekten. Umgekehrt besitzen in diesen Fällen Fragen der Tragkonstruktion bei der Beurteilung eher eine beiläufige Bedeutung, und es findet dadurch keine eigentliche Selektion der Ingenieure statt. Bei kleineren Aufträgen ist das Submissionsverfahren mit Konzepteingabe zwar besser als die reine Honorarsubmission; es birgt in sich jedoch die Gefahr einer gewissen Oberflächlichkeit, da die Beurteilung üblicherweise nicht durch eine Jury erfolgt.
Der Bauingenieurwettbewerb im Hochbau kann etwa anschliessend an einen erfolgreichen Architekturwettbewerb durchgeführt werden. Das Interessante an diesem Verfahren ist, dass sich die Beteiligten (Bauherrschaften, Architekten, Jury) für eine bestimmte Zeit im Planungsprozess gezielt Fragen der Tragwerksgestaltung zuwenden. Selten werden sonst Fragen der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher konstruktiver Lösungen und der Wechselwirkung zwischen Tragwerk und Architektur derart intensiv diskutiert wie während der Beurteilung eines Bauingenieurwettbewerbs. Natürlich ist der Erfolg dieses Verfahrens an bestimmte Voraussetzungen gebunden: Das zugrunde liegende architektonische Konzept muss ein sinnvolles Tragwerk überhaupt ermöglichen, und aus den Resultaten des Bauingenieurwettbewerbs sind Rückwirkungen auf das architektonische Konzept zu erwarten, was von Bauherrschaft und Architekt eine entsprechende Offenheit verlangt.
Nach meiner Erfahrung handelt es sich bei dieser Form des Bauingenieurwettbewerbs noch nicht um ein allgemein bekanntes und anerkanntes Verfahren. Das hat einerseits mit dessen Zeitbedarf zu tun, andererseits aber auch mit dem immer noch verbreiteten Berufsbild des Ingenieurs als «Rechner». Der Bauingenieurwettbewerb ist ein überzeugendes Mittel, diesem Vorurteil entgegenzutreten – mich hat jedesmal die Vielfalt der eingegebenen Lösungsvorschläge selbst bei anscheinend einfachen Aufgaben überrascht. Tatsächlich ist der mögliche Anwendungsbereich für Bauingenieurwettbewerbe vielfältig. Das Verfahren ist sehr gut auch für kleinere Aufgaben geeignet, und gerade hier könnte es einen Beitrag dazu leisten, die Wahl von Bauingenieuren nach qualitativen Auswahlkriterien wieder zur Regel werden zu lassen, denn kleinere Aufträge sind das tägliche Brot.
Schulhaus Oescher, Zollikon
Für das Schulhaus Oescher in Zollikon wurden sieben Ingenieurbüros eingeladen, aufgrund der Architektenpläne im Massstab 1:200 konzeptionelle Vorschläge für ein sinnvolles Tragwerk zu unterbreiten. Die Jury bestand aus vier Bauherrschaftsvertretern, dem Architekten und einem externen Bauingenieur. Sie verglich die Eingaben einerseits hinsichtlich technischer Qualität, Wirtschaftlichkeit und architektonischen Potenzials. Andererseits wurden auch die Honorarofferte und die Referenzen der Bewerber mitbeurteilt. Die Gewichtung erfolgte mit 45 % für die konzeptionelle Qualität, 30 % für die Referenzen und 25 % für die Honorarofferte. Zur Beurteilung der architektonischen Wirkung liess die Jury von allen Vorschlägen Kartonmodelle erstellen. Den ersten Rang erzielte ein statisches Konzept, das aus einer Skelettkonstruktion bestand, deren Decken dank mittragenden Brüstungen in den Ecken weit auskragen. Es entsprach dem gewünschten architektonischen Ausdruck nach einem schwebenden Baukörper mit grossen Öffnungen und war gleichzeitig eine vergleichsweise wirtschaftliche Lösung.
Geschäftshaus Würth, Chur
Ein ähnliches Verfahren wurde für die Vergabe der Bauingenieurarbeiten für das Geschäftshaus der Würth Holding in Chur gewählt. Hier lud man drei Ingenieurbüros ein, konzeptionelle Vorschläge für ein Tragwerk zu unterbreiten. Wiederum dienten Architektenpläne im Massstab 1:200 als Grundlage. Das Preisgericht bestand aus einem Bauherrschaftsvertreter, dem Architekten und einem externen Bauingenieur. Bewertet wurden Konzept, Referenzen und Honorarofferte, eine Gewichtung wurde nicht formuliert. Die nicht beauftragten Ingenieurbüros erhielten eine Entschädigung zwischen 1000 und 3000 Franken. Besonders interessant war bei diesem Bauingenieurwettbewerb, dass das siegreiche statische Konzept zu einer Projektänderung bei den Architekten führte. Die Idee, die beiden Gebäudekerne mit weitgespannten Unterzügen stützenfrei zu verbinden, machte die einzelnen Geschossdecken voneinander unabhängig. Dadurch konnten die Deckenränder des zentralen Lichthofs unterschiedlich weit ausgekragt werden, was dazu führte, dass die einzelnen Stockwerke nun ganz unterschiedliche Raumeindrücke und Lichtstimmungen erhalten – eine architektonische Qualität, die erst aufgrund der Resultate des Bauingenieurwettbewerbs entdeckt und ermöglicht wurde.
Tivoli-Areal, Chur
Es gelang, die Besitzerin der Wohnhäuser des Tivoli-Areals in Chur davon zu überzeugen, dass ein Bauingenieurwettbewerb selbst für Wohnungsumbauten sinnvoll durchgeführt werden könne. Fünf Bauingenieurbüros wurden eingeladen, Vorschläge für die Ergänzung der bestehenden Decken im Bereich aufzuhebender Treppenhäuser einzureichen. Abgegeben wurden Pläne im Massstab 1:50 der bestehenden Konstruktion. Mitgeliefert wurden standardisierte, hinsichtlich Schalldurchgang vom Bauphysiker geprüfte Bodenaufbauten, die fallweise für massive oder leichte Deckenkonstruktionen verwendet werden sollten. Die Jury bestand aus zwei Bauherrschaftsvertretern, dem Architekten und einem externen Bauingenieur. Bewertet wurden die Vorschläge und die Referenzen ohne explizit formulierte Gewichtung, das Honorar wurde gemäss Ausschreibung erst nach dem Verfahren aufgrund des SIA-Leistungsmodells ausgehandelt. Sämtliche Teilnehmer erhielten eine Entschädigung von 2500 Franken. Die vermeintlich alltägliche Aufgabenstellung brachte fünf ganz unterschiedliche Lösungsansätze zu Tage, die sowohl monolithisch ergänzte und verzahnte Betonplatten wie auch Stahlträgerroste oder neue Holzbalkenlagen umfassten. Die Kosten der Vorschläge variierten pro Wohnungseinheit zwischen 5000 und 7600 Franken, was angesichts der zahlreichen Wohnungen den Wettbewerb für die Bauherrin schon aus wirtschaftlichen Gründen rechtfertigte. Mit beurteilt wurden die Konsequenzen der verschiedenen Vorschläge im Hinblick auf die Gestaltung der jeweiligen Bauabläufe.
Bundesverwaltungsgericht, St. Gallen
Für den Neubau des Bundesverwaltungsgerichts in St. Gallen wurde aus Gründen der Planungstermine gleich nach dem Architekturwettbewerb ein «Konzept-Bauingenieur» bestimmt, der im Rahmen seines Auftrags auch einen Bauingenieur-Leistungswettbewerb mitorganisierte. Der Kern des Leistungswettbewerbs bestand aus abzuliefernden Bemessungsproben von Betonbauteilen, deren Abmessungen bereits zuvor vom Konzeptingenieur festgelegt wurden. Die Teilnehmer hatten für die schlanken Decken die Vorspannung und die schlaffe Bewehrung zu bemessen. Weiter waren Vorschläge zur konstruktiven Durchbildung der aussen liegenden Fassadenstützen mit ihren Anschlüssen einzureichen. Daneben waren Erfahrungsnachweise anhand von Referenzen und das Honorarangebot gefordert. Das Beurteilungsgremium bestand aus zwei Bauherrschaftsvertretern (Architekten), dem projektierenden Architekten, dem Konzeptingenieur und einem weiteren externen Bauingenieur. Beurteilt wurden die Bemessungsproben (mit 50 % Gewicht) ausschliesslich vom Konzept- und dem zweiten externen Bauingenieur, die Referenzen (mit 30 % Gewicht) und die Honorarofferte (mit 20 % Gewicht) vom gesamten Beurteilungsgremium. Der Wettbewerb war offen, es erfolgten zehn Eingaben. Überraschend war wiederum die Bandbreite der vorgeschlagenen Bemessungslösungen, die von formtreuen Vorspannungen bis zu dicht bewehrten, nicht vorgespannten Decken reichte. Ähnliche Unterschiede zeigten sich bei der Bearbeitung der Stützen. Die Spanne der Kosten der Vorschläge für Vorspannung und Bewehrung schwankte zwischen 100 und 214%.
Die hier vorgestellten Verfahren betreffen Situationen, in denen üblicherweise keine Wettbewerbe durchgeführt werden. Sie weiten damit das Wettbewerbswesen auf bisher eher unerschlossene Gebiete aus. Ich wage zu behaupten, dass damit bei den Bauherrschaften eine gewisse Aufklärung über die Vielfältigkeit der Bauingenieurarbeit stattgefunden hat.TEC21, Di., 2007.04.10
10. April 2007 Jürg Conzett