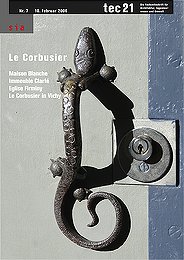Editorial
Marginalien?
Werke Le Corbusiers, die in Vergessenheit geraten sind? Erstaunlich, dass es Orte gibt, in denen sich Schätze des Meisters verbergen konnten. Im Falle der «Maison Blanche» in La Chaux-de-Fonds ist ihr Urheber daran nicht ganz unschuldig, hat er doch mit seiner Heimatstadt früh gebrochen. Doch nun ist sein Erstlingswerk dem Vergessen entrissen, ein Spätwerk (Eglise Saint-Pierre, Firminy) rehabilitiert und ein Schlüsselwerk erkannt («Immeuble Clarté», Genf) – und alle drei sind auf dem Weg ins kollektive Bewusstsein.
Ausgeblendet ist eine Facette seines Œuvres, das vor allem in der Romandie hohe Wellen wirft: Le Corbusiers Verhältnis zum Nationalsozialismus. Entfacht wurde die Debatte von Daniel de Roulets Artikel «Le Corbusier in Vichy» (S. 22), der in Ausgabe 20/05 von «Tracés» erstmals publiziert war. Die Diskussion dreht sich kaum um Le Corbusiers politisches Bewusstsein, um die Frage, wie sehr er sich mit dem Vichy-Regime identifizierte, dass er ihm seine Dienste anbot, oder ob er «nur» darauf spekulierte, in Pétain einen finanziell und politisch potenten Bauherrn zu akqui-rieren.
Eine der wenigen Stimmen zur Sache selbst erhob der Kunsthistoriker Jean-Louis Cohen, der die Äusserungen Le Corbusiers im «Impartial» vom 29. Oktober 2005 anlässlich der Eröffnung der «Maison Blanche» resümierte: «Le Corbusier était un homme un peu naïf et pas très democrate.» Ansonsten fokussieren die Reaktionen nicht das Thema, sondern nehmen den Autor ins Visier, werfen ihm Spitzfindigkeit, Profilierungssucht und «intellektuellen Terrorismus» vor, prangern ihn der «Tyrannei des politisch Korrekten» an, bezichtigen ihn des Revisionismus – ein Umkehrschluss: Es waren die Revisionisten, die im «Historikerstreit» die «Normalisierung der Geschichtsschreibung» in dem Sinne forderten, dass der Nationalsozialismus aus der damaligen Weltanschauung heraus begriffen werden müsse. Der Tenor der Stimmen zu Le Corbusier lautet denn auch: «Alle dachten so.» So, wie Le Corbusier schrieb? «(...) der kleine Jude wird eines Tages bezwungen», «Hitler kann sein Leben mit einem grossartigen Werk krönen: dem Ausbau Europas».
Warum fallen die Reaktionen auf de Roulets Erfahrungsbericht derart geharnischt aus? Warum sollen weltanschauliche Zeugnisse von ArchitektInnen nicht auch Gegenstand der Forschung sein?
Bei Giuseppe Terragni lag der Fall anders. Ihn traf postum eine Abwehrreaktion, sein Œuvre wurde als faschistisch gebrandmarkt, bis Bruno Zevi ihn bzw. seine Architektur rehabilitierte und die Einsicht etablierte: Ein faschistisch denkender Mensch kann Bauten ersinnen, die der Monumentalität entbehren, die keine städtebaulichen Gewaltakte sind – und vice versa.
Wenn das Ethos eines Baukünstlers als Marginalie seines gebauten Werks behandelt wird, dann mindestens eingedenk der Bedeutung der Randnotiz im Buchdruck: In neuen Büchern mag sie als Kritzelei und Sachbeschädigung wahrgenommen werden, in noch unpublizierten Manuskripten ist sie hingegen Korrektur und Kommentar, in alten Texten aber erschliesst sich dank ihr oft erst das Werk.
Rahel Hartmann Schweizer, hartmann@tec21.ch
Matrize
(SUBTITLE) Ein Spätwerk Le Corbusiers postum verewigt
Er hatte sie bis zuletzt nicht aufgegeben: die Kirche Saint-Pierre in Firminy, dem Ort, in dem er eine Unité d’Habitation, ein Kulturhaus und ein Stadium geplant hatte. Nun ist sie postum verwirklicht worden.
«Ich habe alle vertraglichen Anforderungen erfüllt, meine Arbeit erledigt (…) und nun kann ich mir nichts anders vorstellen, als einen Baubeginn zur grössten Freude aller», schrieb Le Corbusier zum Projekt der Kirche Saint-Pierre in Firminy nur wenige Monate vor seinem Ableben am 27. August 1965.
Trotz der Müdigkeit und seiner Enttäuschung angesichts der wiederholten Widerstände und Budgetbeschränkungen gab Le Corbusier die Idee dieses Kirchenbaus in Firminy-Vert beim französischen Saint-Etienne nie auf. Mitten in diesem neuen Quartier hat Le Corbusier das Kulturhaus, das Stadion sowie eine Unité d’Habitation erstellt und schliesslich das Projekt einer Kirche – gewissermassen als Krönung des Komplexes – erdacht.
Unbestreitbar ist zwar, dass ihm diese Studie am Herzen lag, doch kann man sich fragen, ob sich der Bau des Gebäudes, von dem er bloss ein schwach dokumentiertes Vorprojekt hinterliess, wirklich lohnte. In Loyalität und Anerkennung unterstützt der ehemalige Minister für Wiederaufbau und Bürgermeister von Firminy, Eugène Claudius-Petit, die ehemaligen Mitarbeiter des Architekten, damit die summarische Studie Wirklichkeit wird. Mit der Projektleitung wird José Oubrerie, der bereits im Atelier von Le Corbusier für das Projekt zuständig war, betraut. 1966 werden die Studien wieder aufgegriffen und 1973 die Bauarbeiten aufgenommen. Nach unzähligen Schicksalswendungen wird die Vollendung schliesslich auf das Frühjahr 2006 angesetzt.
Beitrag zur Erneuerung der sakralen Kunst
Das Projekt Saint-Pierre in Firminy steht im Kontext der vom Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–65) abgesegneten Erneuerung der sakralen Kunst. Der «Streit um die sakrale Kunst», der die Anfänge der Rekonstruktion prägte, konzentrierte sich auf die Einführung moderner Kunstwerke in konventionell gebliebenen Kirchen. Diese Debatte erwies sich in zweifacher Hinsicht als heilsam: Sie hat einerseits zur Folge, dass endlich Werke zeitgenössischer Künstler Eingang in die Kirche finden, während andererseits die Diskussion um das Wesen moderner, sakraler Architektur über reine Dekorfragen hinaus neu positioniert wird.
Dieses Erwachen in der religiösen Architektur liess etliche Werke hoher Qualität entstehen. Dabei spielte der Beitrag von Le Corbusier eine wesentliche Rolle. In der Kapelle von Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (1950–55) gab er der Diskussion eine neue Ausrichtung auf den eigentlichen Begriff des «Sakralen», das er «l’indicible» (das Unaussprechliche) nannte: Raum, Licht und Schatten, Plastizität der Materialien, Farbe, Parcours. «Wir hielten Le Corbusier nicht bloss für den grössten noch lebenden Architekten, sondern auch für denjenigen, bei dem das Gespür für das Sakrale am authentischsten und stärksten war», erklärt Pater Couturier, Direktor der Zeitschrift «L’Art Sacré». Diese Eigenschaften finden sich im Couvent de la Tourette in Eveux-sur-Arbresle bei Lyon (1953–60), aber auch im Projekt der Kirche Saint-Pierre in Firminy wieder, das den Schlusspunkt setzt.
Genese des Projekts
Die ersten Zeichnungen (1960–61) sind rasch skizziert. Seit über dreissig Jahren trägt der Architekt dieses Projekt mit sich – seit er eine Skizze für eine Kirche in Le Tremblay bei Paris (1929) gezeichnet hatte (Bild 8). Die Grundsätze eines sich aus einem quadratischen Sockel in die Höhe entwickelnden Rumpfs mit einer aussen liegenden Rampe – die eigentliche Identität der Kirche von Firminy – waren im Projekt aus der Vorkriegszeit im Wesentlichen bereits vorhanden. 1960, als er die ersten Striche für Firminy zeichnete, erschien ihm das Projekt als selbstverständlich, und fünf Jahre lang verfolgte Le Corbusier sein Projekt bis ins kleinste Detail. Obwohl Oubreries Beitrag aus dieser Zeit unbestreitbar ist, steht die «Urheberschaft» von Le Corbusier genauso ausser Zweifel.
Das Projekt entstand in sechs Etappen; einige davon wurden veröffentlicht, namentlich 1965 in «L’Œuvre Complète».[1] Diese Version entspricht der dritten, offiziellen Planreihe vom Dezember 1962 (Bilder 3–6). Hingegen datiert die perspektivische Zeichnung, die massgeblich dazu beitrug, die Silhouette dieses Projektes weltbekannt zu machen, vom 19. September 1963 (Bild 7). Die letzten bekannten Pläne, die einige Monate später im Dezember 1963 gezeichnet wurden, weisen unbedeutende Änderungen auf, die keinen Einfluss auf das Projekt haben, dessen Konzept sich nach den unzähligen Korrekturen in den Vorjahren stabilisiert hatte.
Auf der Grundlage dieser Schlusspläne wurde ein erster Kostenvoranschlag erstellt und eine geologische Untersuchung des von alten Bergwerken belasteten Standortes eingeleitet. Als dann der Kostenvoranschlag für das Fundament als zu hoch bewertet wurde, schlug der Pfarrgemeinderat einen anderen, weniger problematischen Standort vor. Le Corbusier legte jedoch Wert auf die räumliche Nähe zu Kulturhaus und Stadion, an denen er bereits baute, und dachte nicht daran, den ursprünglichen Standort aufzugeben. Er verringerte ein weiteres Mal die Dimensionen und die Neigung des oben schräg angeschnittenen, schief gelagerten Kegelstumpfs. Zwei heute verschwundene Modelle, die fotografisch dokumentiert wurden, veranschaulichen diese letzte Reduktion des Projekts Ende 1964.
Vergeblich. Die Bauherrschaft verzichtet im Januar 1965 endgültig auf die Realisierung des Projektes. Trotz der Energie, die Le Corbusier bis zu seinem letzten Atemzug einsetzte, ist das Projekt am Ende. Als er stirbt, gibt es noch keinen Ausführungsplan – und auch keinen Bauherrn mehr.
Der Beitrag von José Oubrerie
Oubrerie setzte das Werk fort und erstellte bis zum Baubeginn im Jahre 1973 mehrere Planreihen. Dann folgte eine ständige Anpassung an die verschiedenen Bauabschnitte unter dem schlechten Stern einer ungesicherten Finanzierung. 1978 erfolgte ein Baustopp; der Rohbau war schon zu zwei Dritteln erstellt; es fehlte im Wesentlichen noch der Kegelstumpf. Es dauerte ein Vierteljahrhundert, bis eine juristisch und finanziell tragbare Lösung gefunden wurde und die Bauarbeiten 2003 – diesmal endgültig – wieder aufgenommen werden konnten.[2] Oubrerie blieb beauftragter Architekt und wurde von Aline Duverger und Yves Perret als Ausführungsarchitekten unterstützt.
Das kurz vor seiner Vollendung stehende Werk stimmt zweifelsohne ebenso mit dem ursprünglichen Konzept von Le Corbusier überein, wie die Proportionen und die Silhouette des Gebäudes der letzten Phase aus dem Jahre 1964 entspricht. Während die Grundidee beibehalten wurde, weist das Ergebnis gegenüber den Referenzunterlagen zahlreiche Verzerrungen auf. Der Vergleich zeigt Einflüsse auf verschiedenen Ebenen: Anpassung an die jeweiligen Normen und Auflagen, Lösung zahlreicher Probleme, die im Vorprojektstadium nicht berücksichtigt worden waren, sowie persönliche Ergänzungen und Korrekturen durch Oubrerie.
Diese persönlichen Beiträge weisen darauf hin, dass der Architekt bestrebt war, dem Projekt, das er vierzig Jahre lang beharrlich mitgetragen hatte, seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Er übernimmt die volle Verantwortung für diese Änderungen, etwa beim Hinzufügen zweier Balkone aussen an der Südfassade bzw. im Innern entlang der Rampe von der ersten zur zweiten Ebene. Zwar gehören solche Balkone zweifelsohne zur Welt von Le Corbusier, doch zeugt deren nachträglicher Einbau vom Wunsch, sich das Projekt anzueignen. Das gilt auch für die geänderten Masse des Tores und der Eingangsschleuse, für das Profil der Geländer, die Ausrichtung der Kanzel, die Erweiterung des Hochaltars und dessen Sockel usw. Einige Änderungen sind zwar unbedeutend, doch hat das Urprojekt im Sinne der Charta von Venedig von 1964 – Einhaltung der Referenzunterlagen – einen Teil seiner Glaubwürdigkeit eingebüsst.
Die bedeutendste Modifikation, nämlich die nicht bestimmungsgemässe Verwendung des Gebäudefundamentes, ist allerdings nicht den Architekten zuzuschreiben. Dieses war ursprünglich für die Kirche vorgesehen und dient nun einem Nebengebäude des Museums für moderne Kunst von Saint-Etienne. Obwohl das Raumkonzept nicht verändert wurde, haben Oubrerie und seine Mitarbeiter einen Ausbau konzipiert, der vom ursprünglichen Programm abweicht. Es ist zu befürchten, dass die allgemeine Stimmung durch die technischen Einrichtungen des Museums beeinträchtigt wird.
Paradoxe Aufnahme ins Kulturgut
Allen Bedenken gegenüber eines postumen Bauwerkes bezüglich Authentizität und Ethik zum Trotz muss man feststellen, dass das Bauwerk, das nun seiner Vollendung entgegensieht, Ausdruck der formalen Kohärenz des städtebaulichen Konzeptes von Firminy-Vert nach den Vorstellungen von Le Corbusier ist. Die Kirche selbst ist von einer Qualität und räumlichen Originalität, die in den grössten Werken von Le Corbusier und im modernen Kulturgut zu finden sind.[3]
Der Aufnahmeprozess ins Kulturgut begann bereits 1984. Damals wurde das abbruchgefährdete Gebäude, das praktisch nur aus einem Fundament bestand, ins Inventar aufgenommen und 1996 schliesslich unter Denkmalschutz gestellt. Heute möchte die «Agglomération de Saint-Etienne Métropole» als neue Bauherrin die Le-Corbusier-Hinterlassenschaft von Firminy weiterentwickeln und als Raumplanungselement einsetzen. Die Vollendung der Kirche steht im Zentrum dieses neuen kulturellen Bewusstseins, das zur Aufnahme des Le-Corbusier-Komplexes in Firminy-Vert ins Unesco-Weltkulturerbe führen könnte.[4] Die postume Vollendung des Bauwerkes erhält so, über den blossen Akt der Anerkennung hinaus, eine wirtschaftlich-touristische Dimension – ohne die Diskussionen, die 1973 zum Baubeginn führten. So wird heute gewissermassen ein «neues Kulturerbe» Stück für Stück erbaut.TEC21, Fr., 2006.02.10
Anmerkungen
[1] W. Boesiger (Hrsg.): Le Corbusier, Œuvre complète, vol.7, 1957–1965. Les Editions d’Architecture, Zürich 1965. Die ausführlichste Dokumentation findet sich in: Anthony Eardley: Le Corbusier’s Firminy Church. IAUS/Rizzoli, NY; 1984.
[2] Die Geschichte des Baus und der Modifikationen im Projekt Oubrerie waren 2003 Gegenstand einer Untersuchung des Autors Gilles Ragot für die Fondation Le Corbusier und das französische Kulturministerium. Ein Auszug der Schlussfolgerungen wurde publiziert in der Zeitschrift «Faces», Frühling 2005, n°58.
[3] Videoreportagen des Baufortschritts seit 2004 bis heute können auf der Website der Ecole d’architecture de Saint-Etienne konsultiert werden: www.st-etienne.archi.fr
[4] Le Corbusiers Œuvre in Firminy figuriert auf einem transnationalen Dossier von Werken des Architekten für die Aufnahme ins Weltkulturerbe der Unesco, das Ende 2006 vollständig sein wird.
10. Februar 2006 Gilles Ragot
verknüpfte Bauwerke
Kirche Saint-Pierre de Firminy
Inkunabel
Das «Immeuble Clarté» in Genf wird auf Druck der Behörden endlich renoviert. Das bedeutendste Werk von Le Corbusier in der Schweiz ist seit langem in schlechtem Zustand. Doch renoviert wird nur das Äussere. Stockwerkeigentum und ein drohender Verkauf einzelner Wohnungen an die Meistbietenden verhindern eine denkmalgerechte Behandlung im Inneren. Die Gründung einer Stiftung könnte helfen.
«SOS» titelte die Zeitschrift «Werk» schon 1969 und rief Architekturfachleute zur Rettung des «Immeuble Clarté» auf. Heute ist die Situation des Denkmals noch prekärer als damals. Als Kandidat für das Unesco-Weltkulturerbe und seit 1986 unter Denkmalschutz gestellt, ist die Maison Clarté an der Rue Saint-Laurent 2/4 nicht vom Abbruch bedroht. Doch wegen der Besitzverhältnisse (Stockwerkeigentum) und weil mehr als die Hälfte der Besitzanteile von einem Konkurs betroffen sind, steht das Gebäude vor einer unsicheren Zukunft. Nun wird zwar mit der unbedingt notwendigen umfangreichen Restaurierung der Gebäudehülle begonnen. Doch ist nicht geklärt, wie weitgehend das einzigartige Bauwerk erhalten werden kann.
Ein Pionierwerk Le Corbusiers
Le Corbusier hat zahlreiche Projekte erarbeitet, auf die Genf heute stolz sein könnte, doch nur ein einziges konnte er realisieren. Die 1931/32 erstellte Maison Clarté ist wegen der darin verwirklichten innovativen Ideen weit über die Landesgrenzen hinaus von Bedeutung. Die Pläne und Skizzen des ersten Mehrfamilienhauses von Le Corbusier zeigen nämlich bereits die kühnsten Konzepte des gemeinschaftlichen Wohnbaus des 20. Jahrhunderts von den «immeubles villas» mit hängenden Gärten bis zum Prinzip der «rue intérieure», das zwanzig Jahre später in der Unité d’habitation in Marseille verwirklicht wurde. Das gewissermassen im Baukastensystem erstellte Gebäude beeindruckt durch die erfinderische Zusammensetzung und die Präzision der industriell vorproduzierten Elemente des Unternehmens Wanner. Der kombinierte Einfallsreichtum des Architekten und seines mitentwickelnden Auftraggebers Edmond Wanner machte den Bau eines eigentlichen Prototyps möglich, sowohl was die Standardisierung des Bauverfahrens betrifft (elektrisch geschweisste Eisenskelettkonstruktion, Trockenbauweise) als auch die eingesetzten Materialien und Detailkonstruktionen (Schiebefenster auf Kugellagern, «Solomite»-Paneele aus komprimiertem Stroh usw.). Wichtigstes Element mit Vorbildcharakter ist die Fassade, eine einzige, doppelverglaste Fensterfläche, die möglich wurde, weil die Skelettbauweise die Fassade von statischen Aufgaben befreite.
Hinter seiner durch die konstruktive Strenge ermöglichten einfachen Erscheinung weist diese «unité d’habitation» mit ihren ein- und zweistöckigen Wohnungen vom Studio bis zu neun Zimmern eine grosse typologische und somit auch soziale Vielfalt auf, um die man sie heute nur beneiden kann. Im Originalzustand gab es 45 Wohnungen, einen Fitnessraum und eine Zahnarztpraxis im 1. Stock sowie diverse Läden, Ateliers und Garagen im Erdgeschoss. Die vielfältigen Raumelemente haben Entwürfe vieler Architekten beinflusst und werden es wohl auch weiterhin tun. Die Konstruktion, die nun bei der Bauaufnahme wieder zum Vorschein kam, erwies sich allerdings als komplex.
Flickwerk und Pleiten
Die Maison Clarté war für Edmond Wanner von Anfang an ein finanzieller Fehlschlag. Die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre erlaubte es nicht, für die Wohnungen von gehobenem Standard in einem Handwerkerquartier einen angemessenen Mietpreis zu verlangen. Nach ein paar kleineren Renovationen zur Abdichtung von Dach und Balkonen, die der Architekt Marc-Joseph Saugey in den 1950er-Jahren ausführte, fasste der Eigentümer 1969 einen Abbruch und Wiederaufbau ins Auge, was billiger gewesen wäre als eine Renovation. Unter der Federführung des Bundes Schweizer Architekten gründeten rund sechzig Architekten und Liebhaber eine Immobilienfirma und kauften das Gebäude. Wegen der Unentschlossenheit in der Gruppe übernahmen die Architekten Bruno Camoletti und Pascal Häusermann die Aktien und liessen 1975–77 diverse Arbeiten ausführen. Bei dieser Gelegenheit bauten sie die achte und die neunte Etage um und privatisierten dabei die bis dahin allen Bewohnern zugängliche Dachterrasse. Die übrigen Eingriffe betrafen die technischen Installationen und punktuelle Reparaturen (Verglasungen, Spenglerarbeiten, Storen, Innenausbau usw.). 1986 gründeten sie die Clarté AG, wandelten das Mietshaus in Stockwerkeigentum um und verkauften Teile des Gebäudes an verschiedene Personen.
Doch die finanziellen Schwierigkeiten waren damit nicht gelöst. 1999 geriet der Anteil Camolettis (56% der Clarté AG) in Konkurs. Diesen Anteil verwaltet seither die Stiftung zur Verwertung der Aktiva der Genfer Kantonalbank. Einen vom Betreibungsamt festgelegten Verkaufspreis für die konkursiten Teile (19 Wohnungen, 10 Büros, 7 Lokale im Erdgeschoss, davon 4 Garagen) beurteilte die Stiftung als zu tief und entschied sich, sie an die Meistbietenden zu verkaufen.
Denkmalpflege unterstützt Restaurierung
Wegen des Versagens der Eigentümergemeinschaft und ihrer Entscheidungsunfähigkeit hat das Gebäude schwer gelitten. Verschiedene Renovationen an der Gebäudehülle und an den technischen Installationen sind unterdessen dringend. Die obersten Wohnungen weisen Wasserschäden auf, weil das Flachdach undicht ist; das gesamte Attikageschoss ist in sehr schlechtem Zustand. Bei den Balkonen sind die tragenden Elemente aus Stahl und die Geländer verrostet, und an der Südfassade sind wegen Dilatation diverse Fensterscheiben gebrochen. Viele Schiebefenster lassen sich nicht mehr öffnen, weil die Kugellager fehlen.
Im Bestreben, dieses einzigartige Werk zu erhalten, liess die Denkmalpflege des Kantons Genf seit 1990 in verschiedenen Studien sämtliche für eine allfällige Renovation nötigen Daten sammeln. Eine Untersuchung der Gebäudehülle wurde 1992/93 vom Architekturbüro Devanthéry et Lamunière durchgeführt. Dann folgten anlässlich der Renovation einer Wohnung im Auftrag eines Privatkunden diverse Experimente an der Fassade. Vor kurzem hat der Architekt Laurent Chenu ein Inventar des gesamten Gebäudeinneren erstellt. Seinen ausführlichen Zustandsbericht ergänzt eine «Schutzcharta» mit Regeln, die für alle Innenarbeiten gelten sollen.
Nach dem Eingreifen der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege und der entsprechenden kantonalen Behörde und unter dem Druck des Staatsrats, der drohte, die Arbeiten von Amtes wegen ausführen zu lassen, wurden schliesslich die Voraussetzungen zur Arbeitsvergabe durch die Miteigentümer geschaffen. Es ist die erste gründliche Renovation des Gebäudes, doch sie betrifft nur die Aussenhülle – Dach, Fassaden und Balkone – und einige technische Installationen und Normanpassungen, nicht aber die Wohnungen. Ziel ist eine möglichst weit gehende Substanzerhaltung. Technische Verbesserungen sollen nach Möglichkeit mit einbezogen werden. Die Kosten belaufen sich auf fast 10 Mio. Fr., wovon Bund und Kanton rund 22% übernehmen.
Die Arbeiten an den Fassaden haben unter der Federführung des Architekten Jacques de Chambrier vom Büro Sartorio, de Chambrier und Dutheil soeben begonnen. Zur Ermittlung der Vorgehensweise wurden vor Ort Aufnahmen, Sondierungen und Demontageversuche durchgeführt. Eric Favre-Bulle vom Atelier Saint-Dismas hat im Auftrag der Denkmalpflege Farbanalysen vorgenommen. Die Baustelle verspricht eine Fundgrube zu werden.
Vers une Fondation Clarté?
Inzwischen wurde die vor einigen Jahren vom Unterstützungskomitee für die «Maison Clarté» lancierte Idee einer Stiftung konkretisiert, die das Gebäude als Eigentümerin übernehmen könnte. Die Stadt und der Kanton Genf haben Statuten erarbeitet, und der Stadtrat hat der Kantonalbank-Stiftung ein Übernahmeangebot in der Höhe von 10 Mio. Fr. für die in Konkurs geratenen Anteile unterbreitet. Doch diese lehnte ab und hielt an der Versteigerung fest. Bis heute wurde allerdings noch keine Wohnung versteigert. Eine Fondation Clarté als Eigentümerin der Mehrheit der Anteile könnte die Erhaltung des Gebäudes nachhaltig sichern, weitere Eigentümer und Vereine einbeziehen, von Spendengeldern profitieren und mindestens eine Musterwohnung öffentlich zugänglich machen. Vor allem aber könnte wohl nur sie den «wilden» Umbau der Wohnungen stoppen und dafür sorgen, dass auch das Gebäudeinnere möglichst originalgetreu instandgesetzt und erhalten wird. Einige Wohnungsbesitzer wollen nämlich umbauen, andere haben es schon getan, oft ohne Respekt für die Architektur des Gebäudes oder gar mit illegalen Grundrissänderungen und Wohnungsvergrösserungen. Der Schweizer Heimatschutz will nun die Idee einer Stiftung noch einmal lancieren, indem er die Maison Clarté auf seine rote Liste gefährdeter Gebäude setzt (www.roteliste.ch). Letzter Schatten über der Maison Clarté bleibt so die Frage des Verkaufspreises. Er wäre nach realistischen Gesichtspunkten zu bestimmen und nicht durch die Spekulation mit dem Namen Le Corbusier. Die Maison Clarté ist ein Teil des Weltkulturerbes und kein Objekt für Meistbietende.TEC21, Fr., 2006.02.10
Literatur:
Jacques Gubler: SOS, Le sort de l’immeuble «Clarté» de Le Corbusier & Pierre Jeanneret, in: Werk 5/1969.
Catherine Courtiau: L’immeuble Clarté Genève, Le Corbusier 1931/32. Schweizerische Kunstführer GSK, 1982.
Le Corbusier à Genève 1922–1932. Ausstellungskatalog. Editions Payot, Lausanne, 1987.
Christian Sumi: Treppenhaus als Lichtquelle, in: Werk 6/1989.
La costruzione dell’Immeuble Clarté. Ausstellungskatalog. Accademia di architettura dell’Universita della Svizzera italiana, Mendrisio, 1999.
10. Februar 2006 Isabelle Claden
Palimpsest
(SUBTITLE) Le Corbusiers Erstlingswerk dem Vergessen entrissen
Mit archäologischer Akribie wurde Le Corbusiers Erstlingswerk, die «Maison Blanche» (1912–1919), in La Chaux-de-Fonds renoviert: ein spannender Prozess, bei dem so manches Geheimnis gelüftet wurde.
Die «Maison Blanche», wie Jeanneret die Villa nannte, ist ein Schlüsselwerk des nachmaligen Le Corbusier. Sie bricht mit dem Regionalismus, der die Bauten auszeichnet, die Jeanneret mit René Chappalaz realisierte (Villa Fallet, 1906/07, Villa Stotzer, 1908, Villa Jaquemet, 1908), als hätte er sich von Charles L’Eplattenier, seinem Lehrer an der Ecole d’art, lösen wollen. Sie weist aber auch über den neoklassischen Aspekt hinaus, der ihr attestiert wird. Jeannerets Lehrzeit bei Auguste Perret in Paris und Peter Behrens in Berlin schlägt sich ebenso nieder wie seine «Voyage d’Orient».
Ursprung und Original
1912, nach der Rückkehr von seiner Orient-Reise, im Alter von 25 Jahren, eröffnete Charles-Edouard Jeanneret sein Architekturbüro in der Rue Numa Droz 54 in La Chaux-de-Fonds. Mit dem Gedanken, seinen Eltern ein Haus zu bauen, spielte er schon 1907, als er ihnen eine «nette kleine Unterkunft» vorschlug.[1] Die erste Skizze datiert möglicherweise 1911 und befindet sich im ersten der sechs Skizzenbücher seiner «Voyage d’Orient» (Bild 4).[2] Der spätere Entwurf vom Januar 1912 (Bild 5) differiert zum ausgeführten Bau etwa in den Nischen oder Fenstern der Stützmauer.
Mit den Bauarbeiten wurde am 15. April 1912 begonnen, wobei Jeanneret bis Ende April an den Plänen arbeitete. Dabei unterschieden sich diejenigen, die er der Bau- und Feuerpolizei einreichte, markant von der Perspektive3, die gegen Ende April entstanden sein dürfte, und diese wiederum stimmt nicht mit der ausgeführten Fassung überein (Bilder 1, 2). Zwar war das Haus nach sechs Monaten gebaut. Dennoch ist der Originalzustand schwer auszumachen. Denn Jeanneret behandelte das Haus wie ein «banc d’essai grandeur nature», «wo er Türen öffnet und unterdrückt, Farben und Verkleidungen ändert»: ein Experimentierfeld. Bruno Reichlin bezeichnet das Haus daher als «Palimpsest» (mehrfach beschriebenes Pergament).[4]
Adlernest und Promenade architecturale
Die «Maison Blanche» steht auf der Sonnenseite des
Pouillerel, hoch über La Chaux-de-Fonds. Stieg man vor der Renovation die Rue du Haut-des-Combes hoch und bog von Osten in den Chemin de Pouillerel, verbarg es sich hinter dichter Bewaldung. Heute, nachdem das Waldstück stark gelichtet wurde, thront es über dem Hang, und die Assoziation mit einem Horst – Jacques Gubler verglich 1987 diese Ostseite mit einem Adlernest – ist noch augenfälliger geworden.
Jeanneret nutzte die Hanglage und rang ihr landschaftliche Aspekte ab, die seinen Bau zum Fokus einer Promenade architecturale machen, in deren Verlauf sich die Physiognomie der Villa ständig ändert. Jede Fassade hat ihre eigene Ausformulierung, und keine ist symmetrisch. Es finden sich allein zehn verschieden dimensionierte Fenstertypen.
Der Weg flankiert erst den Garten, biegt dann nach rechts auf die «terrasse inférieure», am Fuss der Südseite des Hauses (Bild 21). Von hier geht es über einige Stufen auf die «terrasse supérieure», die linker Hand von einem konkav geformten Tor überfangen ist. Von hier leitet eine Treppe in die Chambre d’été. Unvermittelt steht man vor der Apsis des Hauses und ist schon in der Privatsphäre. Hat man den Garten durchquert, erreicht man wieder ein, diesmal überwölbtes, Tor. Man hat die Rückseite des Hauses erreicht – und steht wieder draussen vor der Haustür.
Wie ein Nabis-Gemälde
Vom Vestibül (0.03), das sich in ein Entrée (0.04) und eine Garderobe (0.05) gliedert, geht rechts die Küche (0.02), das Rückgrat des Hauses, ab (Bild 17). Das Antichambre (Vorzimmer, 0.08) bildet mit seinem zwölfteiligen, 325u218 cm grossen Fenster, das den Blick auf den heute spärlich bewaldeten Abhang rahmt, einen Prospekt. Leo Schuber assoziiert es mit einem Proszenium. Es erinnert aber auch an das von Schülern L’Eplatteniers eingerichtete Musikzimmer in der Villa Matthey-Doret in La Chaux-de-Fonds.[5]
In entgegengesetzter Richtung schweift der Blick – dank mehreren Glasfalttüren kaum gehemmt – durch den Wohnraum (0.10), das «Querschiff der Kathedrale»[6] und das Esszimmer (0.01), dessen absidialer Abschluss in den Garten ausgreift. Die Blumentapete des Salons und der von den Glastüren gerahmte Ausschnitt des Gartens verschmelzen wie auf einem Gemälde eines Pierre Bonnard oder Edouard Vuillard.
Die Treppe ins Obergeschoss führt in die «lingerie» (Bild 18, 1.09), die über dem Antichambre liegt und von Bad (1.10) und WC (1.04) flankiert wird. Die Wäschekammer, die auch den Charakter eines Vestibüls hat, geht ihrerseits in einen Korridor (1.13) über. An dessen Ende liegt das Zimmer des Architekten mit halbkreisförmigem Abschluss (1.01), links das Schlafzimmer der Eltern (1.11), rechts das Atelier mit dem Oblicht, das Jeanneret für sich selber einrichtete (1.03). Die Werkstatt des Vaters situierte Jeanneret im Unter-, das Zimmer seines Bruders Albert im Dachgeschoss.
«Schiere Masse von Referenzen»
Mit der Renovation ging eine Spurensuche einher, deren Fährte Jeanneret selber legte, als er schrieb, er habe die Villa nach seiner Rückkehr von seiner Reise durch Griechenland, Asien, die Türkei und Italien gebaut, als er noch voll gewesen sei «von der grossen, klaren, formalen Architektur der mediterranen Länder (...), die einzige Architektur, die ich anerkenne».[7]
Die Carnets der «Voyage d’Orient» sind eine wahre Fundgrube. Man könnte meinen, Jeanneret habe in dem Haus sein Reisegepäck wie ein Füllhorn ausgeschüttet. Ritter kommentierte den Bau 1915 denn auch als «white and grey house transplanted from the Bosporus».[8]
Dem Entwurf vom Januar 1912 (Bild 5) näher als die Skizze von 1911 (Bild 4) ist das «rumänische Haus» (Bild 6). Der thronende Aspekt der Maison Blanche erinnert an etliche Skizzen aus Istanbul, aber auch an die Villa Lante.[9] Der absidiale Abschluss des Wohnraums wird – aus der Untersicht zusammen mit der Stützmauer des Garten gesehen – mit einer Fotografie Jeannerets des Petersdoms in Rom vom Oktober 1911 in Verbindung gebracht.[10] Die Abside könnte aber auch vom Wohnhaus in Pera, das Jeanneret im Juli 1911 skizzierte, inspiriert sein.[11] Die Faszination für Mauern – vor allem als Einfriedungen – reisst in den Carnets nie ab, und es liessen sich zahllose Beispiele für sie finden.[12] Die naheliegendste Referenz für die Komposition der Pergola aus Mauer, Laube, Geländer, Baldachin und durchbrochenem Lattenwerk findet sich in einer Skizze ebenfalls aus Istanbul vom Juli 1911, die einen «erhöhten Garten mit Laubengang» zeigt (Bild 12). Pate gestanden haben könnte auch die Skizze der Pergola der Albergo del Sole, wo Jeanneret während seines Aufenthalts in Pompeij residierte (Bild 8). Aber auch der Portiko des Hauses des Sallust in Pompeji scheint sich in der Pergola zu reflektieren.[13]
Die Ruinen in Pompeji, die der Zerstörung wegen nicht mehr als Innen-, sondern als Aussenräume erlebt werden, machen die Lektüre der Chambre d’été sowohl als Aussen- als auch Innenraum verständlich.[14] Der Torbogen am Fuss der Sommerstube figuriert ebenso als architektonisches Landschaftselement, wie es als Ruinenfragment gelesen werden kann.
Transitorisch
An der Pergola lässt sich aber auch die Verbindung zwischen Tradition und Moderne illustrieren, ist sie doch «verwandt» mit Peter Behrens’ Gartenanlage des AEG-Pavillons an der Deutschen Schiffbau-Ausstellung[15] oder Heinrich Tessenows Patio des Damen-Sonnenbades beim Dalcroze-Institut in Hellerau bei Dresden von 1910–11 (Bild 13).
Einen Ausblick auf die Moderne gewährt auch die Reihung der Fenster des Schlafzimmergeschosses (Bild 1). Dass Jeanneret den dunkelbraunen Ölanstrich (wie 1965, Bild 3) der ihnen vorgelagerten Kolonnade durch einen solchen in gebrochenem Weiss ersetzen liess, unterstreicht diese Absicht. Mit der grauen Eternitdeckung des Daches, die auf den zeitgenössischen Fotografien gleichsam mit dem Himmel verschmilzt, erzielte er einen kubischen Ausdruck.
Und es klingt an, was Le Corbusier später untersuchen wird:«(...) immerhin würde es der gute Geschmack gebieten, den Zustand zu belassen, da die Proportionen aller Räume sehr genau studiert sind.»[16] Es scheint, als hätte Jeanneret seinen Bau ebenso in der Architekturgeschichte verankern wie einen «Ausblick» auf die «kommende Baukunst» lancieren wollen: «Die intendierte Verwirklichung einer Fülle von künstlerischen Zielen wurde erstickt durch die schiere Masse von formalen Referenzen an die Architektur, die er in Deutschland und auf seiner Orient-Reise gesehen hatte.»[17]
Konstruktion
Konstruktiv markiert das Haus ebenfalls einen Übergang. Obwohl konventionell gebaut – mit tragenden Aussenmauern und vier gemauerten Pfeilern von 50u60 cm, die ein Rechteck bilden –, nimmt die Struktur der Innenräume, die nur durch leichte Trennwände gegliedert sind, den freien Grundriss vorweg. Beton kommt spärlich zum Einsatz, sichtbar nur im dekorativen Element der Kolonnade im Obergeschoss, in den Bordüren der Wege des Gartens und der Chambre d’été.
Die Geschossdecken bestehen aus in nordsüdlicher Richtung zu den vier Innenstützen verlaufenden Primärträgern aus Eisen. Diese sind in der Querrichtung mit Holzbalken oder Eisenträgern (IPN 100 oder 160) ausgefacht, die Hourdis-Deckenelemente aus Ton oder Beton (Leichtbeton, Schlackenbeton oder Beton mit Kalk als Zuschlagstoff) aufnehmen. Der Dachstuhl besteht aus zwei Dachbindern und einem traditionellen Sparrenwerk. Das Bruchsteinmauerwerk der Aussenwände ist auf der Innenseite mit einer 6cm starken Schicht Schlackenmörtel ausgeschlagen, die als Wärmeisolation und als Unterlage für den glatten Gipsputz dient. Auf der Aussenseite nimmt dieselbe Schlackengrundlage den Aussenputz aus Luftkalk und hydraulischem Kalk auf.
Experimentierfeld
Ausgangspunkt der Renovation, die der einheimische Architekt Pierre Minder und der Landschaftsplaner Peter Wullschleger mit einer Fachkommission vornahmen, waren vier Kriterien: 1. Grad der technischen Erkenntnisse; 2. Bedeutung für die «Maison Blanche»;
3. Bedeutung für das Werk Le Corbusier; 4. Bedeutung für das künftige Funktionieren des Hauses.
Da Haus und Garten nicht erst nach der Ära Jeanneret-Gris, also nach 1919, zum Teil einschneidend verändert wurden, sondern auch zwischen 1912 und 1919 Modifikationen erfuhren, bedurfte es exakter Untersuchungen und Sondierungen, um dem möglichst Originalen auf die Spur zu kommen.
Fassaden
Allein bei den Fassaden liessen sich drei Phasen ermitteln, wobei das von Jeanneret selber veranlasste Übermalen der Kolonnade im Obergeschoss die markanteste Veränderung des Ausdrucks bewirkte. Mit dem dekorativen Aspekt der Kolonnade durchaus im Einklang war das Mosaik, das das Fenster des Salons ab 1964–65 rahmte (Bild 3). Obwohl nicht original, wurde es daher sorgfältig entfernt, um es gegebenenfalls wiederherstellen zu können.
Beeinträchtigt worden war die Gesamterscheinung der Villa vor allem in den 1940er-Jahren, als man mit Tonziegeln die Eterniteindeckung des Daches ersetzte. Deren Rekonstruktion war entscheidend für die Rehabilitation des Baus. Er erscheint heute indes nicht in jenem strahlenden Weiss, wie die Bezeichnung «Maison Blanche» vermuten liesse. Grund für das kaum gebrochene Weiss war eine geringe Menge Titan, mit der man die einstige Mischung aus Luftkalk, Kasein und Champagnerkreide stabilisierte. Da Titan 1912 aber nicht zur Verfügung stand, verzichtete Pierre Minder nun auf die Substanz, welche die Farbveränderung des Kaseins mindert, dessen es zur Fixation des Kalks bedarf. Im Winter hebt sich die Fassade mit einem leicht gelblichen Stich gegenüber dem Weiss des Schnees ab.
Fliesen und Linoleum
Kaum Eingriffe hatten die Räume der Villa erfahren. Materialien und Farben von Böden und Wänden dagegen waren zum Teil massiven Eingriffen unterzogen worden. Doch konnten viele originale Reste gesichert und restauriert oder aufgrund von schriftlichen Zeugnissen rekonstruiert werden.
So fand man einige der Fliesen aus emailliertem Zement in den Farben Blau und Crème und in den Dimensionen von 20u20 cm, welche die Böden der Serviceräume (Bilder 17, 18) bedeckt hatten und später teilweise durch ein schwarz-weisses Schachbrettmuster (10u10 cm) ersetzt worden waren. Zieren Korridor, WC, Küche und Badezimmer heute die blau-weissen Fliesen, dokumentiert das Vestibül die zweite Phase des Schachbrettmusters (Bilder 34, 35). Das Linoleum der Aufenthaltsräume (Bilder 30, 31) existierte noch zu grossen Teilen und konnte restauriert bzw. im Elternschlafzimmer aufgrund einer Beschreibung Jeannerets, «le sol est bleu»[18], neu verlegt werden . Dabei wurde der Farbton demjenigen der Fliesen angepasst. Daraus abgeleitet, wählte man das Linoleum für Jeannerets Zimmer ebenfalls in Blau (Bilder 28, 29).
Tapeten und Jute
In der Ära Jeker (ab 1919) – so Georges Jeanneret in seinem Journal am 17. Mai 1922 – waren alle Wände ausser denjenigen des Vestibüls mit «Salubra»-Tapeten verkleidet worden. Im Salon ersetzten diese die inzwischen berühmt gewordene Tapete mit dem Blumenmuster, wie sie auf zahlreichen Fotografien dokumentiert ist und von der Reste in situ, hinter einem Heizkörper, vorgefunden wurden. Sie wurde rekonstruiert und wirkt heute etwas poppig, obwohl die Farben dem Original entsprechen und das Grün des Blattwerks jenes Grün aufnimmt, mit dem Teile der Radiatorverblendung unter dem Fenster gestrichen waren (Bilder 30, 31). Der kleine Salon war ebenfalls mit neuen Tapeten versehen worden, die eine Tapete mit Streifenmuster ersetzten. Naturbelassene Jute fand man in Teilen des Vestibüls und in der Bibliothek.
Farben und Putze
Auch den Grad der Polychromie der nicht mit Tapeten verkleideten Wände zu ermitteln gestaltete sich schwierig. Dass Jeanneret am 10. März 1913 an Auguste Perret schrieb: «Je ne m’étais pas encore posé le problème de la polychromie architectural», machte die Sache nicht einfacher. Die Sondierungen bestätigten immerhin, was der Urheber im selben Schreiben berichtete: «(…) les murs ont la sérénité de leur crépi blanc et l’on mange bien dans le blanc et l’on y dort tranquille avec le bleu d’un plancher (…)».[19] Die Untersuchungen ergaben eine Mischung von Grau- und Blautönen, deren Intensität je nach Raum variierte. Abweichungen stellten der Raum mit dem halbkreisförmigen Abschluss im Obergeschoss, der in Ockergelb gestrichen war (Bilder 28, 29), und das Treppenhaus dar, dessen Holzelemente in einem dunklen, satinierten Blau gehalten waren.
Verborgenes
Minder und sein Team lüfteten so manches Geheimnis. So förderte die Stratografie im Antichambre einen rotbraunen Fries zutage, der die Decke zierte. Die Farbe korrespondiert mit dem Rot-Ton des Linoleums in der Bibliothek, und dieser wiederum fand einst seinen Widerhall im kleinen Salon. Hier, wo man die erwähnte Tapete mit Streifenmuster für ursprünglich gehalten hatte, stiess man auf ein Stück rotbrauner Jute – als wäre es eine Replik auf den Boden in der Bibliothek. Da die Entdeckung zu kurzfristig war, gelang es bis zur Eröffnung nicht, entsprechend gefärbte Jute aufzutreiben. Doch war sie ein weiteres Indiz dafür, dass Jeanneret die Räume nicht nur in Abfolge und Kubatur, sondern auch im Dekor zueinander in Beziehung setzte – innerhalb des Hauses genauso wie zwischen innen und aussen. Dort liegt die augenfälligste Korrespondenz zwischen dem Ultramarinblau der Pergola, des Baldachins und der Linie, die den Traufladen ziert (Bild 22).
«chambre d’été» und Garten
Dem Grünraum liess Jeanneret eine kaum minder sorgfältige Planung angedeihen als dem Haus. Allerdings behandelte er nicht das gesamte Gelände gleich intensiv. Ein Hauptaugenmerk legte er auf die «promenade architecturale», die «chambre d’été» mit der Pergola und dem «chiosque». Diese beschrieb er beim Verkauf an Jeker am 21.1.1919: «Die Gartenterrasse bildet so recht eine Sommerstube; sie ist gegen Einblicke von aussen vollständig abgeschirmt, bietet das Panorama der Bergketten und ist so orientiert, dass sie von Morgen bis Abend den ständigen windgeschützten Aufenthalt auf einem stets trockenen Plattenboden zwischen Blumenbeeten und Rasenflächen erlaubt. Diese ‹Sommerstube› ist eine hierzulande bisher unbekannte Erfindung von erheblicher Annehmlichkeit.»
Auch die Gartengestaltung bedurfte einer intensiven Recherche (Bilder 22–25). Das Terrain war extrem überwachsen und die «chambre d’été» zu einem Wohngarten im Stil der 1940er-Jahre mit Granitplatten und einem besseren Holz«verschlag» umgestaltet worden. Die Pergola musste zur Gänze rekonstruiert, mithin eine «Fälschung» vorgenommen werden. Dank dem vorgefundenen Bruchstück eines roten Klinkers von 12u24u6 cm liessen sich die Wege rekonstruieren – in englischem Verband bzw. im Fischgrätmuster –, beide gerahmt von Bordüren aus Beton. Die Rasenflächen wurden wieder mit Rosen bepflanzt.
Den Südhang unterhalb der «terrasse inférieure» hatte Jeanneret seinem Vater als Experimentierfeld überlassen. Für diesen Bereich musste sich Wullschleger auf die Aufzeichnungen des Vaters, Georges Edouard Jeanneret-Gris, verlassen, der eine Vielzahl von Pflanzen vermerkte: Apfel, Eberesche, Kastanie, Kirsche, Linde, Pflaume und Rotbuche; Aster, Clematis, Dahlie, Fingerhut, Geranium, Kornblume, Klatschmohn, Leberblümchen, Nelke, Ringelblume, Rhabarber, Rose, Schlüsselblume, Schneeglöckchen und Springkraut; Farn, Johannisbeerstrauch und Weissdorn. Da viele einjährige Pflanzen waren, die einen hohen Pflegeaufwand verursacht hätten, wurde beschlossen, die Vielfalt zu reduzieren und den Südhang als Wiese zu belassen – bis auf ein umgegrabenes Carré an der Stelle, wo sich einst der Gemüsegarten befand.
Schatz gehoben – Geheimnis gelüftet
Die «Maison Blanche» wurde nach allen Regeln der Kunst renoviert. Es wurden die Originalmaterialien eingesetzt oder zumindest fachgerecht imitiert. Anhand zahlreicher ursprünglicher Fragmente können Besucherinnen und Besucher den Unterschied zwischen Original, «Imitat» bzw. Rekonstruktion und neuzeitlicher Adaption nachvollziehen: so beim Fries im Antichambre, bei den blauen und cremefarbenen Fliesen oder an der unterschiedlichen Textur des originalen und des rekonstruierten Linoleums in Jeannerets Arbeitszimmer (Bilder 32, 33). Es wird – mit den Fliesen in Blau und Creme und in Schwarz-Weiss oder im Ultramarine von Pergola und Traufladenlinie, das nur für kurze Zeit gleichzeitig existierte – der Charakter des «work in progress» vorgeführt. Und dank der Restaurierung des Cheminées und des Sofas herrscht auch noch ein Hauch der einstigen Wohnatmosphäre.
Dennoch hat das Haus seine Geschichte eingebüsst, sein «Episoden-Gedächtnis». Das ist der Preis jeder Renovation, die in den «Urzustand» zurückversetzen will. Auch wenn diese eine Zeitperiode einfängt, muss sie manche Schicht – die rotbraune Jute, die spätere Tapete mit Streifenmuster und die noch spätere «Salubra» im kleinen Salon, die ockerfarbene und die helle Kolonnade im Obergeschoss – ausblenden.
Dass einem scheinen will, das Haus habe mehr Schätze geborgen, als es noch von Pflanzen «überwuchert», von Verputzen übertüncht, von Farbschichten überzogen, von Tapeten überkleistert und mit Bodenbelägen überdeckt war, liegt vielleicht gerade in der Flut von Referenzen, Relikten und «Ruinen».
Die Entschlüsselung des Geheimnisses um das Weiss ist vielleicht die symptomatischste Konsequenz: Sie verweist auf die veränderte Wahrnehmung und relativiert die Identität als «Maison Blanche».TEC21, Fr., 2006.02.10
Anmerkungen
[1] H. Allen Brooks: Le Corbusier's formative years: Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-Fonds. University of Chicago Press, Chicago, 1997, S. 310.
[2] Ch.-E. Jeanneret Le Corbusier: Voyage d'orient. 6 Carnets, Electa Moniteur, Mailand, 1987, Carnet 1, S. 121.
[3] Brooks, S. 316, fig. 235, S. 315, fig. 234.
[4] Pierre Minder: Restauration de la Maison Blanche – Etude préparatoire – Rapport de Synthese. April 2003.
[5] Stanislaus von Moos et. al. (Hrsg.): Le Corbusier before Le Corbusier: 1907–1922. Yale University Press, New Haven, 2002, S. 56.
[6] Brief Ch.-E. Jeannerets an Ritter, 10.02.1913, Catherine Courtiau: Maison Blanche ou Villa Jeanneret. Rapport historique et architectural, S. 29.
[7] Brief Ch.-E. Jeannerets an Fritz Ernst Jeker, 11.9.1919, zitiert nach Arthur Rüegg: Villa Jeanneret-Perret, in: Stanislaus von Moos et. al. (Hrsg.): Le Corbusier before Le Corbusier: 1907–1922. Yale University Press, 2002, S. 208.
[8] Brooks, S. 312.
[9] Giuliano Gresleri: Le Corbusier – Reise nach dem Orient. Spur Verlag, Zürich, 1991, S. 273, 275.
[10] von Moos (Hrsg.), S. 66.
[11] Gresleri, S. 274.
[12] Gresleri, S. 186.
[13] von Moos, S. 65.
[14] von Moos (Hrsg.), S. 65.
[15] Tillmann Buddensieg: Peter Behrens und die AEG. Werkkatalog, D5.
[16] Brooks, S. 328, Anm. 11.
[17] von Moos (Hrsg.), S. 66.
[18] Brief Ch.-E. Jeannerets an Ritter, 17.11.1912, zitiert nach Minder, S. 20.
[19] Brief Ch.-E. Jeannerets an Auguste Perret, 10.3.1913, zitiert nach Minder, S. 21.
[20] Penelope Hobhouse: Eine Kulturgeschichte des Gartens. Dorling Kindersley, 2003, S. 92.
[21] Dominik Gügel: Schloss Arenenberg und sein Landschaftspark, in: Arkadien am Bodensee. Huber, Frauenfeld, Stuttgart, Wien, 2005, S. 147.
[22] Clemens Steenbergen, Wouter Reh: Architecture and Landscape – The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Birkhäuser 2003, S. 34.
Zusatz:
Das Haus und seine Besitzer
(rhs) Nur sieben Jahre bewohnt das Ehepaar Georges Edouard und Marie Charlotte Amélie Jeanneret-Perret die «Maison Blanche». Als sie 1919 verkauft werden soll, interessiert sich Fritz Ernst Jeker dafür. Aus dieser Zeit, vom 21. Januar 1919, stammt eine Beschreibung des Baus vom Urheber: «Es gibt an diesem Ort kein Anwesen, das durch die Anordnung der Öffnungen und der Räume eine ebenso schöne Aussicht auf die umgebende Landschaft erschliesst. (...) Die innere Einteilung des Hauses wurde so entworfen, dass es (...) die vollständige Besonnung der Wohnräume gewährt. Der Dachhimmel, der das Obergeschoss beherrscht, erlaubt es, die Schlafzimmer im Sommer kühl zu halten. (...) Trotz der Intimität der Wohnräume gestattet es die besondere Konzeption des Erdgeschosses, grosse Empfänge zu geben; bei Konzerten fanden hier schon ohne weiteres 130 Personen Platz.»
1922 kommt Jean-Ernest Welti zum Zug. Dessen Tochter Edmée zieht mit ihrem Ehemann, dem Rechtsgelehrten Jacques Cornu, ein. Das Paar erwirbt das Haus und bewohnt es bis 1988. Nach dem Tod des Maître Cornu veräussert es dessen Frau an die Gebrüder Reinhard und Josef Borer aus Laufen, die es aber nie bewohnen, sondern bis 1994 an Michel Jacot vermieten. Im Herbst desselben Jahres wird es einer Aussenrenovation unterzogen, steht aber danach leer, bis es die Association Maison Blanche am 7. Juli 2000 erwirbt.
10. Februar 2006 Rahel Hartmann Schweizer
verknüpfte Bauwerke
„Maison Blanche“ - Renovierung